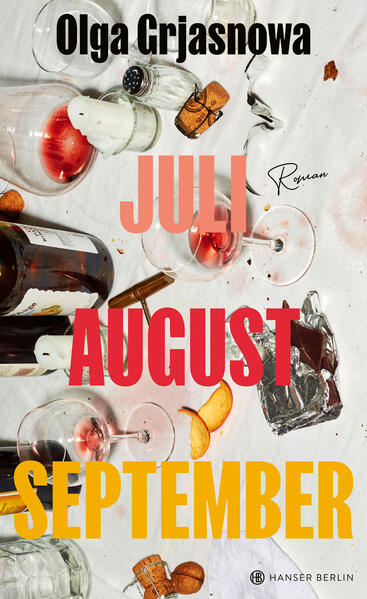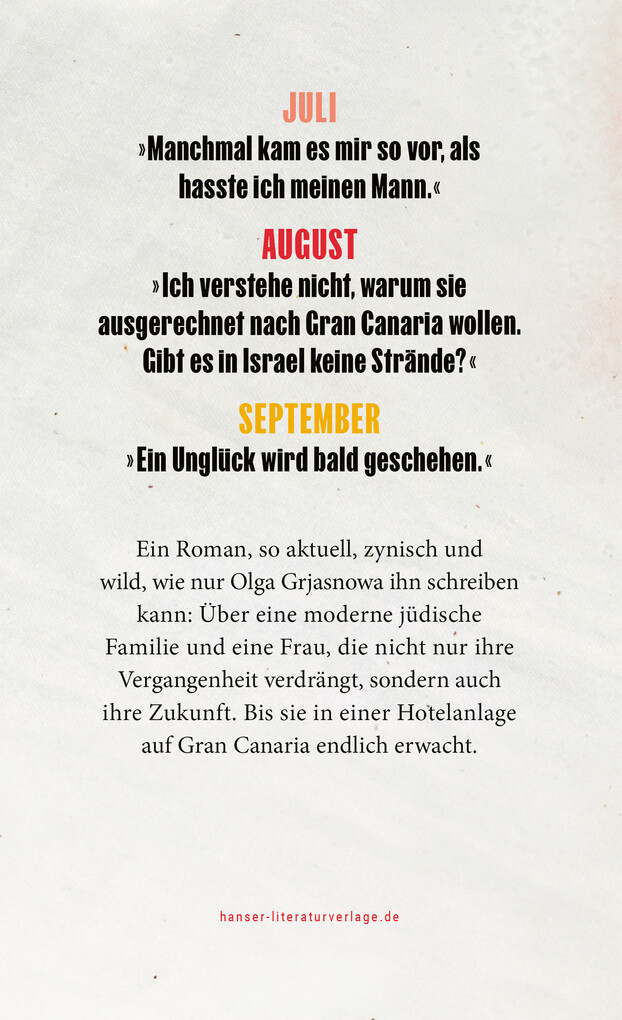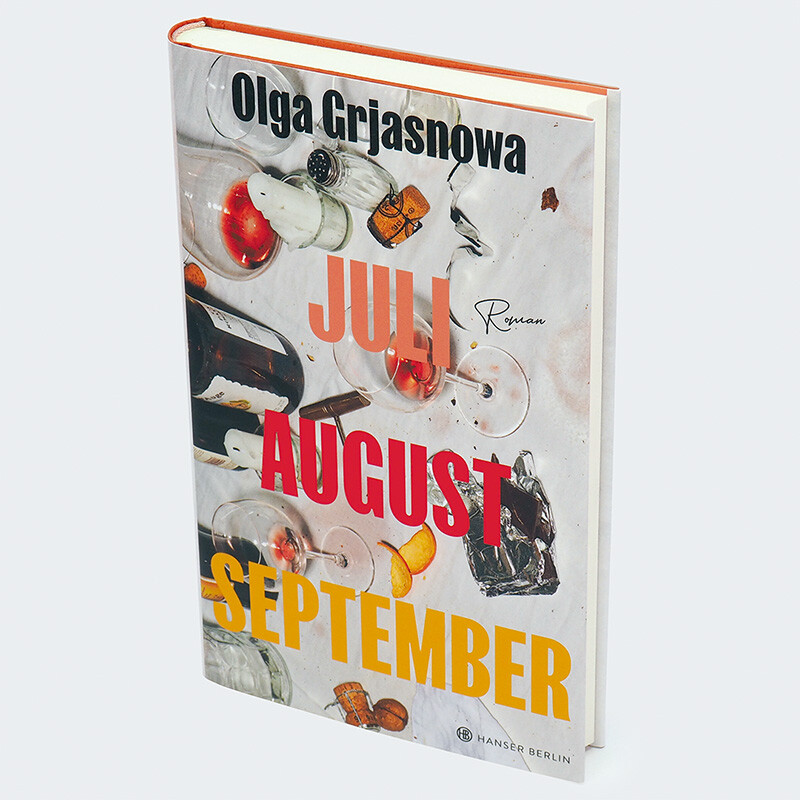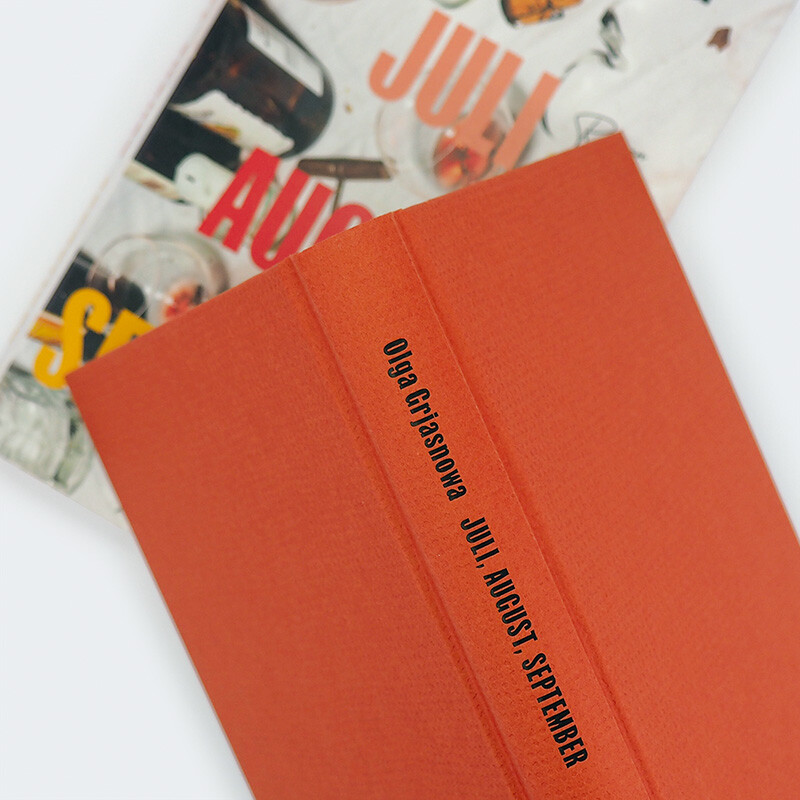Olga Grjasnowa ist eine Meisterin des Beiläufigen . . . sie fängt jüdisches Lebensgefühl in Deutschland ein. Silvi Feist, Emotion, 03. 09. 24
In Olga Grjasnowas temporeichem Erzählton wummert es, aber vor allem hallt in diesem Roman ein Echo wider, das an verdrängte Vergangenheit, vergessen geglaubte Schicksale und an die Verfolgung von Juden in der Sowjetunion erinnert. Katrin Krämer, WDR Lesestoff, 17. 09. 24
Ein drängender Roman über verlorene Herkunftsstrukturen und spuren. Keine kann so zärtlich und kompromisslos über diese Heimat- und Wurzellosen schreiben wir Olga Grjasnowa. Elke Schlinsog, Deutschlandfunk Kultur, 20. 09. 24
Für die familiäre Vergangenheit und die private Gegenwart hält Juli, August, September zwei sehr unterschiedliche Enden parat, die keine Auflösungen bieten, sondern Ansätze zum Weiterdenken. Wolfgang Huber-Lang, Agenturmeldung APA, 17. 09. 24
Juli, August, September ist ein nachdenkliches, gewitztes Buch über moderne jüdische Lebenswege und über Juden in Deutschland. Es ist aber auch ein hartes, unsentimentales Buch über Ehe, Familie und Partnerschaft im 21. Jahrhundert, dessen Protagonistin eben wie selbstverständlich eine Berliner Jüdin mit bewegter Biografie ist. Ein unerbittlich ehrliches, oft komisches Buch ist das. Und doch: bewegend. Ein Ereignis. Uli Hufen, WDR 5, Bücher, 20. 09. 24
Grjasnowas Roman zeigt jüdische Perspektiven jenseits von Parolen, in all ihrer alltäglichen Vieldeutigkeit und Fragilität. Caspar Battegay, NZZ am Sonntag, Beilage Bücher am Sonntag, 29. 09. 24
Meisterhaft baut Grjasnowa Situationen auf, um sie kurz darauf mit wenigen Worten zu konterkarieren. Die Dialoge sind witzig, die Szenen am Punkt, kein Wort ist zu viel, keine Situation hängt durch. Michael Wurmitzer, Der Standard, 04. 10. 2024
Die Stärke des Textes liegt in den vielen kleinen, humoristischen Beobachtungen der Protagonistin. Yelizaveta Landenberger, FAZ, 10. 10. 24
»Grjasnowa spielt auf unterhaltsame Art mit dem wohligen Grusel der Leser. « Marlen Hobrack, Welt am Sonntag, 13. 10. 24
»Der Roman ist unterhaltend, zynisch-humorvoll: er spielt geschickt mit dem, was in einer Familie unausgesprochen bleibt. « Florian Kappelsberger, Spiegel Online, 20. 10. 24
»Keine Frage, Klugheit, Witz und Aktualität dieses Romans machen ihn unterm Strich zu einem weiteren lesenswerten Beispiel der aufregenden deutschsprachigen Hybridliteratur dieser Autorin. « Oliver Pfohlmann, Tagesspiegel, 16. 10. 24
»Olga Grjasnowa schafft es einmal mehr, gekonnt das Leben nachzuzeichnen, wie es vermutlich einfach ist: nicht besonders erkenntnisreich. Angereichert mit Sprachwitz und viel Tempo hat das Buch im Vergleich zur sonstigen Gegenwartsliteratur ungewohnt viel Unterhaltungswert. Ein jüdisches Buch durch und durch. « Nicole Dreyfus, Jüdische Allgemeine, 16. 10. 24
»Der Roman reiht sich nun also ein ins Genre einer (autofiktionalen) Postmemory-Literatur. Zugleich, und das ist typisch für Grjasnowa, ironisiert der Roman die Identitätssuche der Protagonistin durch jenen pointierten Sarkasmus, den man auch schon aus ihrem Erstling kennt. « Jan Süselbeck, taz. die tageszeitung, 04. 11. 24
»Sprachlich präzise arbeitet Olga Grjasnowa in ihrem Roman heraus, wie sich Jüdinnen und Juden dem Druck ausgesetzt sehen, sich zu ihren Wurzeln zu verhalten. « Felix Münger, SRF Radio, Echo der Zeit, 27. 10. 24
»Olga Grjasnowa zeichnet Lous Konflikte in einer nüchternen, schnörkellosen Sprache nach, die das prägnante Abbild der Lebenssituation Lous ist Grjasnowa erzählt Lous Katharsis, bei aller Schwere des Themas, mit beeindruckender Leichtigkeit und Klarheit. « Marlen Hobrack, Welt online, 08. 11. 2024
»Juli, August, September« erinnert an eine frühe Komödie von Woody Allen, ist vergnüglich, ernst und nah am Leben, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. « Thomas Hummitzsch, Intellectures. de, 22. 11. 24
»Olga Grjasnowa ist eine der vielversprechendsten Autor:innen ihrer Generation« Thomas Hummitzsch, Intellectures. de, 22. 11. 24
»Das Tragische und das Komische stehen so dicht beieinander, dass man hin- und hergerissen wird, mal innehält, mal lacht und nicht aufhören kann weiterzulesen. « Christoph Amend, Die ZEIT, 30. 11. 24
»Da überzeugt der lakonische Grjasnowa-Ton, da sorgen knappe Sätze und pointierte Dialoge für einen flotten Erzählrhythmus, und kleine, genaue Alltagsbeobachtungen und komische Szenen bereichern die Geschichte. « Wolfgang Seibel, ORF, Ex Libris, 01. 12. 24
»Mit großer Leichtigkeit trägt Olga Grjasnowas unsentimentale Erzählweise durch den Roman. . Die Autorin schafft auch mit Juli, August, September eine feine (jüdische) Familienerzählung, an deren Ende dann doch eine Erkenntnis steht, auch wenn sie es nicht so pathetisch formuliert: Niemand hat die Deutungshoheit über die Geschichte der anderen. « Christiane Lutz, Süddeutsche Zeitung, 28. 12. 24