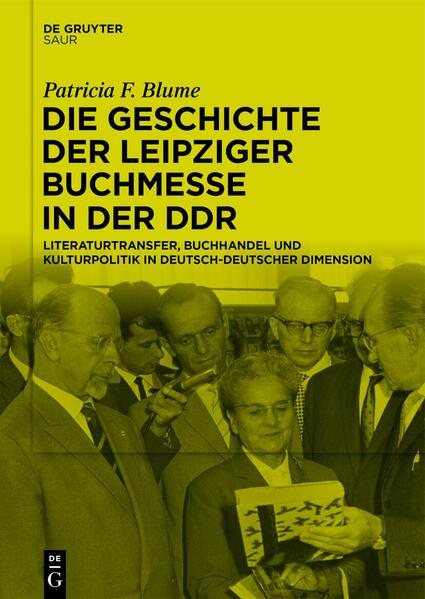
Zustellung: Fr, 16.05. - Mo, 19.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Studie fächert erstmals die Entwicklung der Leipziger Buchmesse von 1945 bis 1990 auf.
Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die Messe ihre Rolle im planwirtschaftlichen Literaturbetrieb. Die DDR nutzte sie als Leistungsschau, um Bücher und Kultur vor internationaler Kulisse in Szene zu setzen. Dabei diente das Frankfurter Pendant als Maßstab. Für die Lesenden in der Diktatur bot die Messe einzigartigen Zugang zu westlichen Medieninhalten und war Ort des legendären Messeklaus. Dieser Offenheit begegneten die Beteiligten mit Zensur und Überwachung durch die Staatssicherheit.
Durch die Messe wurde Leipzig zu einem Knotenpunkt des deutsch-deutschen Kulturaustauschs. Die Verlage der Bundesrepublik suchten den Kontakt und wirkten als Schrittmacher des innerdeutschen Literaturtransfers. Mit Blick auf die konfliktreiche Beziehung beider Börsenvereine leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Entspannung zwischen Ost und West.
Auf einer breiten Quellenbasis rekonstruiert Patricia F. Blume die Entstehung der Leipziger Buchmesse, ihre Funktionen und ihren Wandel. Dabei verbindet sie Buchhandelsgeschichte mit Wirtschafts-, Alltags-, Kultur- und Rezeptionsgeschichte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die Messe ihre Rolle im planwirtschaftlichen Literaturbetrieb. Die DDR nutzte sie als Leistungsschau, um Bücher und Kultur vor internationaler Kulisse in Szene zu setzen. Dabei diente das Frankfurter Pendant als Maßstab. Für die Lesenden in der Diktatur bot die Messe einzigartigen Zugang zu westlichen Medieninhalten und war Ort des legendären Messeklaus. Dieser Offenheit begegneten die Beteiligten mit Zensur und Überwachung durch die Staatssicherheit.
Durch die Messe wurde Leipzig zu einem Knotenpunkt des deutsch-deutschen Kulturaustauschs. Die Verlage der Bundesrepublik suchten den Kontakt und wirkten als Schrittmacher des innerdeutschen Literaturtransfers. Mit Blick auf die konfliktreiche Beziehung beider Börsenvereine leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Entspannung zwischen Ost und West.
Auf einer breiten Quellenbasis rekonstruiert Patricia F. Blume die Entstehung der Leipziger Buchmesse, ihre Funktionen und ihren Wandel. Dabei verbindet sie Buchhandelsgeschichte mit Wirtschafts-, Alltags-, Kultur- und Rezeptionsgeschichte.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
04. März 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
VIII
Autor/Autorin
Patricia F. Blume
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
130 b/w illustrations, 23 b/w tbl., 21 b/w graphics
Gewicht
1418 g
Größe (L/B/H)
241/182/48 mm
ISBN
9783111315966
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Nicht nur weil die Geschichte der Leipziger Buchmesse in der DDR historisch abgeschlossen ist, liegt hier ein unüberholbares Buch vor. Der Rezensent weiß nicht, woran er Kritik üben sollte." Günther Fetzer in: https://literaturkritik. de/fetzer-blume-geschichte-der-leipziger-buchmesse, 30557. html (24. 05. 2024)
"Alles in allem steht der buchwissenschaftlichen Fachwelt nunmehr ein höchst informatives, quellengesättigtes Grundlagenwerk zur Verfügung, das in seiner Breite und Tiefe kaum zu übertreffen ist und reichlich Anknüpfungsmaterial für künftige Forschungen bietet." Christoph Links in: Archiv für Geschichte des Buchwesens
"Blumes umfangreiches, faktengesättigtes und mit statistiken, Grafiken und zeitgenössischen Fotografien üppig ausgestattetes Buch ist ein Grundlagenwerk,
dessen Lektüre jedem an der deutschen Nachkriegs- und Buchgeschichte interessierten zu empfehlen ist." Mark Lehmstedt in: FAZ 25. 05. 2025
 Besprechung vom 25.03.2025
Besprechung vom 25.03.2025
Ein Gefühl der Freiheit im Gedränge zwischen winzigen Ständen
Patricia F. Blume legt eine exzellent recherchierte und aufgemachte Geschichte der Leipziger Buchmesse in der DDR vor.
Im Herbst 1965 präsentierte sich der Suhrkamp Verlag aus Frankfurt am Main zum ersten Mal auf der Leipziger Buchmesse. Von den um internationale Anerkennung bemühten Messeverantwortlichen wurde dies als großer kulturpolitischer Erfolg verbucht, das Leipziger Publikum reagierte mit Begeisterung, und die bundesdeutschen Medien brachten ausführliche Berichte. Walter Boehlich, der als Suhrkamp-Lektor die treibende Kraft hinter dem Messeauftritt gewesen war, kritisierte in der "Süddeutschen Zeitung" sogar die Abwesenheit anderer belletristischer Verlage aus der Bundesrepublik: "Sie scheinen nichts davon zu halten, ein Publikum zu informieren, das erstaunlich wissbegierig ist, oder auf einem Markt präsent zu sein, der vorläufig, jedenfalls direkt, nicht erschlossen werden kann." In der Tat bot die Messe Gelegenheiten zur Marktbeobachtung, zur Pflege von Kontakten mit Autoren und Lesern, zum Abschluss von Lizenzgeschäften, nicht zuletzt auch zum (freilich staatlich kontingentierten) Verkauf von Büchern.
Was Boehlich nicht ahnte: Nach dem Ende der Messe ließ Lucie Pflug, die allgewaltige Leiterin des Sektors Verlage beim ZK der SED, die gesamte in Leipzig ausgestellte Suhrkamp-Kollektion zu sich nach Berlin kommen. Kurt Hager, der Chefideologe der Partei, suchte sich Titel von Walter Benjamin, Hans Magnus Enzensberger und Peter Weiss sowie "Die Suche nach der verlorenen Zeit" heraus; an die Abteilung Kultur gingen Bücher von Adorno, Joyce und Beckett; die Abteilung Wissenschaften reservierte sich "Homo Faber". Man wagt kaum sich vorzustellen, wie die "Hüter der reinen Lehre" den Herbst 1965 damit verbracht haben, sich in absurdes Theater und kritische Theorie einzulesen oder sich gar dem Bewusstseinsstrom hinzugeben.
Zauberhafte Fundstücke wie dieses finden sich immer wieder eingestreut in die umfangreiche "Geschichte der Leipziger Buchmesse in der DDR" von Patricia F. Blume, die zahllose weitverstreut überlieferte Aktenbestände, Interviews mit einstigen Akteuren und nicht zuletzt zeitgenössische Presseartikel zu einer souveränen Darstellung zusammenfügt und damit den Mythos, der im Laufe der Jahrzehnte immer größer geworden ist, auf einen realistischen Kern zurückführt. Nüchtern und gestützt auf ein umfangreiches Zahlenmaterial, berichtet sie vom Widerstreit zwischen Tradition und Gegenwart, zwischen Politik und Ökonomie, zwischen Binnen- und Außenwirtschaft, auch zwischen Mut und Verzagen.
Am Anfang stand eine Fehlentscheidung. Zwar wurden in Leipzig seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts auch gedruckte Bücher auf den Messen gehandelt und bildete Leipzig seit dem achtzehnten Jahrhundert den Mittelpunkt des mitteleuropäischen Buchhandels, doch hat es nie eine "Buchmesse" im Wortsinne gegeben. Vielmehr gehörten Druckschriften zum allgemeinen Warenangebot der Messen, und als 1895 in Leipzig das Konzept der Mustermesse erfunden wurde, spielten Bücher sogar nur noch eine geringe Rolle. Am Konzept der weltweit renommierten Leipziger Universalmesse hielt man auch fest, als sie 1946 ihren Betrieb wieder aufnahm.
Deutsch-deutsche Veranstaltung
Selbst als sich überall sonst Fachmessen etablierten, konnte man sich in der DDR nur mit großer Mühe dazu durchringen, der Präsentation der Verlage wenigstens eine relative Selbständigkeit (mit eigenem Messehaus am Markt, eigener Eröffnung und speziellen Veranstaltungen wie den Ausstellungen der Schönsten Bücher) zuzugestehen. Das Korsett des politisch und ökonomisch ganz andere Ziele verfolgenden Leipziger Messeamts und der ihm übergeordneten staatlichen und Parteigremien machte es von vornherein unmöglich, in ernsthafte Konkurrenz zur Buchmesse in Frankfurt am Main (seit 1949), aber auch zu der in Warschau (seit 1956) zu treten, die von vornherein als Fachmessen konzipiert waren und die Leipziger Bücherschau schon sehr bald in den Schatten stellten.
Minutiös rekonstruiert Blume die ständigen Auf- und Abwärtsbewegungen, die sich im Spiel der Kräfte zwischen binnen- und außenökonomischen Interessen und Zwängen untereinander sowie in Relation zu den jeweiligen innen- und außenpolitischen Vorgaben und Restriktionen entfalteten. Jedes der politischen Großereignisse - von Ungarn 1956 über den Mauerbau 1961 bis zur Biermann-Ausbürgerung 1976 - hinterließ mehr oder minder deutliche Spuren im folgenden Messegeschehen. Hinzu kamen branchenpolitische Querelen wie die lange Jahre währende Boykotthaltung des Frankfurter Börsenvereins, in dessen Gremien sich aus der DDR vertriebene und enteignete Altverleger jüngeren Kollegen gegenübersahen, die auf "Wandel durch Annäherung" setzten oder schlichtweg gute Geschäfte machen wollten, wobei gelegentlich der Phantasie die Zügel durchgingen, wenn etwa Bertelsmann auf der Leipziger Messe ernsthaft über die Gründung eines Leserings in der DDR mit entsprechend angepasstem Bücherangebot verhandeln wollte.
Obgleich die DDR immer großen Wert auf Internationalität legte, handelte es sich, wie Blume überzeugend herausarbeitet, de facto um eine deutsch-deutsche Veranstaltung. Die Idee, wenigstens die Verlage und Großbuchhändler der sozialistischen "Bruderländer" dazu zu bringen, ihre internationalen Geschäfte in Leipzig abzuwickeln, erwies sich schnell als Chimäre. Dafür nutzten beide deutsche Seiten Leipzig als Ort für den wechselseitigen Ein- und Verkauf von Büchern; außerdem nutzten natürlich die Buchhandlungen der DDR Leipzig als Ort für ihre Bestellungen bei DDR-Verlagen. Allerdings wurde die wirtschaftliche Bedeutung der Messe von Jahr zu Jahr immer mehr überlagert von ihrer Funktion als Publikumsmesse - ohne dass man hätte ahnen können, dass es genau diese Funktion sein sollte, die in den Neunzigerjahren das Überleben der Leipziger Buchmesse sichern würde, und zwar einschließlich des ebenfalls auf die DDR-Zeit zurückgehenden Konzepts einer Verbindung der Messe mit Autorenlesungen.
Prospekte für den "Tantenimport"
Dass das Buch eine besondere Ware ist, wurde selten so sichtbar wie in den Tagen der Leipziger Messen. Für das Publikum waren sie nichts weniger als ein "Lichtpunkt im grauen DDR-Alltag", ein "Fenster in die Welt", hier erfuhr man ein Gefühl von Freiheit wie sonst kaum einmal. Dafür reisten Menschen, vom Oberschüler bis zum Rentner, aus dem ganzen Land an die Pleiße, ertrugen "fürchterliche Enge, winzige Stände, irres Gedränge" und ließen sich auch von der stickigen und überheizten Luft nicht abschrecken. Jeder, der dabei gewesen ist, kann noch nach Jahrzehnten davon erzählen - dem Mythos "Leipziger Buchmesse" liegen reale Erfahrungen zugrunde.
Allerdings trat zum Gefühl der Freiheit unvermeidlich auch das der Frustration. Selbst begehrte Bücher aus DDR-Verlagen, die man hier sah, konnte man angesichts der Mangelwirtschaft nicht ohne Weiteres kaufen, und Bücher aus dem Ausland blieben fast immer unzugänglich. Gegenstrategien minderten das Problem, lösten es aber nicht. Auch wenn mancher Bericht märchenhaft anmutet wie der vom Mantel des Malers Günter Glombitza, in dessen eingenähten Innentaschen er gestohlene Bücher habe verschwinden lassen, war die "Bibliokleptomanie" tatsächlich eine verbreitete, von manchen Westverlagen großzügig tolerierte Erscheinung. Fälle, dass man komplette Bücher am Messestand las oder abschrieb, dürften Ausnahmen gewesen sein, ganz im Gegensatz zu dem durch die Messe mit einer großzügigen Verteilung von Prospekten ausgelösten "Tantenimport". Von diesen Bücherlieferungen durch im Westen lebende oder in den Westen reisende Verwandte hat der westdeutschen Buchhandel zweifellos erheblich profitiert.
Blumes umfangreiches, faktengesättigtes und mit Statistiken, Grafiken und zeitgenössischen Fotografien üppig ausgestattetes Buch ist ein Grundlagenwerk, dessen Lektüre jedem an der deutschen Nachkriegs- und Buchgeschichte Interessierten zu empfehlen ist. Leider hat sich die Autorin entschieden, ihren Text auf brutalstmögliche Weise durchzugendern, sodass der Leser nicht weiß, wohin vor lauter Doppelpunkten und Partizipialkonstruktionen, und den Text erst einmal in eine lesbare Fassung übersetzen muss. MARK LEHMSTEDT
Patricia F. Blume: "Die Geschichte der Leipziger Buchmesse in der DDR". Literaturtransfer, Buchhandel und Kulturpolitik in deutsch-deutscher Dimension.
De Gruyter Verlag, Berlin 2024. 780 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Geschichte der Leipziger Buchmesse in der DDR" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









