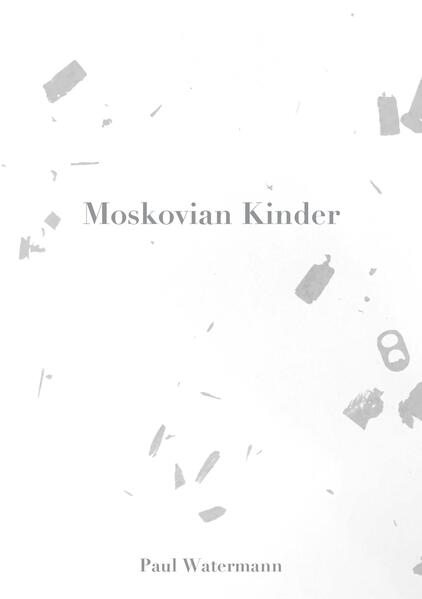Besprechung vom 15.10.2024
Besprechung vom 15.10.2024
Ein Flamingobein und ein brennendes Schwein
Aus der surrealistischen Trickkiste: Paul Watermanns formbewusstes Prosaexperiment "Moskovian Kinder"
Paul Watermanns Erzählung-Schrägstrich-Prosalanggedicht-Schrägstrich-Roman wirkt bei der ersten Lektüre, als würde es von einer Stimme erzählt, der die sogenannten Regeln von Literatur fremd sind. Das ist befreiend, weil das Buch damit keine dieser sogenannten Regeln befolgen muss, die in einer immer homogener wirkenden Literaturlandschaft Hoheitswert zu besitzen scheint.
Ich bin mir auch nach mehrfacher Lektüre nicht sicher, ob mir "Moskovian Kinder" gefällt oder nicht, aber seltsamerweise ist mir das hier nicht so wichtig. Denn der 1986 in Melle geborene Autor, der am Literaturinstitut Leipzig studierte, versucht mit diesem Debüt etwas anderes als die meisten Schreibenden seiner Generation. Das ist zwar nicht unbedingt revolutionär, da er tief in der surrealistischen Trickkiste aus Collage und Mosaik und der damit verbundenen Kollision von Zusammenhanglosem kramt. Doch man kann dem Autor nicht vorwerfen, es mangle ihm an ästhetischem Mut und sprachlicher Beherztheit.
Was das Buch mit den Leben der im Titel angedeuteten Kinder aus Moskau macht, ist vielleicht nicht mit Begriffen wie "Handlung" oder "Erzählen" zu greifen. Es werden eher schlaglichtartig Szenen, Bilder, Momente collagiert, Zeitebenen überlagert und nostalgische Gedanken sowie lyrisches Material miteinander verwirbelt. Wer die "moskowitischen Kinder" sind, bleibt rätselhaft. Sind sie Eingewanderte, da die Rede ist von "der alten Sprache"? Sind sie ein bisschen Punk, weil ihr Dasein als "Underground-Lebensentwurf" beschrieben wird? Oder sind sie einfach verlorene Seelen, wie alle Kinder und Jugendlichen? Sie driften durch ländliche Gegenden, Stadtparks, Bars, Klubs und Volksfest-Settings, wo sie "neben einem brennenden Schwein" stehen, doch am meisten bewegen sie sich in Gedanken an gestern: "Das Private ist Vergangenheit, die Vergangenheit ist das einzige Private und das Private der wunde Punkt."
In einer Textur aus mitunter diffus wirkenden Bildern und einer dichten Sprache schälen sich mit der Zeit einige Figuren heraus. Da ist vor allem Leon, der neben der nicht unabsichtlich ähnlich benannten Leonie einen Teil des Hauptfigurenpaars bildet. Immer wieder arbeitet der Autor mit Assonanzen, Gleichklängen, reinen und unreinen Reimstrukturen sowie Binnenreimen: "Sie wollte Brüder in den tiefen Tönen und Schwestern im Zusammenhalt, damit da was zusammenknallt, wo vorher nichts gewesen ist." Hier wie überall wird eines der Hauptmotive, die tiefe Sehnsucht nach einem Miteinander, mit dem Stilmittel der Collage zusammengeklebt.
Die Form war für die Avantgarde immer wichtiger als der Inhalt, oder besser, sie war der Inhalt, und so sickert auch bei Watermann die Oberflächenform ins Substrat der Handlung ein. Die namentliche Nähe von Leon und Leonie deutet andere Ähnlichkeiten an: Leon leidet an einer Gehbehinderung, Leonie hat eine Beinprothese. Die anderen Kinder - wie in meiner Schulzeit sind sie natürlich auf Respekt und Nächstenliebe aus -, sie nennen Leonie aufgrund ihrer Amputation "Flamingobein".
Weitere Figuren werden umrissen, bekommen Namen, schimmern aber nur wie Gespenster an den Erzählrändern auf, bevor sie sich wieder in Luft aufzulösen scheinen. Überhaupt wirkt die gesamte Existenz in diesem Buch wie ein kurzes Lebensflackern, wie ein verblassendes Foto, aus dem Einsamkeit und Angst sprechen, wobei der Autor beinahe nebenbei die Eskapismen der Gegenwart anreißt: "Nicht die Angst betäubt dich, sondern du betäubst die Angst. Mit Internet."
Die Sprache, die Bilder, aber vor allem die Figuren sind atomisiert, versprengt und getrennt. Dass sie niemals wirklich miteinander in Kontakt treten können, nie wahre Zugehörigkeit oder gar innige Liebe erfahren, wird in der Verweigerung von Psychologisierung wiederholt und unterstrichen. Alle bleiben einander - und auch den Lesenden - fremd.
Durch Vertiefung der Figuren mithilfe von "back storys", durch Auswalzung ihrer Herkunft und Offenlegung ihrer Wurzeln, macht uns der realistische Roman glauben, dass Menschen ergründbar sind. Es ist eines seiner Kernattribute und wurde lang genug von Moderne und Postmoderne infrage gestellt. Umso willkommener ist es, heute ein Buch zu lesen, das die entblößende Psychologisierung der Figuren radikal ablehnt, lieber neugierig ihre Oberflächen erkundet und sich wundert über die febrile Merkwürdigkeit der Welt.
Am schönsten gelingt dies, wenn diese Welt buchstäblich auf den Kopf gestellt wird und eine Kirche "umgedreht am Abendhimmel" über dem Dorf und dem "Tannenwald" hängt. Das Bild und dieser magische Moment werden mit Bedeutung gesättigt, aber nicht mit Interpretation ausgeweidet. Was der Text auf der Mikroebene der Sprache mit Gleichklang, Reim und Inversionen macht, wird auf der Makroebene durch Motive von Echos und Spiegelungen aufgenommen. Die Welt dieses Buches ist ungeheuer merkwürdig, und doch, nein, denn: Es ist unsere Welt.
Es verwundert mich, wie wenig Underground, Punk, Avantgarde oder gar "outsider art" in der heutigen Literatur zu finden ist. Die Kategorie "outsider literature" gibt es nicht. Während in der Musik die "outsider music" und in der Malerei die "naive Kunst" von sogenannten Außenseitern zu Recht als erneuernd und bereichernd gefeiert wird (auch weil sie sich kapitalistisch als Exotismus ausschlachten lässt), existieren nur sehr wenige Schreibende, die etwas wie Paul Watermann versuchen, und es gibt auch kaum Verlage, die dafür Raum bieten. Umso schöner, dass der kleine Berliner Gans Verlag das ändern möchte. JAN WILM
Paul Watermann:
"Moskovian Kinder".
Gans Verlag, Berlin 2024. 150 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.