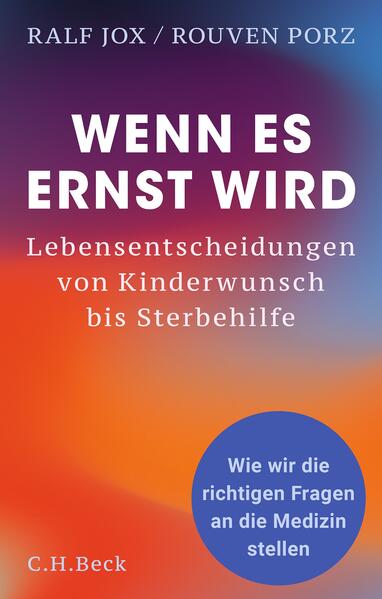
Zustellung: Di, 13.05. - Do, 15.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Das Richtige tun, wenn es um Leben und Tod geht
Irgendwann kommen wir alle in eine Situation, in der wir schwierige Entscheidungen über unsere eigene Gesundheit, die von Angehörigen oder Freunden treffen müssen. Wir müssen dann die richtigen Fragen stellen und Verantwortung übernehmen - ob es sich um den Schlaganfall der Mutter, eine künstliche Befruchtung, den Wunsch eines Kindes nach geschlechtlicher Veränderung, um Organspende oder das Lebensende handelt. Die beiden Medizinethiker Ralf Jox (rechts) und Rouven Porz geben unverzichtbare Orientierung in einem komplizierten Bereich, der viele Menschen zunehmend überfordert.
Die Medizin heutiger Tage kann unheimlich viel. Sie kann Menschen retten, die früher gestorben wären. Sie kann Pandemien bekämpfen und mit Künstlicher Intelligenz Krankheiten aufspüren, für die es noch nicht einmal Namen gibt. Sie kann uns das Sterben erleichtern und sogar nach dem Tod noch allerhand mit unseren Körpern anfangen. Aber wollen wir das alles? Und vor allem: Sollen wir all das tun, was wir tun könnten? Dies sind nicht nur gesellschaftliche Fragen. Jede und jeder von uns ist ganz persönlich davon betroffen. Mehrfach im Leben müssen wir schwierige gesundheitliche Entscheidungen treffen - über uns selbst, über unsere Angehörigen. Zuweilen geht es gar um Leben und Tod. Spätestens dann fragen wir uns: Wie kann ich mich bei diesen verwirrenden Fragen orientieren? Und wie kann ich selbst die richtigen Fragen stellen - an die Ärzte und Pflegenden, im Austausch mit dem Partner und mit Angehörigen, an mich selbst? Mit welcher Entscheidung werde ich später leben können? Wer kann mich bei solchen Lebensentscheidungen unterstützen? Wie kann ich Klarheit gewinnen? Genau hier setzt dieses Buch an. Es will Ihnen als Leserinnen und Lesern helfen, über diese Fragen nachzudenken, sie zu formulieren und für sich selbst Orientierung zu finden.
Aus dem Inhalt: Eine schwierige Geburt - Die Sorge der Sorgeberechtigten - Von Identitäten und Irritationen - Wenn der Geist verrücktspielt - Die tausend Gesichter des Alters - Wenn der Vorhang fällt - Nach dem Tod geht es weiter
Irgendwann kommen wir alle in eine Situation, in der wir schwierige Entscheidungen über unsere eigene Gesundheit, die von Angehörigen oder Freunden treffen müssen. Wir müssen dann die richtigen Fragen stellen und Verantwortung übernehmen - ob es sich um den Schlaganfall der Mutter, eine künstliche Befruchtung, den Wunsch eines Kindes nach geschlechtlicher Veränderung, um Organspende oder das Lebensende handelt. Die beiden Medizinethiker Ralf Jox (rechts) und Rouven Porz geben unverzichtbare Orientierung in einem komplizierten Bereich, der viele Menschen zunehmend überfordert.
Die Medizin heutiger Tage kann unheimlich viel. Sie kann Menschen retten, die früher gestorben wären. Sie kann Pandemien bekämpfen und mit Künstlicher Intelligenz Krankheiten aufspüren, für die es noch nicht einmal Namen gibt. Sie kann uns das Sterben erleichtern und sogar nach dem Tod noch allerhand mit unseren Körpern anfangen. Aber wollen wir das alles? Und vor allem: Sollen wir all das tun, was wir tun könnten? Dies sind nicht nur gesellschaftliche Fragen. Jede und jeder von uns ist ganz persönlich davon betroffen. Mehrfach im Leben müssen wir schwierige gesundheitliche Entscheidungen treffen - über uns selbst, über unsere Angehörigen. Zuweilen geht es gar um Leben und Tod. Spätestens dann fragen wir uns: Wie kann ich mich bei diesen verwirrenden Fragen orientieren? Und wie kann ich selbst die richtigen Fragen stellen - an die Ärzte und Pflegenden, im Austausch mit dem Partner und mit Angehörigen, an mich selbst? Mit welcher Entscheidung werde ich später leben können? Wer kann mich bei solchen Lebensentscheidungen unterstützen? Wie kann ich Klarheit gewinnen? Genau hier setzt dieses Buch an. Es will Ihnen als Leserinnen und Lesern helfen, über diese Fragen nachzudenken, sie zu formulieren und für sich selbst Orientierung zu finden.
Aus dem Inhalt: Eine schwierige Geburt - Die Sorge der Sorgeberechtigten - Von Identitäten und Irritationen - Wenn der Geist verrücktspielt - Die tausend Gesichter des Alters - Wenn der Vorhang fällt - Nach dem Tod geht es weiter
- "Ein Weckruf. Diese Fragen von Leben und Tod betreffen uns alle irgendwann. Brillant." Rolf Dobelli, Autor des Weltbestsellers "Die Kunst des klaren Denkens"
- Wie stelle ich als mündiger Patient die richtigen Fragen?
- Nach welchen Kriterien sollen wir handeln, wenn es um Leben und Tod geht?
- Die beiden Medizinethiker geben ein Instrumentarium für eigenverantwortliche Entscheidungen an die Hand
- Eine Ermutigung, als Patient mehr Verantwortung zu übernehmen
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Selbst entscheiden wieso wir alle herausgefordert sind
Wie wir die Medizin sehen Wieso braucht es in der Medizin Ethik? Ärztlicher Paternalismus ist passé Selbst bestimmen ist gefragt Moralismus als Holzweg Unbehagen, Problem, Dilemma Wie wir als klinische Ethiker arbeiten Zusammenfassung
2. Jenseits von Sex Zeugung und mehr Die Ära der Retortenbabys Recht auf ein Kind? Das Wunschkind Dr. Mendel 3. 0 Letzter Ausweg Fetozid? Ausgewählt oder aussortiert? Embryo: Zellhaufen oder Mensch? Zusammenfassung
3. Eine schwierige Geburt
Geburt und Sterblichkeit Zwischen Natürlichkeit und Medikalisierung Gebären heute und morgen Ungewissheiten bei Neugeborenen und Säuglingen Größte Sorgen um die Kleinsten Wie Eltern ihre Kinder vertreten Zusammenfassung
4. Die Sorgen der Sorgeberechtigten
Wo endet elterliches Ermessen? Wenn Kinder allmählich mitentscheiden können Was heißt eigentlich einwilligungsfähig? Sich entwickeln heißt sich verletzlich machen Unsere Kinder in der Welt der neuen Technologien Wenn die Sorgeberechtigten selbst zur Sorge werden Zusammenfassung
5. Von Identitäten und Irritationen
Was bin ich und wer bin ich? Identitätssuche und Körper Identitätssuche und Familienplanung Familienplanung andersherum: Verhütung und Sterilisierung Identität und ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit Zusammenfassung
6. Wenn der Geist verrücktspielt
Das 21. Jahrhundert, die Epoche der psychischen Krankheiten? Psychische Krankheiten: eine Einbahnstraße? Wer ist hier eigentlich gestört: Das Individuum oder die Gesellschaft? Psychiatrie ohne Zwangsjacke? Psychisch Kranke: Nur selten Täter, oft Opfer Auch in der Psychiatrie gibt es Patientenverfügungen Palliative Psychiatrie Zusammenfassung
7. Wer hat Angst vor künstlicher Intelligenz?
Auch die Medizin will künstlich intelligent sein Kann sich ein Computer entschuldigen? Bloß ein Werkzeug oder ein echtes Gegenüber? Existenzielle Tiefendimensionen Und wenn die Ethik selbst künstlich intelligent wird? Zusammenfassung
8. Corona und mehr was heißt eigentlich gerecht?
Ein neues Zeitalter Neue Wörter braucht das Land Wer nennt mich vulnerabel? Haarige Haustiere und nackte Ehemänner Ideale der Gerechtigkeit Wir haben nicht genug für alle Zusammenfassung
9. Die tausend Gesichter des Alters
Was heißt heute schon Alter? Den alten Menschen eine Stimme geben Vulnerable Menschen in der Leistungsmedizin Einen alten Baum verpflanzt man nicht, oder? Die schöne neue Welt der Gerontotechnologie Vielfalt in der Gemeinschaftseinrichtung: Ein Dilemma? Das Schwerste: den mutmaßlichen Willen ergründen Zusammenfassung
10. Wenn der Vorhang fällt
Geräte abschalten, auch auf der Intensivstation? Des Guten zu viel? Übertherapie am Lebensende Unser Leitfaden für ethische Gespräche Das Ende selbst in die Hand nehmen Schlafen legen, bis Schlafes Bruder kommt? Sterbefasten eine sanftere Form des Suizids? Zusammenfassung
11. Nach dem Tod geht es weiter
Ein gutes Herz Organe verteilen Zustimmen oder widersprechen? Die eigene Identität erzählen Von Soldaten und Spermien Unsterbliche Zellen Überleben uns die digitalen Zwillinge? Zusammenfassung
12. Ethikkompetenz für die Medizin von morgen
Medizin von morgen? Jedenfalls anders Klinische Ethik, ein Beruf mit Zukunft Gute Entscheidungen treffen Eigene Werte bedenken Nicht zu schnell urteilen Eigene Vorurteile erkennen Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Verzeichnis der Fallbeispiele
Verzeichnis der Info-Boxen
1. Selbst entscheiden wieso wir alle herausgefordert sind
Wie wir die Medizin sehen Wieso braucht es in der Medizin Ethik? Ärztlicher Paternalismus ist passé Selbst bestimmen ist gefragt Moralismus als Holzweg Unbehagen, Problem, Dilemma Wie wir als klinische Ethiker arbeiten Zusammenfassung
2. Jenseits von Sex Zeugung und mehr Die Ära der Retortenbabys Recht auf ein Kind? Das Wunschkind Dr. Mendel 3. 0 Letzter Ausweg Fetozid? Ausgewählt oder aussortiert? Embryo: Zellhaufen oder Mensch? Zusammenfassung
3. Eine schwierige Geburt
Geburt und Sterblichkeit Zwischen Natürlichkeit und Medikalisierung Gebären heute und morgen Ungewissheiten bei Neugeborenen und Säuglingen Größte Sorgen um die Kleinsten Wie Eltern ihre Kinder vertreten Zusammenfassung
4. Die Sorgen der Sorgeberechtigten
Wo endet elterliches Ermessen? Wenn Kinder allmählich mitentscheiden können Was heißt eigentlich einwilligungsfähig? Sich entwickeln heißt sich verletzlich machen Unsere Kinder in der Welt der neuen Technologien Wenn die Sorgeberechtigten selbst zur Sorge werden Zusammenfassung
5. Von Identitäten und Irritationen
Was bin ich und wer bin ich? Identitätssuche und Körper Identitätssuche und Familienplanung Familienplanung andersherum: Verhütung und Sterilisierung Identität und ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit Zusammenfassung
6. Wenn der Geist verrücktspielt
Das 21. Jahrhundert, die Epoche der psychischen Krankheiten? Psychische Krankheiten: eine Einbahnstraße? Wer ist hier eigentlich gestört: Das Individuum oder die Gesellschaft? Psychiatrie ohne Zwangsjacke? Psychisch Kranke: Nur selten Täter, oft Opfer Auch in der Psychiatrie gibt es Patientenverfügungen Palliative Psychiatrie Zusammenfassung
7. Wer hat Angst vor künstlicher Intelligenz?
Auch die Medizin will künstlich intelligent sein Kann sich ein Computer entschuldigen? Bloß ein Werkzeug oder ein echtes Gegenüber? Existenzielle Tiefendimensionen Und wenn die Ethik selbst künstlich intelligent wird? Zusammenfassung
8. Corona und mehr was heißt eigentlich gerecht?
Ein neues Zeitalter Neue Wörter braucht das Land Wer nennt mich vulnerabel? Haarige Haustiere und nackte Ehemänner Ideale der Gerechtigkeit Wir haben nicht genug für alle Zusammenfassung
9. Die tausend Gesichter des Alters
Was heißt heute schon Alter? Den alten Menschen eine Stimme geben Vulnerable Menschen in der Leistungsmedizin Einen alten Baum verpflanzt man nicht, oder? Die schöne neue Welt der Gerontotechnologie Vielfalt in der Gemeinschaftseinrichtung: Ein Dilemma? Das Schwerste: den mutmaßlichen Willen ergründen Zusammenfassung
10. Wenn der Vorhang fällt
Geräte abschalten, auch auf der Intensivstation? Des Guten zu viel? Übertherapie am Lebensende Unser Leitfaden für ethische Gespräche Das Ende selbst in die Hand nehmen Schlafen legen, bis Schlafes Bruder kommt? Sterbefasten eine sanftere Form des Suizids? Zusammenfassung
11. Nach dem Tod geht es weiter
Ein gutes Herz Organe verteilen Zustimmen oder widersprechen? Die eigene Identität erzählen Von Soldaten und Spermien Unsterbliche Zellen Überleben uns die digitalen Zwillinge? Zusammenfassung
12. Ethikkompetenz für die Medizin von morgen
Medizin von morgen? Jedenfalls anders Klinische Ethik, ein Beruf mit Zukunft Gute Entscheidungen treffen Eigene Werte bedenken Nicht zu schnell urteilen Eigene Vorurteile erkennen Zusammenfassung
Weiterführende Literatur
Verzeichnis der Fallbeispiele
Verzeichnis der Info-Boxen
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
238
Autor/Autorin
Ralf Jox, Rouven Porz
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
394 g
Größe (L/B/H)
219/146/25 mm
ISBN
9783406829970
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Das Buch möchte helfen, über wichtige Fragen nachzudenken, und orientiert sich dabei am Lauf des Lebens lesenswert!
Prisma
Kompetenter medizinischer Rat in den Grenzsituationen des Lebens.
buchtips. net, Nico Haase
In kritischen Momenten treffen wir Entscheidungen, die unser Leben oder das unserer Liebsten beeinflussen. Wie man sich solchen Situationen stellt, erklärt Ralf Jox.
STERN Plus, Katrin Schmiedekampf
Flott geschrieben, entfalten die Autoren ein Panorama schwieriger Entscheidungen im medizinischen Alltag. "
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stephan Sahm
Zugänglicher Ratgeber
Philosophie Magazin, Elisa Primavera-Levy
Prisma
Kompetenter medizinischer Rat in den Grenzsituationen des Lebens.
buchtips. net, Nico Haase
In kritischen Momenten treffen wir Entscheidungen, die unser Leben oder das unserer Liebsten beeinflussen. Wie man sich solchen Situationen stellt, erklärt Ralf Jox.
STERN Plus, Katrin Schmiedekampf
Flott geschrieben, entfalten die Autoren ein Panorama schwieriger Entscheidungen im medizinischen Alltag. "
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stephan Sahm
Zugänglicher Ratgeber
Philosophie Magazin, Elisa Primavera-Levy
 Besprechung vom 12.04.2025
Besprechung vom 12.04.2025
Alle Beteiligten hören
Ralf Jox und Rouven Porz führen klinische Ethik in Fallgeschichten vor
Wir alle können betroffen sein. Als Patienten oder Angehörige. Plötzlich geht es um Leben und Tod. Ein Anruf aus der Klinik, ein Angehöriger auf der Intensivstation. Die Ärzte möchten eine Entscheidung, wie weit man mit der Therapie gehen soll. Zur Vorbereitung auf solche Situationen gibt es kein Curriculum.
Ralf Jox und Rouven Porz führen die Berufsbezeichnung "Medizinethiker". Sie möchten mit ihrer Monographie die Leser vorbereiten: auf die Herausforderung, gesundheitliche Entscheidungen für sich oder Angehörige treffen zu müssen, "wenn es ernst wird". Flott geschrieben, entfalten die Autoren ein Panorama schwieriger Entscheidungen im medizinischen Alltag. Sie wollen keinesfalls nur belehren, sie möchten auch unterhalten. Entlang des Lebenslaufs, von der vorgeburtlichen Diagnostik bis zu den Grenzen der Medizin am Lebensende, präsentieren sie Fallgeschichten. Mutmaßlich soll sich der Reiz für die Leser der nämlichen Attraktion verdanken, auf die auch Arztserien im Fernsehen und in Streamingdiensten setzen.
Dabei illustrieren die Autoren das, was sie "klinische Ethik" nennen. Die Frage ihrer Kinder, was denn ein klinischer Ethiker mache, sei denn auch letzter Anstoß gewesen, die schon länger gehegte Idee zum Buch zu verwirklichen.
Wollte man den Titel des Buches als Hinweis lesen, hier werde philosophische Ethik am Beispiel medizinischer Praxis exemplifiziert, sieht man sich getäuscht. Klinische Ethiker, so das Selbstverständnis, halten sich mit ethischen Argumenten zurück. Sie moderieren nur. "Wir sind keine Schiedsrichter", betonen die Autoren. "Man kann uns einwechseln wie den Joker von der Bank, wenn man nicht weiterweiß." Klinische Ethik, so ihr Credo, steht für den transparenten Prozess der Entscheidungsfindung in schwierigen Fällen.
Wer also Argumente sucht mit Blick auf ethische Herausforderungen im Medizinbetrieb (Sterbehilfe, Suizidassistenz, vorgeburtliches genetisches Screening), wird sie nicht finden. Klinische Ethiker beanspruchen keine moralische Autorität. In einer Fülle lehrreicher Fallgeschichten wird exemplifiziert, wie die "Joker" dabei helfen, dass alle Beteiligten gehört werden, alle Perspektiven berücksichtigt werden, niemand übergangen wird. Ihre Rolle ist die von Kommunikationscoaches. Zumal es - nach Erfahrung der Autoren - in der auf den medizinischen Alltag angewandten klinischen Ethik selten um echte moralische Dilemmata geht. Sie sieht sich vielmehr meist mit tragischen Verläufen und Herausforderungen konfrontiert.
Sie sind der Stoff für die Fallberichte. Die Lektüre setzt keine eingehenden Kenntnisse der Medizin voraus, wie auch die Autoren an ihre Leserschaft keine höheren Ansprüche stellen. So sehen sie sich genötigt, bei der Erörterung von manchmal notwendigen Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie zu erläutern, dass in demokratischen Ländern das Gewaltmonopol allein der staatlichen Gewalt zukommt.
Die klinische Ethik zeigt sich im Stand moralischer Zurückhaltung. Und doch vermag sie hilfreich zu sein. Die Zusammenführung der Akteure, Patienten, Angehörigen, Behandlungsteams an einem runden Tisch, die Aussprache über Ängste, Wünsche, Behandlungsoptionen erweisen sich nicht selten als ein kathartischer Prozess, der viele Beteiligte mit dem Ausgang, und sei er tödlich, besser leben lässt. In dieser Hinsicht vermag "klinische Ethik" segensreich zu wirken.
Klinische Ethiker seien gefordert als Personen, die sich durch die Tugenden "Empathie, Mut, Offenheit und Fairness" auszeichnen. Unerlässlich ist die Urteilskraft. Die wird auch mit ihrem philosophischen Namen, der Phronesis, aufgerufen. Im Kapitel, das sich mit der Zukunft digitaler Medizin auseinandersetzt, geht es um den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Medizin. Dort liegen viele Anwendungen auf der Hand, warum also nicht auch in der Medizinethik. KI könnte wie auch in der Psychiatrie in die klinische Ethikberatung Eingang finden, etwas als Instrument der Ermittlung des Patientenwillens. Erste Versuche mit einem Patient Preference Predictor lassen aufhorchen. Doch in welchem Verhältnis stehen solche Entwicklungen zu ihrem eigenen Berufsbild? Da halten es die Autoren mit der Tradition, sie setzen auf profundes Urteilsvermögen. Ob KI diese wird substituieren können, lassen sie nur als rhetorische Frage offen. STEPHAN SAHM
Ralf Jox / Rouven Porz: "Wenn es ernst wird". Lebensentscheidungen von Kinderwunsch bis Sterbehilfe. Wie wir die richtigen Fragen an die Medizin stellen.
C.H. Beck Verlag, München 2025. 238 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Wenn es ernst wird" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









