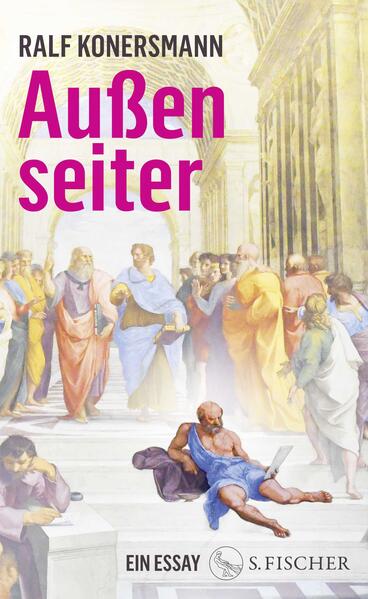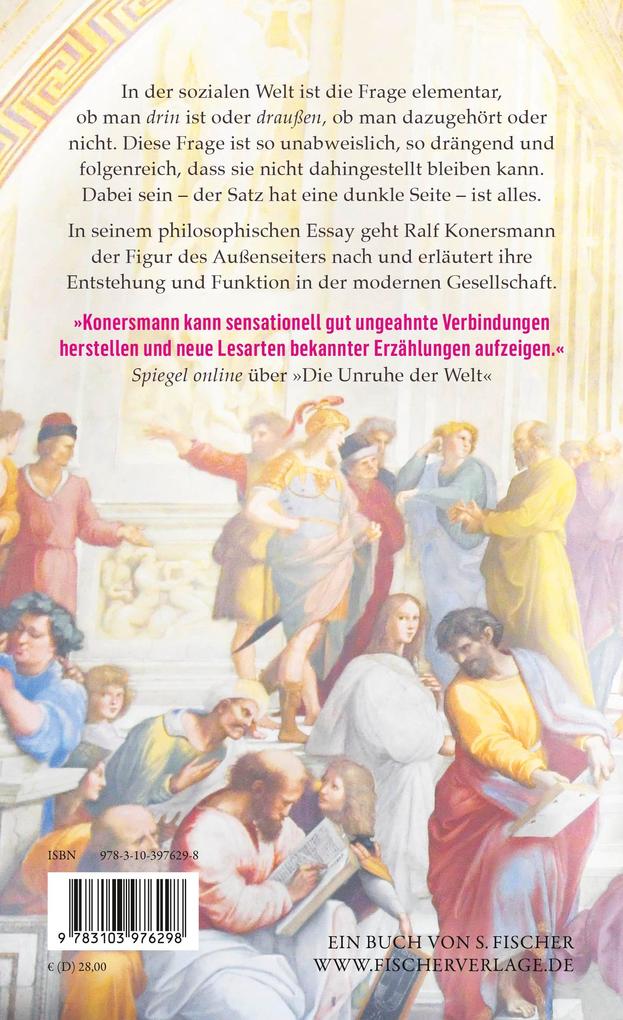Besprechung vom 25.06.2025
Besprechung vom 25.06.2025
Provokante Rebellen
Ralf Konersmann über den Außenseiter
Eigenbrötler, Einsiedler und Sonderlinge hat es in allen Kulturen und Epochen gegeben. Doch der "Außenseiter", dem Ralf Konersmann seinen Essay widmet, ist ein charakteristisches Geschöpf der westlichen Moderne. Folgt man dem emeritierten Kieler Kulturphilosophen, mag sich unser Zeitalter noch so demonstrativ Autonomie und Individualität auf die Fahnen schreiben - im Kern ist die Moderne ein gigantisches Inklusions- und Konformitätsprojekt.
Während in der gottgegebenen Ständeordnung des Ancien Régime die Frage nach der individuellen Positionierung im Sozialgefüge gar nicht erst aufkam, weil die Antwort bereits feststand, avancierte das Problem der Zugehörigkeit mit Beginn des bürgerlichen Zeitalters zur existenziellen Herausforderung. Auch jene, die sich von der Masse abheben wollten, hatten die Regeln des sozialen Spiels und des Wettbewerbs zu akzeptieren. Wer sich diesen Bedingungen verweigerte, wurde abgestraft und ausgegrenzt.
Nicht von ungefähr taucht das Wort "Outsider" erstmals um 1800 im englischen Reitsport auf, der deutsche Begriff etablierte sich ein Jahrhundert später. Wenn Konersmann den Außenseiter zur Symbolfigur der Moderne erhebt, dann geht es ihm dabei nicht zuletzt um die Selbstwidersprüche einer Epoche, die den Einzelnen in die Selbständigkeit entlässt, ihm zugleich aber das Loyalitätsbekenntnis zu einem Kollektiv abverlangt. Zum Ärgernis wird der Außenseiter, weil er der Moderne vor Augen führt, dass sie den Idealen der Toleranz und des Miteinanders niemals zufriedenstellend entsprechen kann.
Allerdings gibt es einen Typus Außenseiter, der sich über das geltende Regelsystem hinwegzusetzen scheint, während er sich doch nur freier als andere darin bewegt. So ist demonstratives Dissidententum mit der modernen Imagepflege ja durchaus vereinbar. Unangepasstheit und Rebellentum müssen wohldosiert sein, die Performance darf nerven und provozieren, vor allem weiß der salonfähige Nonkonformist, wie er sein Umfeld fasziniert. Die Dandys des neunzehnten Jahrhunderts haben diese Rolle als Erste erprobt. Später waren es die Ikonen der Popkultur, denen es gelang, Tabubruch und Markttauglichkeit zu vereinen.
Für Konersmann kommt diesen geschmeidigen Rebellen das "kaum zu überschätzende" Verdienst zu, den Spielraum des Erlaubten erweitert und den Durchschnittsexistenzen vorexerziert zu haben, wie man den Bogen überspannt, ohne am Ziel vorbeizuschießen. Dennoch handelt es sich hier allenfalls um entfernte Verwandte des echten Außenseiters, der sich laut Konersmann einzig seinen inneren Überzeugungen verpflichtet fühlt, keine Erklärungen liefert und keine Meriten anhäuft. Auch weiß der wahre Außenseiter, dass er einer ist, obgleich er es nie darauf angelegt hat, einer zu werden.
Konersmann nähert sich dieser Figur über die Philosophie- und Ideengeschichte. Von Sokrates und Platon über Nikolaus von Kues bis zu Montaigne zeichnet er die begrifflichen und intellektuellen Umbauarbeiten nach, die das Erscheinen des Außenseiters vor gut zwei Jahrhunderten möglich gemacht haben. An der Schwelle zur Moderne nimmt Rousseau eine maßgebliche Weichenstellung vor. Ausgerechnet der Theoretiker des Gemeinwillens benennt in seinen autobiographischen Schriften den Preis, den die vom Gemeinschaftsprinzip durchwirkte Gesellschaft dem Individuum abverlangt. In den "Bekenntnissen" nahm Rousseau den Status des Außenseiters nicht nur für sich selbst an, er wertete ihn radikal auf: "Wenn ich auch nicht besser bin, so bin ich wenigstens anders."
Nur wer ist nach Rousseau diesem "wenigstens anders" gerecht geworden? Konersmann verzichtet auf konkrete Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Neben den originellen Deutungen philosophiehistorischer Schlüsselmomente zeichnet sich sein Essay stellenweise durch selbstzweckhafte Verkapselung und eine ins Vage-Aphoristische verlagerte Kulturkritik aus. Dabei ist die Weigerung, ins Anschauliche zu gehen, hier so programmatisch wie konsequent. Denn eine handliche Anleitung, wie man zum Außenseiter wird, der diesen Namen verdient, kann es ohnehin nicht geben. MARIANNA LIEDER
Ralf Konersmann: "Der Außenseiter". Ein Essay.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2025. 160 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.