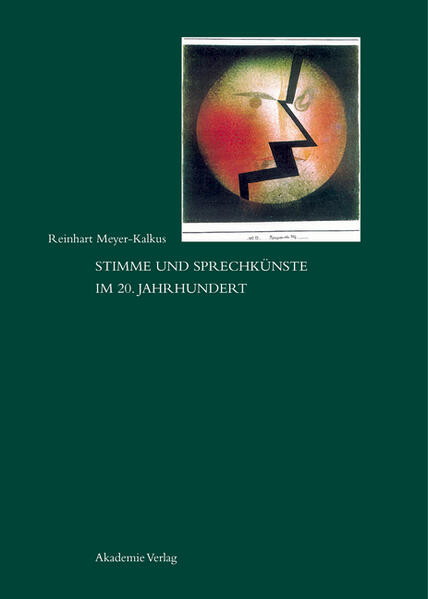
Zustellung: Fr, 23.05. - Di, 27.05.
Versand in 1-2 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Entgegen den aktuellen kulturwissenschaftlichen Ansätzen, die sich einseitig am Phänomen der Schrift oder an Bild oder Bildmedien orientieren, ist das Buch von Reinhart Meyer-Kalkus ein Plädoyer zugunsten der klanglich-musikalischen Dimension der Sprache und der Sprechkünste.
Es erschließt eine weitverzweigte Diskussion in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in Literatur- und Theaterwissenschaft, in Psychologie, Sprachwissenschaft und Ästhetik geführt und durch die neuen Medien Telefon, Schallplatte, Radio und Tonfilm stimuliert wurde.
Es erschließt eine weitverzweigte Diskussion in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in Literatur- und Theaterwissenschaft, in Psychologie, Sprachwissenschaft und Ästhetik geführt und durch die neuen Medien Telefon, Schallplatte, Radio und Tonfilm stimuliert wurde.
"Reinhart Meyer-Kalkus, Koordinator am Wissenschaftskolleg zu Berlin, hat ein wunderbares Buch zur Geschichte der Stimme verfasst. (. . .)
Wer jemals Zweifel hatte, ob Geisteswissenschaften 'gesellschaftsrelevantes' Wissen zu produzieren vermögen (. . .), der wird durch Reinhart Meyer-Kalkus mit Nachdruck eines Besseren belehrt. Solche Wissenschaft wird niemand missen wollen: Sie hat den 'Sitz im Leben' und geht doch keine schlechten Kompromisse ein nach Inhalt und Darstellungsform."
(Daniel Krause, www. klassik. com)
Wer jemals Zweifel hatte, ob Geisteswissenschaften 'gesellschaftsrelevantes' Wissen zu produzieren vermögen (. . .), der wird durch Reinhart Meyer-Kalkus mit Nachdruck eines Besseren belehrt. Solche Wissenschaft wird niemand missen wollen: Sie hat den 'Sitz im Leben' und geht doch keine schlechten Kompromisse ein nach Inhalt und Darstellungsform."
(Daniel Krause, www. klassik. com)
Inhaltsverzeichnis
1; Inhaltsverzeichnis; 6
2; I. EINLEITUNG: Rede, damit ich dich sehe! ; 10
2. 1; 1. Lichtenberg über die Physiognomik der Stimme; 13
2. 2; 2. Rückblick auf die Geschichte der Physiognomik der Stimme; 22
2. 3; 3. Ausdruckswahrnehmung und Verkörperung als symbolische Form; 37
2. 4; 4. Physiognomische Trugschlüsse; 51
2. 5; 5. Die Stimme als Gestalt und akustische Maske; 55
2. 6; 6. Koexpressivität von Stimme und Gestik; 60
2. 7; 7. Körperlose Stimmen Suspendierte Koexpressivität und Rekonfiguration; 69
2. 8; 8. Der physiognomische Blitz; 79
3; II. PHILOLOGIE: Die Schallanalyse von Eduard Sievers; 82
3. 1; 1. Ohren- statt Augenphilologie; 82
3. 2; 2. Sievers rhythmisch-melodische Studien; 88
3. 3; 3. Die Rutzsche Typenanalyse; 97
3. 4; 4. Sievers und die experimentelle Psychologie der Leipziger Wundt-Schule; 103
3. 5; 5. Zeitgenössische Rezeption und Kritik der Schallanalyse; 115
3. 6; 6. Die Arbeit am System der Schallanalyse; 124
4; III. Echos der Ohrenphilologie; 135
4. 1; 1. Sprachwissenschaft und Sprecherziehung; 135
4. 2; 2 . Russischer Formalismus und Cercle linguistique de Prague; 140
4. 3; 3. Theorie der Vielstimmigkeit erzählender Texte (Michail Bachtin); 144
5; IV. AUSDRUCKSPSYCHOLOGIE UND SPRACHWISSENSCHAFT: Karl Bühler über den Ausdruck in Stimme und Sprache; 152
5. 1; 1. Darstellung, Ausdruck und Appell das Organon-Modell; 152
5. 2; 2. Resonanz und Indizien Bühlers physiognomisches Radio-Experiment; 163
5. 3; 3. Bühlers Dialog mit der Phonologie (N. S. Trubetzkoy); 171
5. 4; 4. Ansätze zu einer Lautstilistik; 181
5. 5; 5. Ludwig Wittgenstein über Tonfälle und Ausdrucksspiele; 183
6; V. Expressive Lautsymbolik; 188
6. 1; 1. Nostalgie nach sprachlicher Unmittelbarkeit Karl Bühlers Analyse der Lautmalerei; 188
6. 2; 2 . Heinz Werners Physiognomik der Sprache; 194
6. 3; 3 . Ernst Jüngers Lob der Vokale ; 203
7; VI. Sprechkünste im 20. Jahrhundert; 222
7. 1; 1. Der Wandel vokaler Vortragsformen soziale und historische Voraussetzungen; 222
7. 2; 2. Die Sprechkunstbewegung um 1800; 232
7. 3; 3. Der "Sprechsänger mit dem Stimmreiz" Josef Kainz; 260
7. 4; 4 . Sprechmelodien und absolute Schauspielkunst im Sturm -Kreis (Rudolf Blümner, Kurt Schwitters); 272
7. 5; 5. Dadaistische Lautpoesie Hugo Ball; 290
7. 6; 6. Sprechmelodien im Melodrama Arnold Schönbergs Zusammenarbeit mit Albertine Zehme in Pierrot Lunaire ; 308
7. 7; 7. Akustische Masken Elias Canetti; 327
7. 8; 8. Gesang und Sprache bei Mensch und Tier: Charles Darwin und Franz Kafka; 345
8; VII. Tonfilm und Radio in der Weimarer Republik; 355
8. 1; 1. Vom Stumm- zum Tonfilm (Béla Balázs, Fritz Lang); 355
8. 2; 2 . Die Stimme am Mikrophon Theorien der Radiokunst; 372
9; VIII. PSYCHOANALYSE: Die Triebtheorie der Stimme; 391
9. 1; 1. Hören mit dem Dritten Ohr (Freud und seine Schüler); 391
9. 2; 2. Die Psychoanalyse als Linguistik der Rede (Freud, de Saussure, Lacan); 400
9. 3; 3. Die Stimme der Psychose; 410
9. 4; 4 . Der Anrufungstrieb; 417
9. 5; 5. Die Ethik der Rede und die Sprechkunst des Psychoanalytikers; 430
10; IX. Die Wiederkehr der Physiognomik der Stimme Roland Barthes über das Korn der Stimme; 436
11; X. Nachwort; 454
11. 1; 1. Ausdruckswahrnehmung; 456
11. 2; 2 . Medien; 460
11. 3; 3. Literatur für Stimme und Ohr; 465
11. 4; 4 . Text als Partitur; 471
12; Anhang; 474
12. 1; Dank; 476
12. 2; Literaturverzeichnis; 478
12. 3; Abbildungen; 506
12. 4; Namenregister; 508
2; I. EINLEITUNG: Rede, damit ich dich sehe! ; 10
2. 1; 1. Lichtenberg über die Physiognomik der Stimme; 13
2. 2; 2. Rückblick auf die Geschichte der Physiognomik der Stimme; 22
2. 3; 3. Ausdruckswahrnehmung und Verkörperung als symbolische Form; 37
2. 4; 4. Physiognomische Trugschlüsse; 51
2. 5; 5. Die Stimme als Gestalt und akustische Maske; 55
2. 6; 6. Koexpressivität von Stimme und Gestik; 60
2. 7; 7. Körperlose Stimmen Suspendierte Koexpressivität und Rekonfiguration; 69
2. 8; 8. Der physiognomische Blitz; 79
3; II. PHILOLOGIE: Die Schallanalyse von Eduard Sievers; 82
3. 1; 1. Ohren- statt Augenphilologie; 82
3. 2; 2. Sievers rhythmisch-melodische Studien; 88
3. 3; 3. Die Rutzsche Typenanalyse; 97
3. 4; 4. Sievers und die experimentelle Psychologie der Leipziger Wundt-Schule; 103
3. 5; 5. Zeitgenössische Rezeption und Kritik der Schallanalyse; 115
3. 6; 6. Die Arbeit am System der Schallanalyse; 124
4; III. Echos der Ohrenphilologie; 135
4. 1; 1. Sprachwissenschaft und Sprecherziehung; 135
4. 2; 2 . Russischer Formalismus und Cercle linguistique de Prague; 140
4. 3; 3. Theorie der Vielstimmigkeit erzählender Texte (Michail Bachtin); 144
5; IV. AUSDRUCKSPSYCHOLOGIE UND SPRACHWISSENSCHAFT: Karl Bühler über den Ausdruck in Stimme und Sprache; 152
5. 1; 1. Darstellung, Ausdruck und Appell das Organon-Modell; 152
5. 2; 2. Resonanz und Indizien Bühlers physiognomisches Radio-Experiment; 163
5. 3; 3. Bühlers Dialog mit der Phonologie (N. S. Trubetzkoy); 171
5. 4; 4. Ansätze zu einer Lautstilistik; 181
5. 5; 5. Ludwig Wittgenstein über Tonfälle und Ausdrucksspiele; 183
6; V. Expressive Lautsymbolik; 188
6. 1; 1. Nostalgie nach sprachlicher Unmittelbarkeit Karl Bühlers Analyse der Lautmalerei; 188
6. 2; 2 . Heinz Werners Physiognomik der Sprache; 194
6. 3; 3 . Ernst Jüngers Lob der Vokale ; 203
7; VI. Sprechkünste im 20. Jahrhundert; 222
7. 1; 1. Der Wandel vokaler Vortragsformen soziale und historische Voraussetzungen; 222
7. 2; 2. Die Sprechkunstbewegung um 1800; 232
7. 3; 3. Der "Sprechsänger mit dem Stimmreiz" Josef Kainz; 260
7. 4; 4 . Sprechmelodien und absolute Schauspielkunst im Sturm -Kreis (Rudolf Blümner, Kurt Schwitters); 272
7. 5; 5. Dadaistische Lautpoesie Hugo Ball; 290
7. 6; 6. Sprechmelodien im Melodrama Arnold Schönbergs Zusammenarbeit mit Albertine Zehme in Pierrot Lunaire ; 308
7. 7; 7. Akustische Masken Elias Canetti; 327
7. 8; 8. Gesang und Sprache bei Mensch und Tier: Charles Darwin und Franz Kafka; 345
8; VII. Tonfilm und Radio in der Weimarer Republik; 355
8. 1; 1. Vom Stumm- zum Tonfilm (Béla Balázs, Fritz Lang); 355
8. 2; 2 . Die Stimme am Mikrophon Theorien der Radiokunst; 372
9; VIII. PSYCHOANALYSE: Die Triebtheorie der Stimme; 391
9. 1; 1. Hören mit dem Dritten Ohr (Freud und seine Schüler); 391
9. 2; 2. Die Psychoanalyse als Linguistik der Rede (Freud, de Saussure, Lacan); 400
9. 3; 3. Die Stimme der Psychose; 410
9. 4; 4 . Der Anrufungstrieb; 417
9. 5; 5. Die Ethik der Rede und die Sprechkunst des Psychoanalytikers; 430
10; IX. Die Wiederkehr der Physiognomik der Stimme Roland Barthes über das Korn der Stimme; 436
11; X. Nachwort; 454
11. 1; 1. Ausdruckswahrnehmung; 456
11. 2; 2 . Medien; 460
11. 3; 3. Literatur für Stimme und Ohr; 465
11. 4; 4 . Text als Partitur; 471
12; Anhang; 474
12. 1; Dank; 476
12. 2; Literaturverzeichnis; 478
12. 3; Abbildungen; 506
12. 4; Namenregister; 508
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. Juli 2001
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
516
Autor/Autorin
Reinhart Meyer-Kalkus
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
21 b/w ill.
Gewicht
1017 g
Größe (L/B/H)
246/155/41 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783050035963
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Reinhart Meyer-Kalkus, Koordinator am Wissenschaftskolleg zu Berlin, hat ein wunderbares Buch zur Geschichte der Stimme verfasst. (. . .).
Wer jemals Zweifel hatte, ob Geisteswissenschaften gesellschaftsrelevantes Wissen zu produzieren vermögen (. . .), der wird durch Reinhart Meyer-Kalkus mit Nachdruck eines Besseren belehrt. Solche Wissenschaft wird niemand missen wollen: Sie hat den Sitz im Leben und geht doch keine schlechten Kompromisse ein nach Inhalt und Darstellungsform."
(Daniel Krause, www. klassik. com)
Wer jemals Zweifel hatte, ob Geisteswissenschaften gesellschaftsrelevantes Wissen zu produzieren vermögen (. . .), der wird durch Reinhart Meyer-Kalkus mit Nachdruck eines Besseren belehrt. Solche Wissenschaft wird niemand missen wollen: Sie hat den Sitz im Leben und geht doch keine schlechten Kompromisse ein nach Inhalt und Darstellungsform."
(Daniel Krause, www. klassik. com)
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.










