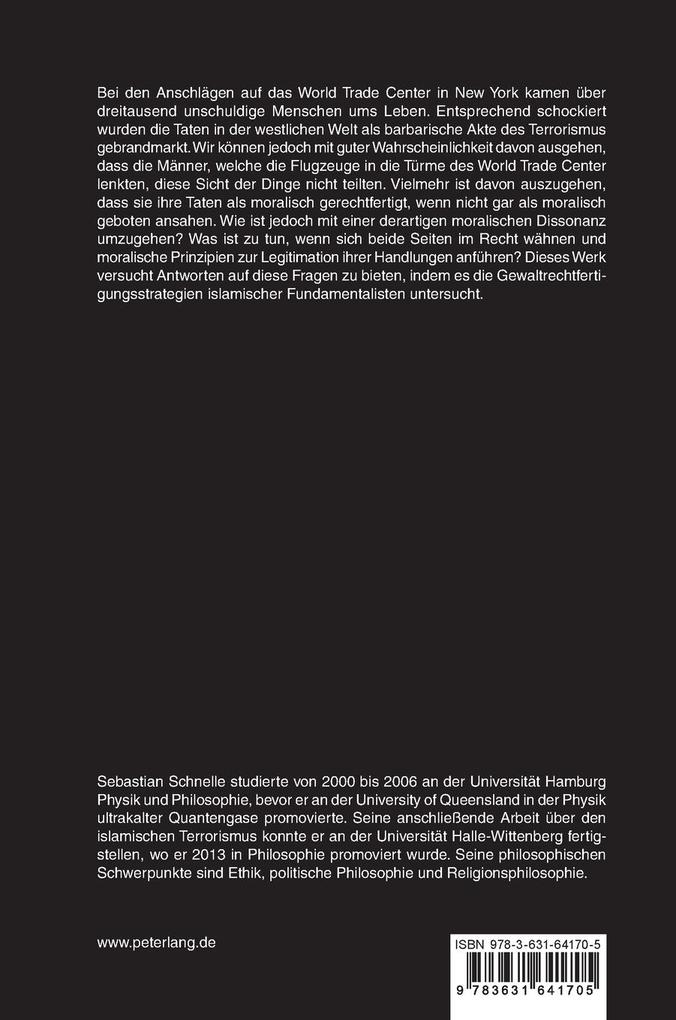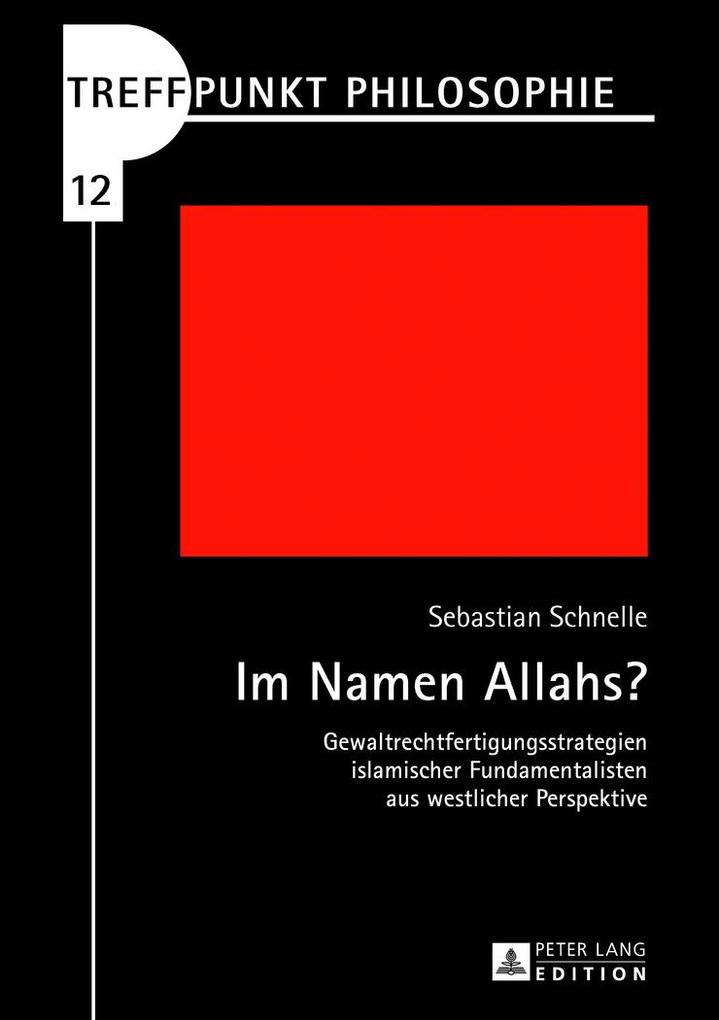
Zustellung: Sa, 23.08. - Mi, 27.08.
Versand in 7 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Moralisch geboten oder verboten? Das Buch untersucht die Gewaltrechtfertigungsstrategien islamischer Fundamentalisten, um einerseits die Frage nach dem Funktionieren solcher Strategien prinzipiell zu beantworten und andererseits einen Vergleich und eine Wertung ihrer Anwendung in der westlichen Welt und durch islamistische Autoren zu ziehen.
Bei den Anschlägen auf das World Trade Center in New York kamen über dreitausend unschuldige Menschen ums Leben. Entsprechend schockiert wurden die Taten in der westlichen Welt als barbarische Akte des Terrorismus gebrandmarkt. Wir können jedoch mit guter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Männer, welche die Flugzeuge in die Türme des World Trade Center lenkten, diese Sicht der Dinge nicht teilten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sie ihre Taten als moralisch gerechtfertigt, wenn nicht gar als moralisch geboten ansahen. Wie ist jedoch mit einer derartigen moralischen Dissonanz umzugehen? Was ist zu tun, wenn sich beide Seiten im Recht wähnen und moralische Prinzipien zur Legitimation ihrer Handlungen anführen? Dieses Werk versucht Antworten auf diese Fragen zu bieten, indem es die Gewaltrechtfertigungsstrategien islamischer Fundamentalisten untersucht.
Inhaltsverzeichnis
Inhalt: Säkularisierung politischer Theologie als Übersetzung in politische Philosophie Historischer Überblick über die Theorie vom gerechten Krieg von Antike bis Gegenwart Die Iusta Causa Bedingung als eigentliche Gewaltrechtfertigung Die Duplex-Effectus-Lehre bei Thomas von Aquin und heute Die pazifistische und die realpolitische Alternative zur Theorie vom gerechten Krieg Meilensteine islamistischer Gewaltrechtfertigung Sayyid Qutb als Wegbereiter Abdul Salam Faraj und der Jihad als vernachlässigte Pflicht Abdullah Azzam, Ideologe des Jihad: Freiheitskämpfer oder Terrorist Ayman al-Zawahiri zu Terrorismus und Immunität von Zivilisten.
Jetzt reinlesen: Inhaltsverzeichnis(pdf)Produktdetails
Erscheinungsdatum
30. Juli 2013
Sprache
deutsch
Untertitel
Gewaltrechtfertigungsstrategien islamischer Fundamentalisten aus westlicher Perspektive.
Seitenanzahl
219
Reihe
Treffpunkt Philosophie
Autor/Autorin
Sebastian Schnelle
Weitere Beteiligte
Martin Morgenstern, Robert Zimmer
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
403 g
Größe (L/B/H)
216/153/16 mm
ISBN
9783631641705
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Im Namen Allahs?" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.