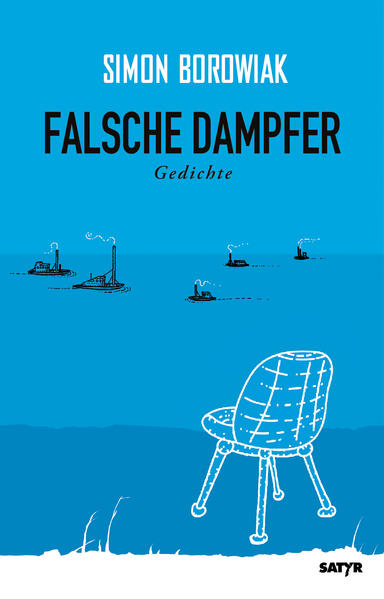
Zustellung: Sa, 10.05. - Di, 13.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Jede*r kennt »Frau Rettich, die Czerni und ich« und andere Bestseller von Simon Borowiak. Kaum bekannt ist, dass Borowiak auch exzellenter Lyriker ist. Erstmals erscheinen seine besten Gedichte aus vier Jahrzehnten nun in einem Sammelband: komische Miniaturen, schwebend melancholische Texte, so stilsicher wie gekonnt. In diesem Sammelband wird lyrisch aus allen Rohren geschossen, formal wie inhaltlich. Da wird thematisiert, dass sich die eigene Verlobte ununterbrochen anderweitig verlobt. Oder was passiert, wenn Spirituosen feiern. Oder wie es in einer Geschlossenen aussieht. Oder der Vorhölle. Persönliche Höhen und Tiefen haben das Leben des Schriftstellers Simon Borowiak geprägt, der emotionale Widerhall davon findet sich auch in seinen Gedichten. Die Vielfalt der Tonfälle kommt nicht von ungefähr: Simon Borowiak besuchte sieben Jahre lang die »Neue Frankfurter Schule«, seine Lehrmeister im Fach Lyrik waren Robert Gernhardt, F. W. Bernstein und Hans Traxler. Ein Credo war dabei verpflichtend: Die klassischen Formen müssen sitzen! Und wenn man diese beherrscht, kann man sich formal wie inhaltlich alles erlauben. »Falsche Dampfer« merkt man diese strenge Schule an: Alles ist drin.»Eine Achterbahnfahrt von luftig-lustigen Höhen hinab in schwärzeste Tiefen und wieder hinauf in gnadenlose Helligkeit; das alles völlig unverdorben von jeder falschen Versöhnlichkeit. « - Hans Zippert»Simon Borowiak schreibt wunderschöne und abgrundtiefe Gedichte, wie er überhaupt eine Sprache hat für fast alles unter dem Mond - und manchmal unter der Sonne. « - Elke Schmitter
Produktdetails
Erscheinungsdatum
03. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
96
Autor/Autorin
Simon Borowiak
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
194 g
Größe (L/B/H)
196/127/13 mm
ISBN
9783910775305
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Simon Borowiak schreibt wunderschöne und abgrundtiefe Gedichte, wie er überhaupt eine Sprache hat für fast alles unter dem Mond und manchmal unter der Sonne. « Elke Schmitter
»Eine Achterbahnfahrt von luftig-lustigen Höhen hinab in schwärzeste Tiefen und wieder hinauf in gnadenlose Helligkeit; das alles völlig unverdorben von jeder falschen Versöhnlichkeit. « Hans Zippert
»Eine Achterbahnfahrt von luftig-lustigen Höhen hinab in schwärzeste Tiefen und wieder hinauf in gnadenlose Helligkeit; das alles völlig unverdorben von jeder falschen Versöhnlichkeit. « Hans Zippert
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Wer konnte, wollte Quitten begreifen?
Hier geht's ans Eingemachte: In Simon Borowiaks Gedichten steht die Fruchtbarkeit der Tradition im Dienst herbeigeträumter Verarbeitung des Elends.
Von Patrick Bahners
Von Patrick Bahners
Zwei Wörter, zwei Silben, das lakonische Äquivalent einer traurig banalen Geste, des Achselzuckens: "Je nun". Für sich genommen bezeichnet jede der beiden Partikeln ein Verhältnis des Sprechers zur Zeit, die erste jeden beliebigen Zeitpunkt, die zweite den Moment der Gegenwart. Zusammengenommen heben sie einander auf. Der Lauf der Zeit wird nicht so sehr stillgestellt als abgestellt. Ereignis, Zustand oder Entwicklung, die mit dieser Wendung kommentiert werden, fallen aus der Wertung heraus, die in jedem bewussten Leben mitläuft und ebenso in den Reaktionen des Körpers. Hoffnung erübrigt sich, Furcht scheinbar auch.
"Je nun": Zweimal lässt Simon Borowiak die Formel in seinem Gedicht "Mein Alltag" fallen, gegen Anfang und am Ende. Der Alltag wird in Stationen geschildert, eingeleitet jeweils von einem "Dann", gleich einem Glockenschlag, mit Doppelpunkt für den Nachhall. So folgt am Morgen auf den Blick in den Spiegel der Gang vor die Tür. "Dann: / Raus in die Welt. / Je nun. / Gibt Schöneres." Man muss sich diese Welt als namenlose deutsche Großstadt vorstellen. Zwei Strophen weiter nimmt der Wanderer Zuflucht im Schrebergarten. "Gibt Schöneres", mit heruntergeschlucktem "Es": Wie jeden Tag hält sich der Abgebrühte mit kläglichem Sarkasmus notdürftig bei Laune. Beim Wort genommen erweist sich sein Urteil gleichzeitig als Paradox. Etwas Schöneres als die Welt kann es nur außerhalb der Welt geben, im Jenseits.
Der von der Welt abgeschlossene Garten bietet dann wirklich etwas Schöneres und sogar "Zauberhafteres", in Gestalt einer Frucht. "Die Quitte! Die Quitte! Gibt nichts Liebreizenderes!" Das unbeschrieben bleibende, dafür zweifach benannte Ding am Baum schlägt jedes menschliche Wesen aus dem Feld des Vergleichens, von dem das Gedicht nicht loskommt. Auf dem Weg der Negation stolpert die superlativische Apodiktik der kurzen Verse in den Relativismus schwärmerischer Strichlistenführung. "Höchstens: / Der Pfefferminz. / Die Akelei. / Das Kiwi." Was ist das lyrische Ich? Organ des Weltgenusses und unfehlbare Wertungsinstanz, eine Fangemeinde mit einem einzigen Mitglied. Der Fruchtbarkeitszauber entpuppt sich als Sprachmagie. Borowiak erneuert das barocke Schöpfungslob aus dem Katalog, allerdings steht die durch die Dreizahl der grammatischen Geschlechter verbürgte Fülle nur auf dem Papier: Das Kiwi ist nichts, was man essen kann.
In der Schrebergartenperiode des Alltags reihen sich an die emphatische Apperzeption Phasen ästhetischer Rezeption und Produktion. Nach neunfachem "Dann" wird das zehnte und letzte durch das zweite "Je nun" verdrängt. "Je nun: / Man kann nicht alles haben." So quittiert der Heimkehrer, dass er das Schönreden seines Tagwerks nicht bis zum letzten Atemzug durchhalten konnte. Der viertletzte und drittletzte Vers lauten: "Abschließend: / Ins Kissen weinen." In Wilhelm Müllers Gedicht "Im Dorfe", der Nr. 17 in Franz Schuberts Vertonung der "Winterreise", malt sich der nächtliche Reisende aus, wie die Träume der Menschen, an deren Schlafzimmern er vorbeistreift, beim Aufwachen zerfließen: "Je nun, sie haben ihr Teil genossen, / Und hoffen, was sie noch übrig ließen, / Doch wieder zu finden auf ihren Kissen." Bei Borowiak haben die Tränen jede Hoffnung auf ein Wiederfinderglück fortgespült, und der gesamte Teil des Alltags, den das Ich (das nie "ich" und nur einmal "mich" sagt) genießen konnte, stellt sich als Einbildung dar, als Tagtraum.
Dass das Zusammentreffen des "Je nun" mit dem Kissen kein Zufall ist, legen die vielen anderen Verweise auf lyrisches Traditionsgut in Borowiaks Band "Falsche Dampfer" nahe. "Dies Augenzelt" in "Hier stimmt was nicht", das "Neigen / von Herzen zu Herzen" in "Stadtnacht 1" - aus "Du bist die Ruh" von Friedrich Rückert und "Rastlose Liebe" von Goethe, beide ebenfalls vertont von Schubert. Durch "Stadtnacht 1" und "Stadtnacht 2" schweift ein Wiedergänger des Wanderers aus der "Winterreise". Sein Röntgenblick durchdringt die Wände sowohl der Wohlhabenden ("Nur helle Fenster. Hohe weiße Decken.") als auch der Ärmeren ("die Decken tief, die Fenster klein") und legt halluzinierten Moritatenstoff frei: "Im Nebenraum ein Kindlein wimmert. / Paps hat ihm ein paar reingezimmert, / so wie sich selbst das achte Bier."
Chiffren von Zeitlosigkeit sind die wie Volksliedfetzen montierten Kunstliedfragmente im Sinne eines durch Entkoppelung von allen sozialen Beziehungen eingetretenen Verlusts von Zeitgenossenschaft. Die 37 Gedichte des Bandes bilden nach Angaben des Verlags die lyrische Ernte von vier Jahrzehnten. Ihr Stoff ist ein Leben am Rande eines nach unten offenen Existenzminimums: Bei jedem Ausloten zeigt sich, dass noch weniger als gedacht genügt und bleibt. Ein weiteres Gedicht nach dem Schema des Tageslaufprotokolls siedelt den Alltag im Kaufhaus an, wobei offenbleibt, ob die Tätigkeit dort entlohnt ist oder dem Zeitverbrauch dient. Sie ist jedenfalls nur Vorbereitung und Begleiterscheinung von Verdauung.
Zu sagen, dass hier durch Form etwas bewältigt oder gebannt werde, wäre ganz falsch. Dennoch bewundert man die Kunstfertigkeit Simon Borowiaks. Alles Abgehackte und Hingerotzte ist gefügt. Im Trostmotivreservoir bleibt nur der Gedanke an den Selbstmord übrig, und die beiden Gedichte, in denen Inhalt und Form, die Ordnung der Welt und der Gang der Verse eine auch äußerlich vollkommene Einheit bilden, haben die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik zum Schauplatz und Gegenstand.
Simon Borowiak: "Falsche Dampfer". Gedichte
Satyr Verlag, Berlin 2025. 96 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Falsche Dampfer" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









