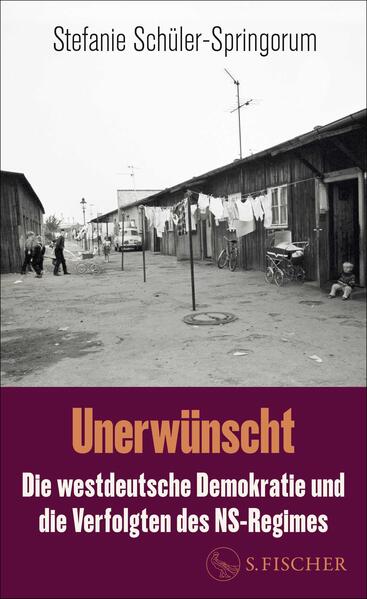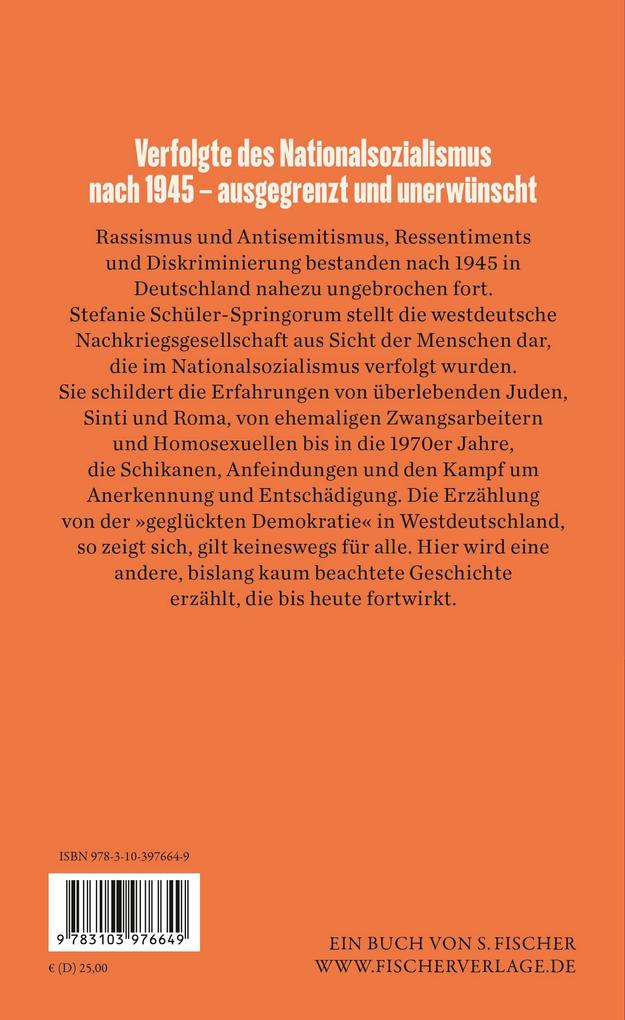Besprechung vom 30.05.2025
Besprechung vom 30.05.2025
Auf der Seite der Schuldigen wurde das Maß der Sühne bestimmt
Aus der Perspektive der Opfer: Stefanie Schüler-Springorum über den Umgang mit Verfolgten unter dem NS-Regime in Westdeutschland
Dass die Bundespublik nach trüben Anfängen recht bald einen glücklichen Weg eingeschlagen habe, nämlich den nach Westen zu Demokratie und Menschenrechten, dass man also von einem Neubeginn 1945 sprechen dürfe, das ist seit den späten Siebzigerjahren eine weitverbreitete Meinung auch in der Wissenschaft, die erst seit einigen Jahren in Zweifel gezogen wird: Das Fortwirken autoritärer, rassistischer Überzeugungen sei doch weit hartnäckiger gewesen als unterstellt. Diese Auffassung vertritt auch Stefanie Schüler-Springorum, Direktorin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, in ihrem neuen Buch über die "westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes". Es ist ein schmales Buch, der Text ohne die Anmerkungen umfasst nicht einmal zweihundert Seiten, doch das reicht, um von vielen bösen Dingen zu berichten.
Unter den Überlebenden waren die Juden in einer vergleichsweisen günstigen Lage: Die Alliierten, vor allem die USA, nahmen deren Behandlung als Maßstab für die Bereitschaft der Deutschen zur Wandlung. Dabei hielt sich der Antisemitismus zäh, 1950 meinten knapp vierzig Prozent der westdeutschen Bevölkerung, es sei besser, "keine Juden im Land zu haben". Noch trauriger sind die Schilderungen persönlicher Erlebnisse. Die Brüder Frankenthal etwa erfüllten den letzten Wunsch ihres in Auschwitz ermordeten Vaters, in ihr Heimatdorf im Sauerland zurückzukehren und dort "stolz zu sein auf ihren Namen". Sie trafen auf alte Freunde und Nachbarn, die ihnen die Wertsachen zurückbrachten, die sie für die Eltern aufgehoben hatten, und auch sonst behilflich waren. Aber als die Brüder einen Gedenkstein am Ort der Synagoge aufstellten, blieben sie allein. Auch beruflich wurden ihnen Steine in den Weg gelegt. "Da merkten wir erst, dass dieses katholische Sauerland dachte: Jetzt wo die Juden tot sind, sollen auch keine wieder hier groß werden."
Besondere Aufmerksamkeit widmet Schüler-Springorum dem Schicksal der Sinti und Roma. Was Juden oder Kommunisten nach Kriegsende half, eine starke Gruppensolidarität und internationale Aufmerksamkeit, das ging Sinti und Roma ab. Dazu kam, dass sie im Nationalsozialismus nicht allein aus rassischen Gründen verfolgt wurden, sondern auch als "Asoziale" oder "Berufsverbrecher". Das war eine weiterhin verbreitete Einschätzung, der Antiziganismus der Mehrheitsbevölkerung saß fest. Noch 1957 urteilte der Bundesgerichtshof, "Zigeuner" neigten als "primitive Urmenschen" zur Kriminalität, ihre Verfolgung bis 1945 habe also einen rationalen Kern. In den Ämtern und der Polizei blieben in den Fünfzigerjahren und später für "Zigeuner" die Beamten zuständig, die bis 1945 die nationalsozialistische Politik ausgeführt hatten - mit unveränderter Grundhaltung, Kontinuität eben nicht nur unter den Eliten.
Schüler-Springorum betont stark das Fortwirken nationalsozialistischen Denkens. Aber es gab dieses Denken überall und nicht nur bei den üblichen Verdächtigen. Gustav Radbruch etwa widmete in seiner "Geschichte des Verbrechens" 1949 ein Kapitel den "Zigeunern" (ohne Anführung) und unterstellte darin ganz selbstverständlich deren Neigung zu wenn auch eher kleineren Verbrechen. Dabei war er ein fortschrittlicher Strafrechtler und Rechtspolitiker. Als sozialdemokratischer Justizminister der frühen Weimarer Republik setzte er sich für die Abschaffung des §218 und der Todesstrafe ein, 1946 entwickelte er die nach ihm benannte Formel zur Lösung des Konflikts von "gesetzlichem Unrecht und übergesetzlichem Recht"; ein Dunkelmann war er nicht. Und doch hielt er "Zigeuner" für "auf der primitiven Entwicklungsstufe der Jäger und Sammler stehengeblieben". Seine "Geschichte des Verbrechens" gab H. M. Enzensberger in der "Anderen Bibliothek" 1990 neu heraus.
Und ähnlich stellt sich auch das Schicksal der Homosexuellen nach Kriegsende dar. Ihre Verfolgung im Nationalsozialismus wurde in Westdeutschland lange nicht anerkannt mit Hinweis darauf, dass männliche Homosexualität auch vor 1933 und nach 1945 strafbar gewesen war. Dass die Verfolgung im Dritten Reich jedes bekannte Maß überschritt, wurde nicht beachtet, selbst erzwungene Kastrationen galten der westdeutschen Justiz als "rechtmäßig", nicht entschädigungsfähig. Und auch der Verfolgungsdruck der ersten Nachkriegsjahre war enorm. Auch hier weist Schüler-Springorum auf die anhaltende Prägung durch nationalsozialistische Auffassungen hin, sicherlich nicht zu Unrecht.
Doch ganz geht diese Erklärung nicht auf, die Entwicklung in Frankreich zeigt eine Parallele. Seit der Revolution, seit 1791, war Homosexualität dort nicht mehr strafbar. Aber im Vichy-Frankreich änderte sich das, wenngleich nicht so scharf wie in Deutschland. Nach 1945 die Rechtslage zu revidieren, hätte doppelt nahegelegen, doch das Gegenteil geschah, sie wurde unter de Gaulle verschärft (allerdings immer noch weniger streng als in der Bundesrepublik). Wie war das möglich? Bis 1973 führte die American Psychiatric Association Homosexualität als "mental disorder".
Schüler-Springorum neigt dazu, auf alle Fragen die eine und gleiche Antwort zu geben, das Fortwirken des Nationalsozialismus in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Natürlich spielte das eine große Rolle, an der vielfach schäbigen Behandlung der NS-Opfer kann kein Zweifel bestehen. Die Versuche der Wiedergutmachung fielen kleinlich und hartherzig aus, vonseiten der Bundesrepublik ging es darum, die Ansprüche der Verfolgten so weit wie möglich abzuwehren. Franz Böhm, den man als eine der Gründergestalten der Sozialen Marktwirtschaft kennt, beschrieb das strukturelle Problem: "Letztlich legte die Seite der Schuldigen das Ausmaß der notwendigen Sühne fest." Und die Autorin hat sich ausdrücklich dazu bekannt, die Perspektive der Opfer darzustellen, in diesem Sinne sei ihr Buch "bewusst einseitig". Diese Einseitigkeit hat ihr Recht, doch heikel ist sie auch. Denn der Gegenstand des Buches ist ein moralbefangener, was auch heißt, er fordert zum Urteil auf. Ein Urteil aber, das so selbstverständlich ergeht, was ist das wert?
Als der Bundestag 1953 über das Luxemburger Abkommen, das "Wiedergutmachungsabkommen" entschied, stimmten selbst Minister der Regierung Adenauer dagegen, wie Fritz Schäffer und Thomas Dehler, und das waren keine Nazis. Adenauers Begründung des Abkommens: "Die Macht der Juden, auch heute noch, insbesondere in Amerika, soll man nicht unterschätzen", das hört sich heute antisemitisch an, aber Nahum Goldmann und Ben Gurion sprachen mit großem Respekt von ihm. Auch in Israel wurden die Holocaust-Überlebenden nicht durchweg respektvoll behandelt, sie wurden oft als sabonim, "Seifen", verspottet, woran Saul Friedländer vor Kurzem noch erinnert hat. Es brauchte offenbar Zeit, sich des Ausmaßes der Verbrechen bewusst, oder wie man vielleicht sagen darf, ihrer inne zu werden. STEPHAN SPEICHER
Stefanie Schüler- Springorum: "Unerwünscht". Die westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2025. 256 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.