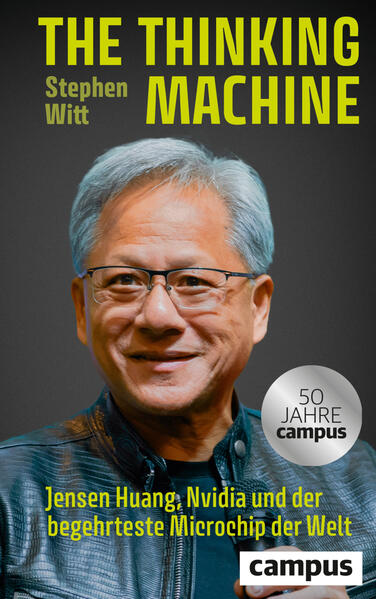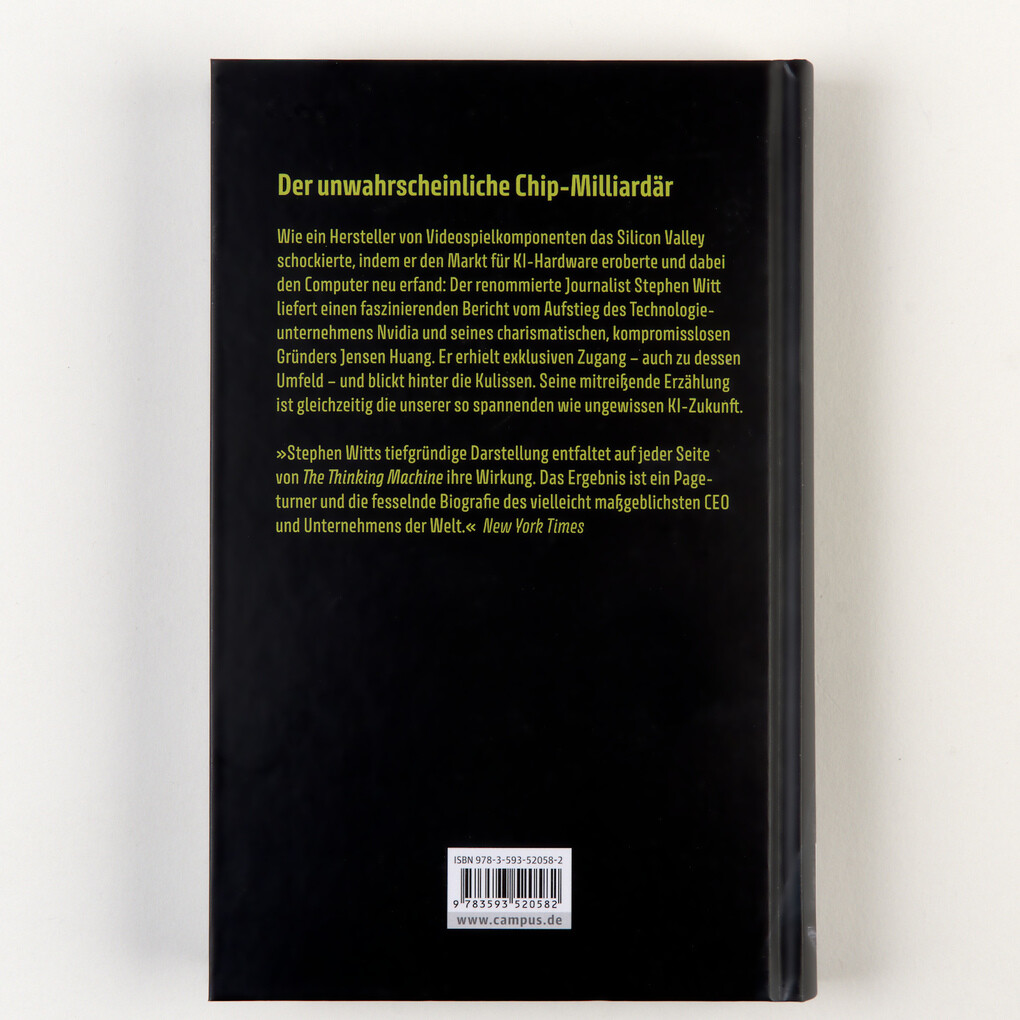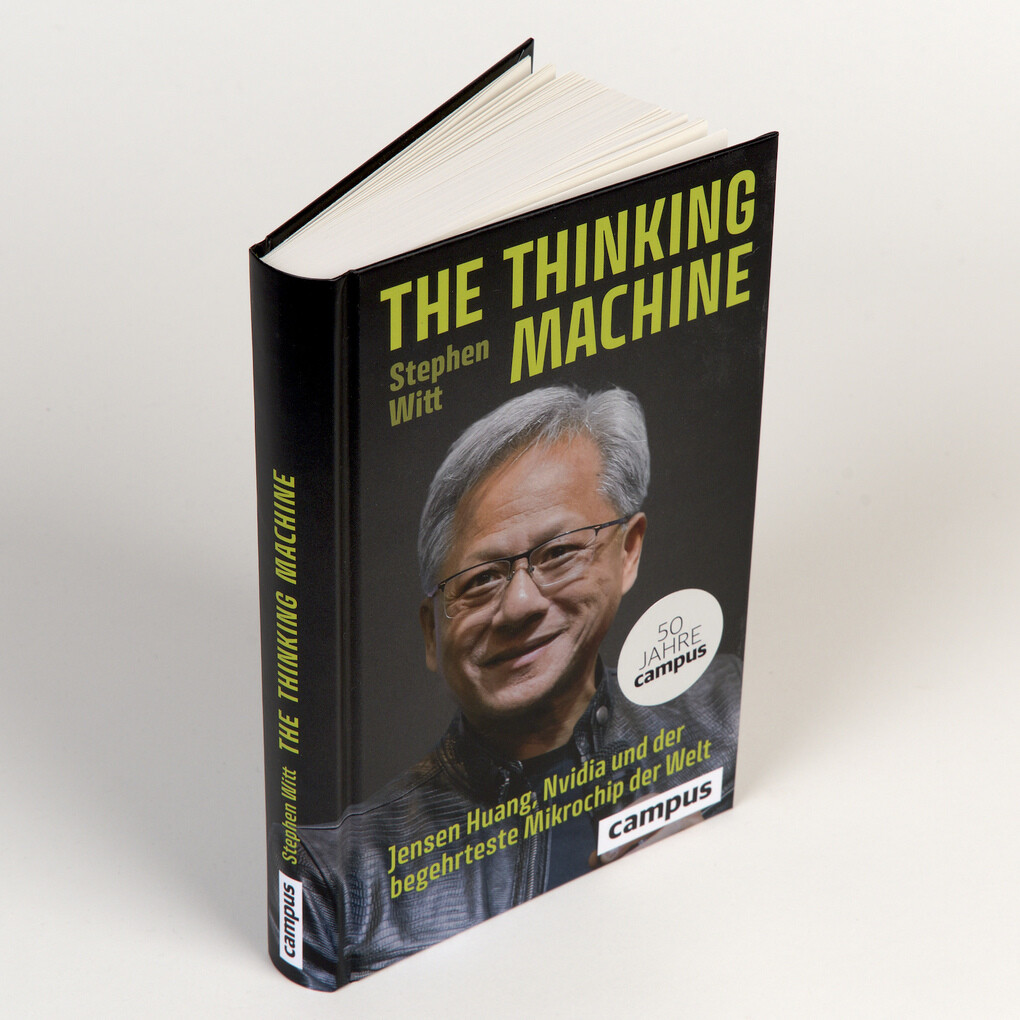Besprechung vom 25.08.2025
Besprechung vom 25.08.2025
Der KI-Flüsterer
Wie Nvidia zum wertvollsten Konzern der Welt wurde
Es ist drei Jahrzehnte her, dass ein kleines obskures Halbleiterunternehmen unter der Firmierung Nvidia aus einem schäbigen Büro am Rande eines Gewerbeparks im kalifornischen Sunnyvale heraus sein erstes Produkt vorlegte: ein Chip namens NV1, der als wahres Multitalent angepriesen wurde. Brachte er doch neben 3D-Grafik auch eine Soundkarte samt Gameport-Anschluss mit. Videospieler sollten damit ihre Geräte ordentlich aufpeppen können. Kunden griffen massenhaft zu. Nach ein paar Wochen aber war klar, der Chip hatte schwerwiegende Fehler. Er renderte nur gekrümmte Oberflächen und war nicht mit einem Tiefenpuffer zum Verstärken und Stabilisieren der Signale ausgestattet. Das ließ auf den Bildschirmen der Spieler die Figuren ungewollt im Boden versinken, Mauern durchlaufen oder gleich ganz von der Oberfläche verschwinden. "Eine Katastrophe", sollte Jahre später der Entwickler Tim Little sagen. Aus Katastrophen aber kann man lernen.
Jensen Huang, Mitgründer und Vorstandschef von Nvidia, nennt den Erfolg seines Hauses einen "auf einer Vision beruhenden Glücksfall". Stephen Witt beschreibt in seinem informativen und anekdotenreichen Buch über den Nvidia-Chef sowohl die Vision wie auch das Glück. Hatten Huang und seine Mitstreiter doch mit der Paralleldatenverarbeitung und ihrem Einsatz in künstlichen neuronalen Netzen zwei Randbereiche der Computerwissenschaften eher zufällig zu dem vereint, was heute als Künstliche Intelligenz beschrieben wird. Und nicht nur das.
Der Chipkonzern hat heute einen Börsenpreis von rund vier Billionen Dollar, das ist fast so viel wie die Jahresleistung der gesamten deutschen Wirtschaft. Über die vergangenen 36 Monate verdoppelte sich sein Umsatz jährlich auf nun 130 Milliarden Dollar. Die durchschnittliche Gewinnmarge liegt bei 66 Prozent. Was heute wie ein kurzer kräftiger Sprint an die Weltspitze aussieht, schildert Witt als einen langen Marsch mit vielen Höhen und Tiefen.
Das Buch beschreibt in 23 flotten und reportagehaften Kapiteln, wie das möglich war: Wie Nvidia in den Neunzigerjahren den harten Wettbewerb der Grafikchip-Anbieter überstand; wie es in den frühen Zweitausendern die Videospielkonsolen von Microsoft mit Chips bestückte; wie Huang Mitarbeiter antrieb und Konkurrenten in die Knie zwang. Zehn Jahre im Geschäft sollte er jenseits der Gamer-Branche neue Kunden finden: Öl- und Wertpapierhändler, Autobauer, Pharmazeuten und Wissenschaftler.
Von 2005 an hatte Nvidia ein Programmpaket namens Cuda entwickelt. Das verschlang zum Ärger vieler Aktionäre über Jahre hinweg große Teile der Konzerngewinne. Doch Cuda konnte eine Grafikkarte in einen Superrechner verwandeln. Wurde es doch als programmierbares Softwarepaket auf die Schaltkreise, Maschinencodes und Compiler der Chips draufgesattelt. Damit bekamen Wissenschaftler aller Fachrichtungen ein neues starkes Werkzeug in die Hand. Als die KI-Forscher um Geoffrey Hinton von der Universität Toronto 2009 ihre künstlichen neuronalen Netze über Cuda laufen lassen wollten und bei Huang um einen kostenlosen Testchip baten, lehnte der noch ab. Als sich drei Jahre später zwei von Hintons Schülern für 500 Dollar zwei Nvidia-Gamingkarten kauften, damit ein synthetisches Neuronennetz von der Größe eines Bienenhirns bauten und ihm erfolgreich Maschinelles Lernen beibrachten, stellten sie in der KI-Forschung alles auf den Kopf - und eröffneten Nvidia einen neuen Markt.
Parallel zur Firmengeschichte erzählt Witt in seinem Buch das bewegte Leben Jensen Huangs. Geboren in Taiwan, war er vom neunten Lebensjahr an in Amerika aufgewachsen und hatte in einer Schule für schwer erziehbare Kinder in Kentucky Englisch gelernt. Er war mathematisch hochbegabt, erhielt ein Stipendium, studierte Elektrotechnik und begann seine Karriere beim Chiphersteller AMD. Nach zwei Jahren baute er für LSI Logic Grafikprozessoren, war mit Ende zwanzig Leiter einer Arbeitsgruppe, heiratete und wurde Vater.
Da LSI seine Chips partout nicht in den schnell wachsenden Gaming-Markt bringen wollte, hob Huang mit seinen Kollegen Chris Malachowsky und Curtis Priem 1993 Nvidia aus der Taufe. Sie brachten 200 Dollar Stammkapital mit, warben 20 Millionen Dollar an Beteiligungskapital ein und gingen an die Arbeit. Dem NV1-Chip sollte der NV2-Grafikbeschleuniger folgen, der zwar nie gebaut, aber von Japans Sega-Gruppe mit einem millionenhohen Anteilszuschuss bezahlt wurde. Dann kamen die Riva- und schließlich die Geforce-Modelle. Nvidia stieg zum Branchenprimus auf und wollte mehr - viel mehr.
Das Start- und Wachstumskapital hat gereicht, um aus einem kleinen Chipbauer das heute wertvollste Unternehmen der Welt zu machen. Huang steuerte Nvidia durch alle Hochs und Tiefs. Besessen von seiner Arbeit und lautstark im eigenen Haus engagiert, senkte er durch innovative Design- und Testmethoden die Produktzyklen, brachte alle sechs Monate neue Grafikkarten heraus, trieb so die Konkurrenz vor sich her, ging mit Nvidia 1999 an die Börse und hielt die Geldgeber der ersten Stunde bis heute an Bord. Mittlerweile tragen Nvidia-Chips Namen wie Blackwell oder Hopper. Sie kosten bis zu 50.000 Dollar das Stück, arbeiten schneller als die Bausteine jedes Konkurrenten und bilden so das Zentrum der über die Menschheit hinwegrollenden KI-Revolution. STEPHAN FINSTERBUSCH
Stephen Witt: The Thinking Machine. Jensen Huang, Nvidia und der begehrteste Mikrochip der Welt. Campus Verlag, Frankfurt/New York 2025, 320 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.