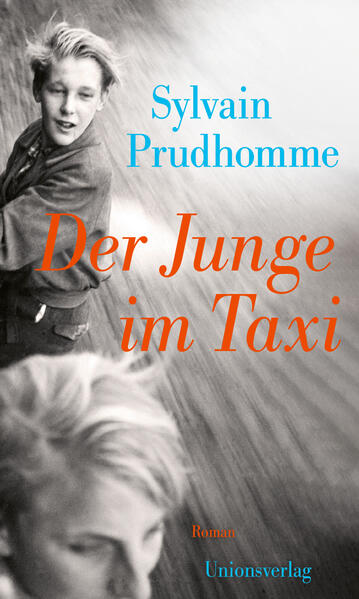Besprechung vom 20.08.2025
Besprechung vom 20.08.2025
Wenn es um Onkel M. geht, schweigen plötzlich alle
Spionagespiel am Bodensee: Sylvain Prudhommes autofiktionaler Roman "Der Junge im Taxi"
Auf dem Cover wird das neue Buch von Sylvain Prudhomme als Roman bezeichnet, aber dass die Geschichte, die "Der Junge im Taxi" erzählt, zumindest autofiktional, wenn nicht autobiographisch ist, ahnt man sofort. Zu viele Parallelen gibt es zwischen dem Autor und seinem Ich-Erzähler Simon, der sich gleich auf den ersten Seiten an ein anderes Buch erinnert, das sein Schöpfer Prudhomme vor mehr als zehn Jahren schrieb: In "Là, avait dit Bahi" (Gallimard), das nur auf Französisch vorliegt, wandelte ein ebenfalls an Prudhomme erinnernder Ich-Erzähler in Algerien auf den Spuren eines Großvaters, der dieses Land vor dessen Unabhängigkeit seine Heimat nannte.
Dieser Großvater, damals wie heute wird er nur bei seinem Familiennamen Malusci genannt, taucht nun wieder auf. Als "Der Junge im Taxi" beginnt, ist der greise Malusci gerade gestorben, die Familie versammelt sich zu seiner Beerdigung und erinnert sich - auch an Dinge, über die lange geschwiegen wurde. Ein Verwandter flüstert Simon beim Totenschmaus zu, Malusci habe neben seinen vier anerkannten Kindern noch einen weiteren Sohn, gezeugt mit einer deutschen, am Bodensee lebenden Frau während der Besatzungszeit. Dieser Sohn wird fortan zum Fixpunkt der Geschichte, die chronologisch erzählt, wie Simon sich ihm nähert - zunächst aus der sicheren Entfernung seines Schreibtischs, wo er auf Google Streetview ein schlichtes Haus am Rand eines Dorfes nahe des Sees als das seines Onkels identifiziert haben will. Später nimmt er seine beiden Kinder mit auf einen Roadtrip nach Deutschland, wo sie gemeinsam die Annäherung an den stets nur "M." genannten Sohn als Spionagespiel inszenieren.
Wirklich weiter kommt Simon erst mithilfe von Louis, seinem über achtzig Jahre alten Großonkel, der anders als die meisten anderen Mitglieder der Familie bereit ist, über M. zu sprechen. Simons Mutter erstickt die aufkommende Erinnerung an die Existenz ihres Halbbruders im Keim. Großmutter Imma, Maluscis Ehefrau und patronne de la famille, droht dem behutsam sich nähernden Erzähler gar, ihn zu verstoßen, sollte er weiter in die familiären Untiefen dringen.
Dieses Schweigen bildet den Glutkern des Buches, wobei Simon, dessen emotionale Erzählweise sich formal in rauschhaften Passagen ohne Interpunktion und in elliptischem Stil übersetzt, über die Schweigenden seiner Familie nicht urteilt. Vielmehr zeichnet er mit psychologisch geschultem Blick die Beweggründe jener nach, die reden, und entwirft auf diese Weise etwa das Porträt eines Großonkels, der, obwohl er im familiären Gefüge eine Nebenrolle einnimmt, zu einer der interessantesten Figuren des Buches avanciert.
Ähnliches lässt sich von Franz sagen, dem angeheirateten deutschen Onkel von Simon, "ein echter Deutscher aus Deutschland mit allem, was das an Exotischem hatte in unserer Familie". Will sagen: ein "glatt rasierter Biertrinker" aus Bayern, "Angestellter der berühmtesten Autofirma jenseits des Rheins", ein "Inbegriff der germanischen Tugenden", zu denen zählen: Gutmütigkeit, Leutseligkeit, sympathische Tölpelhaftigkeit. Über so viele Klischees in einem Buch, das in Frankreich immerhin im Jahr 2023 erschien, mag man nur deswegen hinwegsehen, weil sich der Blick des Erzählers auf diesen Franz im Laufe der Geschichte verändert. Denn Franz ist es, der die Brücke zwischen dem französischen und dem verlorenen deutschen Teil der Familie schlägt, der weiß, dass es sehr viele Kinder wie M. gab, die als vaterlose Bastarde in der Nachkriegszeit unter Bedingungen aufwuchsen, für die man sich an der französischen Mittelmeerküste jedenfalls bis in die Gegenwart dieser Erzählung hinein nicht interessierte.
Dass sich der Erzähler Simon diesem Franz plötzlich näher fühlt als all die Jahre zuvor, hat zwar auch damit zu tun, dass er selbst, Simon, gerade frisch von seiner Partnerin getrennt ist und eine neue Art von Einsamkeit, von Außenseitertum erlebt. Passagen über diese Trennung und ihre Folgen tauchen in der Geschichte immer wieder auf, verleihen ihr eine zusätzliche Melancholie und der Entwicklung Simons eine tiefere Glaubwürdigkeit. Aber die Trauer, auf deren Spuren der Schriftsteller Sylvain Prudhomme seinen Erzähler ansetzt, ist weitaus älter als das Ende von dessen Beziehung. Sie reicht zurück in eine Zeit, die dem Vergessen anheimzufallen droht und die Prudhomme mit seinem eindrucksvollen Buch zurück in die Gegenwart führt. LENA BOPP
Sylvain Prudhomme: "Der Junge im Taxi". Roman.
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer. Unionsverlag, Zürich 2025. 182 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.