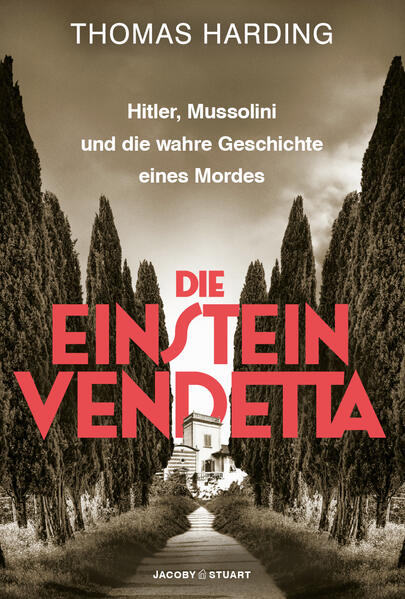Besprechung vom 08.07.2025
Besprechung vom 08.07.2025
Der Nazi-Mord an der Familie Einstein
Thomas Harding beschreibt die spektakuläre Suche nach dem Täter aus dem Jahr 1944
Gerade ist im Verlagshaus Jacoby & Stuart das Buch "Die Einstein-Vendetta. Hitler, Mussolini und die wahre Geschichte eines Mordes" des britischen Autors und Journalisten Thomas Harding erschienen. Aufgeklärt wird ein Ereignis, das sich im Sommer 1944 auf einem Landgut nahe Florenz abspielte. In der Villa Il Focardo wohnte der Elektroingenieur Robert Einstein, Cousin von Albert Einstein, seinerseits Lieblingsfeind von Adolf Hitler. Der Wissenschaftler Einstein ist 6000 Kilometer entfernt in Amerika in Sicherheit. Für den Cousin gilt das jedoch nicht. An dessen Familie rächen sich die Nazis: Robert Einsteins Ehefrau und die beiden Töchter werden in der Villa erschossen; der Ehemann und Vater, der sich in umliegenden Wäldern versteckt, wird depressiv und bringt sich später um.
Bis heute ist unklar, wer die drei Frauen tötete. Harding hat Untersuchungsberichte, schriftliche Zeugenaussagen, Briefe, Fotos und andere Archivdokumente akribisch ausgewertet. Er bat die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) um Einblick in neun Bände Ermittlungsakten, was abgelehnt wurde. Vor dem Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße bekam der Bestsellerautor später recht: Weder der Umfang noch schutzwürdige Interessen Dritter sprächen gegen seinen Anspruch (F.A.Z. vom 14. November 2023).
Aus der Akte stammen die Fotos aus der Villa mit den Einschusslöchern sowie die Bilder des wahrscheinlichen Täters. Harding rekonstruiert die Geschehnisse so: Im August 1944 befinden sich die Deutschen auf dem Rückzug. Alliierte stoßen von Sizilien aus nach Norditalien vor. Bevor die Nazis die Gegend um Florenz verlassen, erledigen sie noch einen Spezialauftrag. Sie suchen den Einstein-Cousin. In der Villa treffen sie Nina, die Frau von Robert Einstein, und die Töchter an. Über den Verbleib ihres Mannes schweigt Nina. Harding beschreibt die Szene: "Die Soldaten waren alle in ihren Zwanzigern und Dreißigern. Ihre Uniformen waren aus graugrüner Wolle und auffallend sauber, als wären sie gerade erst ausgegeben worden. Sie sprachen den befehlshabenden Offizier mit der runden Metallbrille als Hauptmann an. Es gab auch einen jüngeren Offizier, vielleicht einen Leutnant."
Die Frauen werden zunächst im Keller, dann in einem Schlafzimmer eingeschlossen. "Mit ihnen im Raum war ein junger deutscher Soldat. Er war noch nicht wirklich erwachsen; er sah wie ein Junge aus. Er hatte kurze blonde Haare und blaue Augen, stand an der Tür und bewachte den Ausgang. Er hielt eine Maschinenpistole mit wenig Selbstvertrauen, und es schien nicht vorstellbar, dass er sie benutzen könnte." Derweil zerstören seine Kameraden das Mobiliar. Lampen und Spiegel, Kristallvasen und Gläser werden zerschlagen. "Das geliebte Klavier war in Stücke zerbrochen. Das Ölgemälde von Albert Einstein war mit einem Messer zerschnitten." Dann fallen Schüsse. Die deutschen Soldaten gießen Benzin auf Möbel, Fensterrahmen und Türen, bald steht die Villa in Flammen. Ein Zeuge berichtet in Hardings Buch: "Drei Frauen lagen auf dem Boden, mit großen Wunden an den Schläfen, inmitten eines riesigen Blutsees, der bis zur gegenüberliegenden Wand reichte. Ich konnte sehen, dass sie sich umarmt haben mussten, bevor sie von den Maschinenpistolen getroffen wurden, und so fielen sie umarmt zu Boden: die Mutter Nina in der Mitte, Luce, die älteste Tochter, am rechten Arm und Cici, die jüngste Tochter, am linken. Ich stand fassungslos da, atemlos, unfähig, ein Wort zu sagen." Wenige Stunden später stehen amerikanische und britische Soldaten in der Villa. Einer von ihnen entdeckt die Toten und befiehlt einem Kollegen: "Ruft Washington an. Sagt dem Präsidenten, dass die Familie Einstein ausgelöscht wurde."
Erst nach der Jahrtausendwende beginnen ernsthafte Bemühungen, den Täter zu identifizieren. Der italienische Historiker Carlo Gentile recherchiert in Archiven verschiedener Länder. Im Bundesarchiv nimmt er Einsicht in die Truppenbewegungen und Verlustmeldungen für die Toskana im Sommer 1944. Er kann die Täter eingrenzen auf das 104. Panzergrenadier-Regiment. Der Kommandeur hieß Hauptmann Clemens T. Sein Rang stimmt mit den Angaben der Augenzeugen überein. Gentile reicht ein Dossier bei der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg ein. Dort kümmert sich Richter Thomas Will um den Fall und vergibt die Fallnummer 518 AR 257/05.
Es ist einundsechzig Jahre nach den Morden und neunundfünfzig Jahre nach der letzten offiziellen Untersuchung des Falls. In einer Notiz vom 5. April 2005 schreibt Will, dass das Verbrechen "rassistisch motiviert" gewesen sei und gemäß Gentiles Forschung alles auf das 104. Panzergrenadier-Regiment und insbesondere auf Hauptmann Clemens T. hinweise. "Und so begann Richter Will mit seiner Untersuchung. Er stellte ein Team zusammen, und gemeinsam schrieben sie an zahlreiche Militärarchive und baten um Informationen. Sie trugen die Namen der Männer zusammen, die zu der Einheit gehörten, und versuchten, deren Aufenthaltsort ausfindig zu machen; sie besuchten Rathäuser, um Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und andere offizielle Dokumente zu erhalten, sie setzten sich mit Polizeidienststellen in Verbindung und baten um Strafregisterauszüge und Hintergrundüberprüfungen."
Das Ergebnis überrascht die Ermittler: Mindestens zwanzig Mitglieder der Einheit sind noch am Leben. Sogar der Hauptverdächtige lebt noch und wohnt in Speyer. Er wird befragt und bestreitet seine Beteiligung. Für diese Entlastung spricht, dass er nie eine Brille getragen hat, der Täter jedoch schon. Auch die letzten noch lebenden Zeugen identifizierten ihn nicht als Täter. Clemens T. war es also nicht. Im Februar 2011 nutzt die Staatsanwaltschaft einen Aufruf in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Neben unbrauchbaren Hinweisen ruft auch eine Dame an. Sie berichtet von Erzählungen ihres verstorbenen Vaters. Es stellt sich heraus, dass er der Soldat mit den kurzen blonden Haaren und blauen Augen war, der die Mädchen im Wohnzimmer bewachte. Mithilfe seines alten Wehrpasses wird eine Fallschirmjägerbrigade identifiziert, die damals in Florenz war. Verantwortlich für die Brigade war August S. Dieser ist am 26. April 1945 bei Verona gestorben, drei Tage bevor die deutschen Truppen in Italien kapitulierten. Bei weiteren Ermittlungen stellt sich aber heraus: S. kann es nicht gewesen sein.
Nun sind es italienische Behörden, die weiterermitteln. Eine Augenzeugin erkennt einen Offizier namens Johann R. als Täter: "Ich bin mir sehr sicher, dass er der Anführer der Gruppe von Soldaten war, die in die Villa eingedrungen sind. Wenn ich mir einen Hut [eine Schirmmütze] auf seinem Kopf vorstelle, glaube ich ihn wieder vor meinen Augen zu sehen." Doch der führende Militärstaatsanwalt Italiens erkennt eine Demenz bei der Augenzeugin und beendet die Recherchen.
Die bayerische Fernsehjournalistin Barbara Schepanek findet schließlich weitere Indizien. Harding berichtet: "Einige Wochen später war ein lautes Klopfen an der Tür von Johann R. zu hören. Zu diesem Zeitpunkt war er siebenundachtzig Jahre alt, im Rollstuhl und brauchte ständige Pflege. Er lebte mit seiner Frau in Kaufbeuren. Als sie nachsahen, was das für ein Lärm war, waren sie überrascht, eine Gruppe von Polizeibeamten an der Schwelle zu sehen. Die Polizei sagte, dass sie im Rahmen einer italienischen Kriegsverbrecheruntersuchung einen Hausdurchsuchungsbefehl habe. Das Paar war schockiert." Die Durchsuchung dauert mehr als eine Stunde. "Die Polizisten gingen methodisch durch das Haus, untersuchten Kisten voller persönlicher Gegenstände und betrachteten Fotos, aber sie fanden nichts von Interesse und nahmen nichts mit." Im Juni 2011 wird R. von einem Gericht in Rom für seine Beteiligung an einem anderen Massaker zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Deutschland liefert R. allerdings nicht aus. Stattdessen ermittelt nun die Polizei in Kempten wegen des Einstein-Mords. Im Juni 2016 wird das Haus von R. ein weiteres Mal durchsucht, wieder nichts von Interesse gefunden. Inzwischen ist der Verdächtige dement. Die Polizei schließt den Fall. Im Oktober 2019 stirbt Johann R.
Bis heute ist unklar, wer die drei Frauen der Familie Einstein getötet hat. Harding hat eine Vermutung. Dafür, dass Hitler persönlich den Anschlag angeordnet hat, gibt es keine Beweise. In Florenz heißt es bis heute, die Morde seien eine Vendetta gewesen. Harding hat die Historie hervorragend lesbar aufbereitet, berichtet ausführlich und zeigt viel Empathie in diesem Krimi. Er zitiert Robert Einstein, der damals sagte: "Ich werde keine Ruhe finden, bis die Mörder und ihre Handlanger die Strafe erhalten haben, die sie verdienen." Dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung. Inzwischen sind alle Akten geschlossen und alle Zeugen verstorben. Nina war 59 Jahre alt, als sie getötet wurde. Sie wurde allseits als freundlich, großzügig und voller Lebensfreude wahrgenommen. In den letzten schrecklichen Momenten des Lebens hielt sie ihre beiden Töchter fest in ihren Armen. JOCHEN ZENTHÖFER
Thomas Harding: Die Einstein-Vendetta. Hitler, Mussolini und die wahre Geschichte eines Mordes. Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin 2025, 352 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.