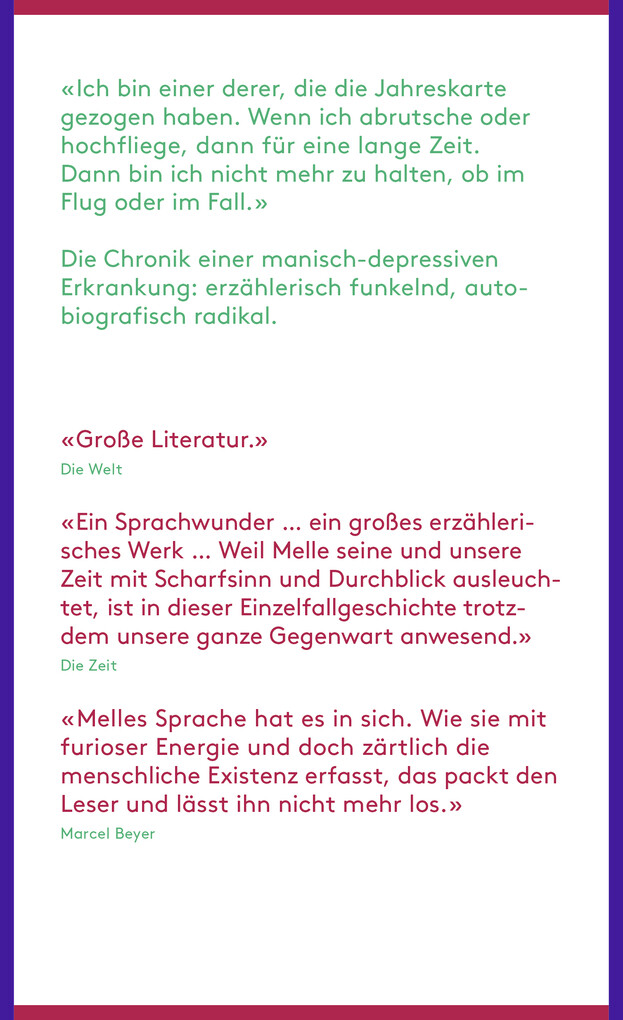Die Chronik einer manisch-depressiven Erkrankung: erzählerisch funkelnd, autobiografisch radikal
»Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr Leben keine Kontinuität mehr. Die Krankheit hat Ihre Vergangenheit zerschossen, und in noch stärkerem Maße bedroht sie Ihre Zukunft. Mit jeder manischen Episode wird Ihr Leben, wie Sie es kannten, weiter verunmöglicht. Die Person, die Sie zu sein und kennen glaubten, besitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich Ihrer selbst nicht mehr sicher sein. Und Sie wissen nicht mehr, wer Sie waren. Was sonst vielleicht als Gedanke kurz aufleuchtet, um sofort verworfen zu werden, wird im manischen Kurzschluss zur Tat. Jeder Mensch birgt wohl einen Abgrund in sich, in welchen er bisweilen einen Blick gewährt; eine Manie aber ist eine ganze Tour durch diesen Abgrund, und was Sie jahrelang von sich wussten, wird innerhalb kürzester Zeit ungültig. Sie fangen nicht bei null an, nein, Sie rutschen ins Minus, und nichts mehr ist mit Ihnen auf verlässliche Weise verbunden.«
Thomas Melle leidet seit vielen Jahren an der manisch-depressiven Erkrankung, auch bipolare Störung genannt. Nun erzählt er davon, erzählt von persönlichen Dramen und langsamer Besserung - und gibt so einen außergewöhnlichen Einblick in das, was in einem Erkrankten vorgeht.
Die fesselnde Chronik eines zerrissenen Lebens, ein autobiografisch radikales Werk von höchster literarischer Kraft.
»"Die Welt im Rücken" ist ein fesselndes Buch ... Melle weiß, wie er die Worte, Sätze und Szenen zu setzen hat. In sehr guter Prosa hat er sein Lebensbuch geschrieben.«
Hamburger Abendblatt
»Das Buch hat mich berührt wie lange keines.«
Tobias Becker, Der Spiegel
»Eine Poetik des Authentischen, ein eindringliches Dokument.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Thomas Melle sprengt alle Muster.«
Zeit online
»Melle beschreibt schonungslos und mit beeindruckender Sprachkraft die bipolare Störung, an der er seit seiner Studienzeit leidet ... Hier haben wir es ohne Zweifel mit großer Literatur zu tun.«
Die Welt
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Eine Poetik des Authentischen, ein eindringliches Dokument. FAZ. NET
Das Buch hat mich berührt wie lange keines. Tobias Becker, Der Spiegel
Ein erschütterndes, komisches, großartiges Buch. Volker Weidermann, Der Spiegel
Ich gratuliere Thomas Melle, ganz gleich, wer den Deutschen Buchpreis erhalten hat, zum besten deutschen Roman der letzten Jahre. Moritz von Uslar
Es ist das Buch eines echten Dichters Seine Sätze können wirklich alles, können warm, flüssig und verletzlich auf der Buchseite liegen oder schon nach dem ersten heißen Kontakt ungeheuer rasch abkühlen und erstarren zu dramatischen Bleigießfiguren im Gedächtnis. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich kann mich nur, auch wenn das kitschig klingen mag, verbeugen vor diesem Talent. Clemens J. Setz
Ein Wahnsinnsbuch, das Gedanken zündet wie leuchtende Petarden. WOZ - Die Wochenzeitung
Thomas Melle ist ein Buch gelungen, das mehr ist, als einfach nur verdammt gute Literatur. Kathrin Wessling, Spiegel Online
Dies ist kein Roman, dies ist das Leben. B. Z.
Blitzhelle Stroboskop-Prosa. Süddeutsche Zeitung
Karl-Ove Knausgard nimmt sich neben Thomas Melle in literarischer Hinsicht fast wie ein Waisenknabe aus. Bei Melle ist all das, was beim Norweger roh und unbehauen bleibt, in eine Form gebracht . . . Das tief beeindruckende Zeugnis der Rückgewinnung von Souveränität über das eigene Leben durch das Erzählen. BR
Ein Sprachwunder . . . ein großes erzählerisches Werk . . . Weil Melle seine und unsere Zeit mit Scharfsinn und Durchblick ausleuchtet, ist in dieser Einzelfallgeschichte trotzdem unsere ganze Gegenwart anwesend. Die Zeit
Ein ungemein berührendes Buch . . . Wer es liest, gewinnt: an Einsicht, an Verständnis, an einer neuen Sicht der fragilen menschlichen Psyche. dpa
Ich habe lange kein Buch gelesen, in dem ich so viel über das Leben gelernt habe . . . Das ist wirklich ein Buch, für das ich dankbar bin. Marie Kaiser, RBB Radioeins
Ein Buch, das sich jeder Einordnung entzieht. Thomas Böhm, RBB Radioeins
Genial, weil wahnsinnig? Das könnte man denken, bevor man den autobiographischen Roman des Manisch-Depressiven liest denn dann wird einem klar: Die Leistung eines Thomas Melle liegt darin, dass er nicht wegen, sondern trotz des Wahnsinns ein Genie ist. ZDF "Aspekte"
Melle beschreibt schonungslos und mit beeindruckender Sprachkraft die bipolare Störung, an der er seit seiner Studienzeit leidet . . . Hier haben wir es ohne Zweifel mit großer Literatur zu tun. Die Welt
Man meint, bisweilen selbst durch alle Höhen und Tiefen mitzugehen - so nahe geht die Lektüre, bei aller reflektierenden Distanz Melles, so wuchtig ist dieses Buch. Der Tagesspiegel
Thomas Melle sprengt alle Muster. Zeit Online
Von einer analytischen Schärfe, der man selten begegnet . . . Große Literatur. Zeit Online
Das ist kein Roman, das ist der Hammer . . . Grandiose Literatur. Berliner Zeitung
Die Welt im Rücken ist ein fesselndes Buch . . . Melle weiß, wie er die Worte, Sätze und Szenen zu setzen hat. In sehr guter Prosa hat er sein Lebensbuch geschrieben. Hamburger Abendblatt
Eines der aufregendsten Bücher des Jahres. Frankfurter Neue Presse
Der Weltliteratur nahe . . . Plastischer war Depression höchstens mal bei David Foster Wallace. Elmar Krekeler, Die Welt
Das eindringlichste Leseerlebnis des Herbstes. Stern
Schonungslos und wortgewaltig. Ein mutiges Buch. Frankfurter Allgemeine Woche
Eine enorme literarische Kraft. Deutschlandfunk
Melles Sprache hat es in sich. Wie sie mit furioser Energie und doch zärtlich die menschliche Existenz erfasst, das packt den Leser und lässt ihn nicht mehr los. Marcel Beyer
 Besprechung vom 16.08.2025
Besprechung vom 16.08.2025
Beten, dass das Fiktion ist
Immer wenn man denkt, Thomas Melles Sterbewunsch-Roman "Haus zur Sonne" sei nicht mehr auszuhalten, kippt er ins phantastisch Lustige: ein vertracktes Meisterwerk.
Obsessiv beschäftigt sich ein Literaturbetrieb, der es besser wissen müsste, in den letzten Jahren wieder mit einer Frage, die man für überwunden hielt: Ist das eigentlich autobiographisch? Angesichts des viel beachteten Depressionsbuchs "Die Welt im Rücken" von Thomas Melle freilich, das 2016 erschien, musste sie gar nicht mehr gestellt werden, denn es war schon vom Verlag ausgewiesen als "autobiographisch radikal", als "Chronik" - und wurde zu einem Schaustück der seither nicht nachlassenden "Memoir"-Mode.
Auf Melles neuem Buch "Haus zur Sonne" steht nun "Roman", aber schon nach wenigen Seiten wähnt man sich in einer Fortsetzung der Chronik, zumal darin von "meinem damaligen Buch über meine bipolare Störung" die Rede ist. Und hofft, ja betet doch bald, dass das, was man gerade liest, Fiktion ist.
Man hofft es nicht nur angesichts der titelgebenden sonderbaren Institution (denn dieses "Haus zur Sonne" ist eine Einrichtung, in der einem sämtliche Wünsche erfüllt werden unter einer Voraussetzung: dass man danach sein Leben beendet). Sondern man hofft es auch angesichts fast jedes Satzes, weil die von einer Bitternis zeugen, die kaum auszuhalten ist. Dieses Buch ist eine 316 Seiten lange Triggerwarnung.
Sein Erzähler ist von allen guten Geistern verlassen, von den meisten ihm früher nahestehenden Menschen sowieso. "Ich war einsam und würde es bleiben. Ich hatte so viel verloren, dass es keinen Sinn mehr hatte, etwas zurückgewinnen zu wollen. Wenn ich mich mit jemandem traf, spielte ich ihm die Rumpfversion des Menschen vor, der ich einmal gewesen war. Mehr ging nicht." Vom Ich-Verlust ist die Rede, und doch äußert das sich aussprechende Ich auf immer neue Weise seinen Wunsch zu sterben.
Am schwersten auszuhalten ist, wie besonnen dieser Erzähler nach einer lange andauernden Phase heftigster Manien und Psychosen trotz gewisser Besserung über sein scheinbar unausweichliches Ende spricht: "Je besser es mir aber ging, desto rationaler und nüchterner traten paradoxerweise die suizidalen Gedanken hervor. Sie waren nicht mehr nur der Verzweiflung gedankt, sondern auch der Vernunft."
Was kann noch kommen, wenn solche Sätze schon zu Beginn eines Buches stehen? Das eben ist die Überraschung: Es entwickelt Spannung und - ja - auch Humor.
Spannung zunächst angesichts der Frage, wie der Erzähler, "pleite und bald wohnungslos", ein "Messie ohne Masse", der auf der ersten Seite die Zusage zur Aufnahme ins "Haus zur Sonne" per Post erhalten hat, dies seinem verbliebenen Umfeld vermittelt. Er wird gebeten, es als Rehabilitationsmaßnahme in einem Sanatorium zu kaschieren. Spannung und Verwunderung auch bei der Beschreibung dieser Einrichtung, auf deren Broschüre der Erzähler beim Arbeitsamt stößt: Ein "Pilotprojekt zur Lebensverbesserung, Traumverwirklichung, Selbstschaffung" soll das sein, gesponsert vom Bundesministerium für Wirtschaft. Als er dessen Räumlichkeiten erstmals betritt, begegnet er einer Empfangsdame wie aus einem Film von François Ozon, einem "Doktor von Radowitz" mit dem "Gesicht eines gealterten Schönlings" und findet einen Bildband über Lars von Trier als "Coffee Table Book" (!) im Warteraum.
Dass das wie Satire wirkt, sieht der Erzähler selbst - um dann aber zu behaupten, es sei die Wirklichkeit. Trotzdem biegt das Buch direkt danach ins Phantastische ab: in eine Welt, die an Science-Fiction-Erzählungen wie "A Clockwork Orange" und "Die Frauen von Stepford", vielleicht auch an solche von Michel Houellebecq oder Christian Kracht denken lässt.
In einem Komplex aus Bungalows rund um einen großen Betonklotz mitten in der Pampa und fern von jedem Handynetz befinden sich weitere Lebensmüde in der absurden Therapie zum Tode. Ihre bislang unerfüllten Wünsche werden ihnen per maßgeschneiderten Halluzinationen erfüllt, mithilfe geheimnisvoller Technik und auch unter Einsatz psychoaktiver Pilze: Jemand spielt plötzlich meisterhaft Violine oder führt Friedensverhandlungen von globaler Bedeutung. Der Erzähler jedoch ist gelangweilt von solchen Klischeevorstellungen und teilt der Leitung bald mit, er sei "hier nicht richtig". Er kenne doch aus seinen Manien schon die "abgefahrensten Szenarien: der Messias sein, weltberühmt sein, verfolgt von Geheimdiensten". So was sei ihm längst zur Wirklichkeit geworden. Wonach ihm denn dann der Sinn stehe, wird der Patient gefragt. Die Antwort: "Sterben, wie immer." An diesem Punkt ist es Melle tatsächlich gelungen, seinem tiefschwarzen Thema Situationskomik abzugewinnen.
Also erst mal sterben lernen in der Halluzination? "Ein Amokläufer kommt, allein für mich. (. . .) Ich bin eine Biene im Bernstein, ein Hai in Formaldehyd." Das verspricht endlich Frieden - doch dann wacht der Patient wieder auf. Es reicht ihm, er will die Institution verlassen. Da wird es unheimlich: Er könne gar nicht gehen, wird ihm mitgeteilt. Er habe ja unterschrieben.
Darf oder muss man hier auch noch Kafka ins Spiel bringen? So ganz fern läge das nicht, aber Melle passt noch eher in eine jüngere literarische Tradition, in die er sich mit diesem Buch einschreibt und dann auch wieder aus ihr heraus: Neben großen Krankheits- und Wahnromanen wie etwa Bernward Vespers "Die Reise" (1977) oder Clemens Setz' "Die Stunde zwischen Frau und Gitarre" (2015) nimmt "Haus zu Sonne" sich zwar kürzer aus, aber nicht weniger gewichtig. Wie bei jenen Büchern wird einen auch hier die Lektüre lange nicht, vielleicht nie wieder loslassen.
Dabei bäumt sich der vorliegende Roman immer stärker gegen den ihm eingeschriebenen Fatalismus auf - erst in der beschriebenen Volte zur Science-Fiction mit humoristischer Note, dann in einer zur Metafiktion, in welcher der Erzähler auf Simulations-Trips seine eigene Lebens- und Werkgeschichte neu durchspielen kann: "Ich schreibe ein Stück über einen ewigen Junggesellen, der sich mit jeder Affäre weiter auflöst." Eine weitere Volte ist die zur Satire auf die Gesellschaft der Selbstoptimierungen. Im "Haus zur Sonne" soll man sich nämlich fortlaufend simulativ verbessern, um endlich sterben zu können - in einer Abwandlung Neil Postmans könnte sein Programm also lauten: "Wir optimieren uns zu Tode."
Je drastischer die Simulationen werden (Sexorgien, aufgefräster Schädel), desto stärker scheint der Roman zu schwanken zwischen der aufscheinenden Möglichkeit einer Heilung mittels Fiktionen und völliger Hoffnungslosigkeit, weil selbst die wildesten davon schon abgenutzt scheinen. Die dramatische Zuspitzung zum Ende hin aber könnte, indem sie die Leser doch noch fiebernd auf eine Rettung hoffen lässt, den schönsten denkbaren performativen Widerspruch erzeugen: ein an "Tausendundeine Nacht" erinnerndes Erzählen zum Überleben, mitten in einem Todesbuch. JAN WIELE
Thomas Melle:
"Haus zur Sonne".
Roman.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025.
316 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.