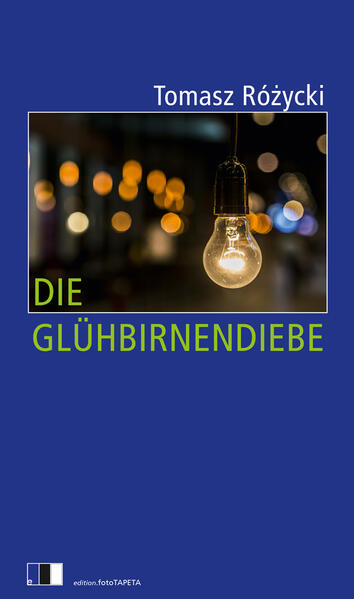
Zustellung: Do, 07.08. - Sa, 09.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Das Leben in einem Wohnblock, einem dieser Meisterwerke von strenger Schönheit in spätkommunistischer Zeit, ist eine wahre Metapher für die Existenz des modernen Menschen. In diesem Zentrum des Universums, im obersten Stockwerk wo der Himmel und der Kakao die nächsten Nachbarn sind lebt Tadeusz. Expeditionen sind für den Jungen nicht einfach, muss man doch lange Korridore durchqueren, die dunkel sind, weil die Gauner ständig die Glühbirnen herausschrauben. Wie soll man da allein durch diese Akropolis aus Beton kommen, wo verborgene Götter auf dich warten
Produktdetails
Erscheinungsdatum
09. Dezember 2024
Sprache
deutsch
Untertitel
Originaltitel: Zodzieje arówek.
Seitenanzahl
224
Autor/Autorin
Tomasz Róycki
Übersetzung
Bermhard Hartmann
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
polnisch
Produktart
gebunden
Gewicht
388 g
Größe (L/B/H)
217/136/24 mm
ISBN
9783949262456
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 09.01.2025
Besprechung vom 09.01.2025
Ohren auf für Klassenkonkurrenten
Poetische Wege aus dem sozialistischen Grau: Tomasz Rózyckis Roman "Die Glühbirnendiebe"
"Radio und Fernsehen - das Fenster zur Welt". Dieser Schriftzug prangt in großen Metalllettern auf dem Dach eines Plattenbaus im oberschlesischen Opole (Oppeln). Eigentlich soll die Propagandabotschaft auch nachts über den Köpfen der Bewohner leuchten, doch die Neonröhren wurden von Unbekannten stibitzt - wie auch die Glühbirnen in den Aufzügen, in den Treppenhäusern und im Gang unter dem Dach, der die einzelnen Gebäudeblocks miteinander verbindet. Angeblich senden die hier installierten Vorrichtungen Fernseh- und Radiosignale in die Umgebung aus, doch sind vielleicht auch Abhöranlagen der Staatssicherheit darunter?
Diese Vermutung hat jedenfalls Tadeusz, der Ende der Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre im zehnten Stock dieses Betonbaus lebt. In Tomasz Rózyckis nun in deutscher Übersetzung erschienenem Roman "Die Glühbirnendiebe" schildert der kindliche autofiktionale Erzähler in beeindruckender Weise einen Alltag im "volksdemokratischen" Polen, der voller Schein und Entbehrungen steckt. Rózycki, 1970 ebenfalls in Opole geboren, zählt zu den namhaftesten zeitgenössischen polnischen Schriftstellern.
Für seinen Protagonisten Tadeusz ist das Radio tatsächlich das Fenster zur Welt. Allerdings nicht so, wie es sich die politische Führung vorstellt: Mit einem sowjetischen Radioapparat empfängt der Junge statt polnischer Programme lieber das amerikanische "Radio Free Europe" und eine in polnischer Sprache produzierte agitatorische Sendung aus dem kommunistischen Albanien.
Im Laden gibt es nach langer Zeit endlich wieder echten Kaffee. Doch die Bohnen, die Tadeusz nach stundenlangem Anstehen ergattert, müssen erst einmal gemahlen werden. So schickt ihn der Vater los, um über den Dachgeschossgang einen Arbeitskollegen, den Handwerker Stefan, zu besuchen, der eine Kaffeemühle besitzt. Dieser Ausflug des Jungen zum Nachbarn bildet die Rahmenhandlung des Romans. Darin verwoben sind in der Art eines mitreißenden Bewusstseins- und Erinnerungsstroms verschiedene Episoden aus Tadeusz' Kindheit und früher Jugend im Block sowie Porträts der verschiedenen Bewohner. Es sind Geschichten, die zwischen grauer Monotonie und verspielter Imagination oszillieren.
Stefans vulgäre Hasstiraden, die vornehmlich den polnischen Ingenieuren gewidmet sind, mit denen er in der Fabrik zusammenarbeiten muss, bringen bei der Lektüre unweigerlich zum Lachen: "Ins All fliegen sie, aber ich wette, auf ihrer Raumstation ist das Klo kaputt, in der Rakete stinkt's, der Kosmonaut muss nach draußen zum Pinkeln, von größeren Geschäften gar nicht zu reden. Und immer ist's zu kalt oder zu warm, wie bei uns im Block." Tadeusz vermutet, inspiriert von seiner Lieblingsradiosendung aus Tirana, Stefan könnte ein Kryptoalbaner sein, denn seine "kompromisslosen moralischen Wertungen und Abrechnungen" entsprächen weitgehend dem, was der Moderator in gebrochenem Polnisch im Radio verkündet.
Der Plattenbau ist gleichsam Abbild der polnischen Gesellschaft: mit Menschen aus verschiedenen Klassen, Staatstreuen und Oppositionellen, die auf engstem Raum zusammenleben müssen. Da aber alle Bewohner gleichermaßen von den Widrigkeiten des staatlichen Missmanagements heimgesucht werden - ständig verstopfen und platzen die Rohre, wegen der Sprengungen in den nahe gelegenen Steinbrüchen ziehen sich immer tiefere Risse durch die Betonwände -, sind sie auf gegenseitige Unterstützung angewiesen.
Tadeusz vermag es, dieser Tristesse poetische Bilder einzuhauchen. Inspiriert von Heraklits Philosophie und antiken Mythen, sieht er überall Götter ihr Unwesen treiben. Sie ergreifen Besitz von den Bewohnern und verleiten sie zu destruktiven Taten - etwa in der Manier des Prometheus zum Feuer zu greifen und Knöpfe im Fahrstuhl anzukokeln. Der Protagonist ist selbst von dieser Pyromanie befallen, baut zusammen mit den anderen Jungen kleine Bomben oder entzündet Flammen auf dem Balkon. Von dort aus glaubt er, wenn die Luft nur klar genug ist, "in der Ferne das von attraktiven Taxifahrern bevölkerte Jugoslawien, das von den Tänzen des Thunfischs aufgeschäumte smaragdgrüne Meer" zu sehen und in großer Entfernung sogar den "Sandkasten der Sahara".
Tomasz Rózyckis lyrische Prosa, seine eleganten Verkettungen von Alltagsbeobachtungen, die der kindliche Erzähler mit überraschenden Deutungen auflädt, hat Bernhard Hartmann meisterhaft ins Deutsche übertragen. "Die Glühbirnendiebe", 2023 im Original erschienen, wurde damals mit dem in 3466 Metern Höhe auf dem Montblanc verliehenen "Grand Continental Preis" ausgezeichnet, der dann 2024 an Martina Hefter ging. Mit dem Preisgeld von 100.000 Euro sollen Übersetzungen von "bedeutenden europäischen Texten" finanziert werden, im Fall der "Glühbirnendiebe" bisher ins Französische, Italienische, Spanische und Deutsche.
Der Roman hat nicht nur das Leben in der Volksrepublik Polen, sondern im gesamten ehemaligen Ostblock zum Thema. Auf Mittel- und Osteuropäer dürfte die Lektüre kathartisch wirken, ihren westlichen Nachbarn die Geschichte näherbringen. Dieses Buch hat das Potential, zum europäischen Klassiker zu werden. YELIZAVETA LANDENBERGER
Tomasz Rózycki: "Die Glühbirnendiebe". Roman.
Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann. Edition.fotoTAPETA, Berlin 2024. 224 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 19.01.2025
Ein amüsantes Sammelsurium an Erlebnissen aus einem polnischen Wohnblock.
Der junge Tadeusz wohnt mit seiner Familie in einem riesigen Wohnblock, mit zig Stockwerken und unzähligen Wohnungen, gegossen aus Beton. Wahre Meisterleistungen der sowjetisch geprägten Ingenieurskunst, errichtet im guten Sinne des verfallenden Kommunismus. Sarkasmus off.
Endlose Flure verbinden die Flügel miteinander, für Tadeusz scheinen sie einer Weltreise nahe zu kommen. Besonders der Korridor im Dachboden, von welchem Türen in schier unüberschaubaren Mengen abgehen, und meistens nur Depots sind für Putzeimer oder sonstigen Utensilien.
Die Familie des Jungen lebt ziemlich weit oben. Dreht unten jemand das Wasser auf, so heißt es erst mal Ebbe. Zuwenig Wasserdruck von den genossenschaftlichen Einrichtungen. Oder auch mal zu wenig Strom.
Am Namenstag seines Vaters (der wie immer groß und pompös gefeiert wird, und alle Nachbarn vorbei kommen) möge Tadeusz doch zu Stefan gehen, um den Kaffee mahlen zu lassen, den sie unter abenteuerlichen und mühsamen, stundenlangen Anstehen ergattert haben. Denn man geht nicht einfach so in den Supermarkt und kauft was man möchte. Nein, es gibt Ausgabekarten, das Angebot divers. Mal Toilettenpapier im Überfluss, Lebensmittel auf das Gramm genau rationiert, selten Kaffee, noch seltener Kubanische Bananen. Erst stehen die Kinder an, die dafür sogar schulfrei bekommen, dann nehmen die Mütter, sobald sie den Haushalt erledigt haben, deren Plätze in der Schlange ein. Es sind tagesfüllende, familienzusammenschweißende Tätigkeiten. Die Gedanken treiben nur um ein Thema: bekommen wir überhaupt noch was oder heißt es just genau vor uns: Sorry, alles weg.
Und während Tadeusz über den langen, meist dunklen Korridor geht, denn die Glühbirnen dort haben nie lange bestand und wechseln sehr schnell die Besitzer, erzählt er uns viel über das Leben im Block. Von den Nachbarn, seine Wickel mit anderen Jungen, natürlich von seiner Familie oder den beiden Töchtern von Stefan, Bermuda und Barrakuda mit Namen.
Der ganze Roman ist ein dichtgedrängtes Sammelsurium aus Erinnerungen und Erlebnissen, wie sie nun mal in so einer Anhäufung menschlichen Daseins vorkommen.
Mit Blicken über die Dachkante in Schule und nahe Seen. Außerdem, so Tadeusz, wenn man gute Sicht hat und genau schaut, kann man wirklich sehr weit sehen. Nach Süden zum Beispiel nach Libyen, oder gar noch weiter. Oder in die andere Richtungen über die Stadtgrenzen sehr weit hinaus.
Der Autor packt hier sehr dicht und konzentriert unzählige Erlebnisse und Schilderungen in diesen Roman, gespickt mit leisen Anspielungen auf den Kommunismus, stets mit einem Augenzwinkern und viel Humor, manchmal bitterböse.
Der Roman ist sehr unterhaltsam, benötigt aber auf Grund der hohen Dichte von Berichten viel Konzentration mit anderen Worten: er liest sich nicht so einfach weg. Manchmal muss man innehalten, verdauen, bis man den mit Informationen gefüllten Kessel leer hat. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, bleibt ein Bild vom Leben im Wohnsilo hängen, das nicht nur einen dunklen Korridor zeigt mit einem Jungen, der eine Blechdose mit Kaffee in den Händen hat und vor unsichtbaren Verfolgern flüchtet, oder einer zunehmend ausschweifenden Familienfeier mit einer Mutter, sich todesmutig auf einen anderen Balkon schwingt, sondern auch ein Abbild der Gesellschaft, und dieses sich hinter der Netzhaut einbrennt.
Gerne gelesen, viel geschmunzelt. Darum: Leseempfehlung für ein kleines literarisches Abenteuer.









