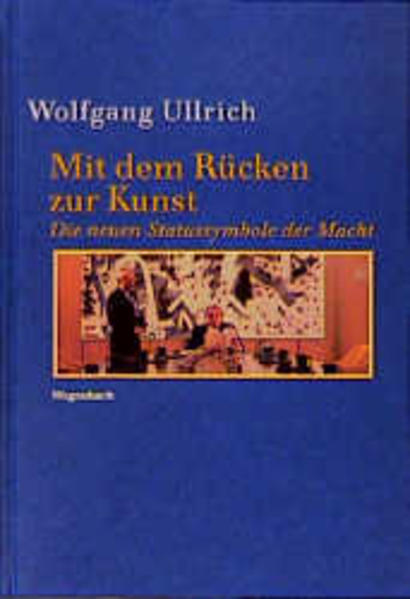
Zustellung: Di, 13.05. - Do, 15.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Wolfgang Ullrich untersucht die merkwürdigen Folgen und Nebenwirkungen eines allzu hohen Kunstbegriffs.
Wo Führungskräfte sich noch vor zwanzig Jahren in gediegenem Mobiliar und mit ebenso gediegenen Ölgemälden abbilden ließen, stehen sie heute vor moderner Kunst.
Moderne Kunst im Umfeld von Geld und Macht: Wie konnte sie zu einem der wichtigsten Statussymbole unserer Zeit werden? Und was sagt dies über die Kunst selbst aus sowie über diejenigen, die sich ihrer bedienen?
Moderne Kunst im Umfeld von Geld und Macht: Wie konnte sie zu einem der wichtigsten Statussymbole unserer Zeit werden? Und was sagt dies über die Kunst selbst aus sowie über diejenigen, die sich ihrer bedienen?
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. Oktober 2000
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
128
Reihe
Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek
Autor/Autorin
Wolfgang Ullrich
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
Zahlr., tls. farbige Fotos und Abbildungen
Gewicht
393 g
Größe (L/B/H)
246/170/15 mm
ISBN
9783803151643
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Der Staat beglückt sichFür Fotomotive wie das rituelle Händeschütteln zwischen dem Bundeskanzler und seinen Staatsgästen wird diese Plastik eine fabelhafte Kulisse abgeben ° und eine, die sich wunderbar ausdeuten lässt: Wie mit bedrohlich gekrümmten Fangarmen, so stehen zwei mächtige Stahlgebilde einander gegenüber. Setzen da Giganten zum Fingerhakeln an? Die spannungsgeladene Doppelskulptur jedenfalls, eine Schöpfung des baskischen Bildhauers Eduardo Chillida, 76, soll in der Berliner Republik nun jene imageprägende Aufgabe übernehmen, die während der späten Bonner Jahre die bronzenen "Large Two Forms" von Henry Moore erfüllt hatten. Auf ungezählten Presse- und Fernsehbildern soll sie demonstrieren, dass, laut Gerhard Schröder, "Kunst neben der Macht stehen kann, ohne sich von ihr in Dienst nehmen zu lassen". Am Mittwoch dieser Woche wird das fast sechs Meter hohe, 90 Tonnen schwere Zwillings-Trumm im Ehrenhof des noch unfertigen Kanzleramts an der Spree enthüllt. So kraftvoll es emporragt: An diesem Platz kann Chillidas schlicht "Berlin" genanntes Werk schon beinahe zierlich wirken. Aus einiger Distanz gesehen, wird es nicht nur vom Gebäude selbst (das im April bezogen werden soll) bei weitem. überragt, sondern auch von 14 Meter hohen steinernen "Stelen", die Kanzleramts-Architekt Axel Schultes vor die Fassade stellt und aus denen auch noch Bäume wachsen sollen: Baumeister-Skulpturen in Konkurrenz zur Bildhauer-Skulptur. Es ist ein nobler, außerdem vielleicht sogar ein geschickter Zug, wenn sich der Staat mit zeitgenössischen Monumenten schmückt ° oder, wie Kultur-Staatsminister Michael Naumann lieber sagt, "beglückt". Demonstrative Nähe zu moderner Kunst, schreibt der Unternehmensberater und Essayist Wolfgang Ullrich in einem neuen Buch, verhelfe Politikern wie Wirtschaftsführern zu einer "vorteilhaften Aura" von "Offenheit" und "Risikobereitschaft". Wer sich etwa mit wilden Bildern im Hintergrund ablichten lasse, der komme geradezu so tatkräftig und kompetent daher wie einst ein Herrscher, der sich vom Hofmaler auf einem wilden Gaul porträtieren ließ. Doch zumindest Plastiken an öffentlichen, gar politisch brisanten Standorten machen heutzutage oft Verdruss. So fand sich 1993 in Berlin für die Gedenkstätte in der Neuen Wache nur die Verlegenheitslösung einer Käthe-Kollwitz-Replik. Voriges Jahr scheiterte die "Philosophin", die Markus Lüpertz vor das Arbeitsministerium stellen wollte, an Beamten-Borniertheit und Sparzwängen. Doch auch mit dem Mutbeweis des Bundesrats, der sich jüngst acht Bronzeplastiken des Dänen Per Kirkeby als "Attikafiguren" auf die Dachkante des einstigen Preußischen Herrenhauses setzen ließ, wird der Betrachter nicht recht froh. Von unten sind fast nur die knubbeligen Silhouetten großnasiger Köpfe erkennbar, und der historische Ort hat den Künstler gar nicht gekümmert: "Da ist ein Gebäude, und da oben steht eben was." Erst recht kann es aber keine Lösung sein, nun etwa den Wünschen des Schriftstellers Rolf Hochhuth nachzugeben und das wilhelminische Bismarck-Denkmal aus dem Tiergarten an seinen ursprünglichen Standort vor dem Reichstag zurückzuholen ° denkmalpflegerisch korrekt, politisch und künstlerisch widersinnig. Mit seiner Pickelhaube, dem verbeulten Kürassierrock und einer schwer vom Postament herabgerutschten Draperie (dem Mantel der Geschichte?) passt der Eiserne Kanzler ganz gut ins grüne Abseits. Vernünftiger wäre es schon, den preußischen Militärreformern Scharnhorst und Bülow, deren klassizistische Marmorstandbilder von Christian Daniel Rauch derzeit in ein Depot verbannt sind, wieder ihre Ehrenplätze vor der Neuen Wache einzuräumen. Wie selbstverständlich steht Chillida über den alltäglichen Querelen und Bedenken. Der betagte Künstler, fast noch eine Figur der klassischen Moderne (obwohl er dem Alter nach Henry Moores Sohn sein könnte), genießt seit langem internationalen Ruhm. Über Jahrzehnte hat er straff gespannte, oft dynamisch ineinander verkrallte Formen erfunden und mit Vorliebe in massivem Eisen ausgeschmiedet; so spiegelt das gewaltsam verformte Material die Energie des Werkprozesses. Souverän inszenierte Chillida 1977 bei seiner Geburtsstadt San Sebastián eine Gruppe zangenartiger, in die Küstenfelsen eingerammter "Windkämme" ° halb archaisches Werkzeug, halb urtümliches Getier. Sie sind Vorläufer der "Berlin"-Skulptur. Für Deutschland hat Chillida unter anderem die Betonplastik "Goethes Haus" in Frankfurt errichtet, in München wartet das stählerne Dreier-Ensemble "Das Licht suchen" auf die mehrfach hinausgeschobene Eröffnung der modernen Pinakothek. Mit "Berlin" ist ihm noch einmal ein Ausdruck dramatisch züngelnder Annäherung, von Kampf oder ° warum nicht? ° Vereinigung gelungen, ohne dass die Form auf eine Bedeutung festzulegen wäre. Ganz unnötig gruselte sich "Bild": "Klauen wie das liebe Vieh" und pries dafür auf einmal Moore: "So sanft gerundet, rheinländisch geradezu." "Dampfhammer-Metaphorik" gegen "wunderschöne, rätselhaft fließende Formen", echote fatal die "Süddeutsche Zeitung". Fließend war, was die Kunst betrifft, tatsächlich der Übergang von einer Regierung zur nächsten. Schon bei Helmut Kohl hatte ein Berater-Kreis offene Ohren gefunden, als er Chillida fürs neue Kanzleramt empfahl. Das Münchner Sammler- und Wohltäter-Paar Rolf und Irene Becker stellte den Kontakt zum Künstler her und trägt nun auch die unbezifferten Millionen-Kosten ° ein Engagement, in dem Naumann die "politische Dimension" des Vorgangs erkennt. Nach dem Regierungswechsel war auch der neue Kanzler sofort von dem Projekt überzeugt. Anfang 1999 ging der Künstler dann an die Entwurfsarbeit, im Sommer desselben Jahres wurden die 80 Zentimeter starken, an zwei Enden zu Viertel-Balken aufgespaltenen Stahlquader in einer Fabrik geschmiedet; mächtige Maschinen waren nötig, um das auf 1200 Grad erhitzte Material zu biegen. Vorigen Monat empfing "Berlin" die Besucher am Tor zu "Chillidaleku" (Raum Chillidas) in Hernani bei San Sebastián ° jenem Skulpturenpark mit Künstler-Museum, der unter Aufsicht der Familie das Vermächtnis Chillidas bewahren soll. Auch Kanzler Schröder kam, gemeinsam mit seinem spanischen Kollegen Aznar und König Juan Carlos, zur Eröffnung. Den Künstler trafen die Gäste in einem Zustand trauriger Verwirrung an ° als zunehmend von Absencen, Gedächtnisstörungen und Depressionen heimgesuchten Menschen, der erklärtermaßen sein "letztes monumentales Werk" (Schröder) vollendet hat. Eine nicht wiederkehrende Chance könnte Chillidas Großskulptur aber auch in dem Sinne sein, dass von der jetzigen Generation der Videokünstler, Performer und Installateure wenig staatstragende, fotofreundliche Monumente zu erwarten sind. In Berlin landete "Berlin", im Morgengrauen des 13. Oktober, erst einmal am falschen Ort. Statt der Baustelle in Reichstagsnähe hatten die zwei Tieflader der spanischen Transportfirma den provisorischen Kanzlersitz angesteuert: das ehemalige Staatsratsgebäude am Schlossplatz. (C) DER SPIEGEL - Vervielfältigung nur mit Genehmigung des SPIEGEL-Verlags
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Mit dem Rücken zur Kunst" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









