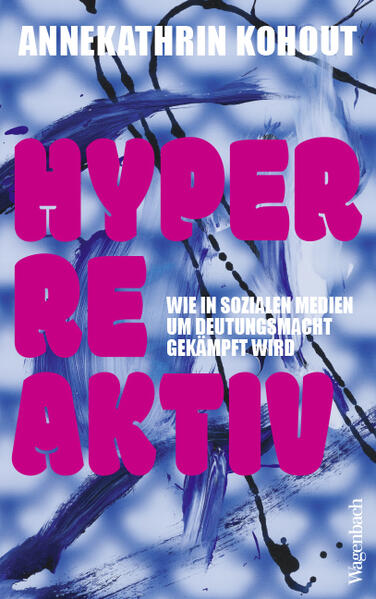Besprechung vom 11.10.2025
Besprechung vom 11.10.2025
Als wäre die Entlarvung die einzig legitime Form des Verstehens
Daumen hoch: Annekathrin Kohout erörtert die Strukturen der Reaktionskultur in den Sozialen Medien.
Von Kai Spanke
Von Kai Spanke
Postet jemand bei Tiktok oder auf der Plattform X eine bedenkenswerte Stellungnahme zu einem politischen Vorgang, die aber kaum Rückmeldungen hervorruft, verschwindet der Beitrag in der Versenkung. Wer dort hingegen irgendeinen Blödsinn verbreitet, der fortwährend gelikt oder kommentiert wird, hat etwas Bleibendes in die Welt gesetzt. Der Urheber des Blödsinns sollte sich jedoch keine Illusionen machen, denn je mehr Aufmerksamkeit sein Blödsinn erhält, desto kleiner wird die Rolle, die er, der Blödsinn, tatsächlich spielt. Was gesagt wurde, ist nicht so wichtig wie der Umstand, dass es gesagt wurde.
Steigt die Zahl der Reaktionen, erhöht sich die Sichtbarkeit des entsprechenden Posts, was wiederum zu weiteren Reaktionen führt. "Der Algorithmus", schreibt die Kulturwissenschaftlerin Annekathrin Kohout in ihrem lesenswerten Buch "Hyperreaktiv", "fungiert hier als eine Art Verstärker von Resonanz, die zur Hauptwährung in der Reaktionsökonomie geworden ist." Während man vor zwanzig Jahren, wenn der Ärger über, sagen wir, die Zeitungslektüre ein problematisches Niveau erreicht hat, zum Leserbriefschreiber wurde, echauffiert man sich heute in der digitalen Öffentlichkeit und also vor einem großen Publikum. Dabei "entwickeln die Reaktionen zunehmend selbst einen Werkcharakter". So hat sich das Kommentarfeld von einem Anhängsel für ein paar Wichtigtuer zu einem prominent platzierten Bereich emanzipiert, in dem sich die Netzwerk-Community austoben, beschimpfen, verachten oder gegenseitig unterstützen kann. Viele User überformen die eigenen Mitteilungen aus gutem Grund: "Wortwitz, prägnante Beobachtungen oder absurde Assoziationen machen solche Kommentare aus, die mehr Resonanz erzeugen als der eigentliche Inhalt."
Wenn nun die online etablierte Feedback-Kultur nicht Qualität oder ein nuanciertes Argument würdigt, sondern vor allem die Reaktionstauglichkeit, werden automatisch jene Inhalte nobilitiert, die uns in Wallung bringen. "Empörung, Angst, Begeisterung" - damit kann man in den Sozialen Medien gut über die Runden kommen. Der Leser soll "getriggert" werden, sich zur Antwort berufen fühlen und dem jeweiligen Plattformbetreiber einen ökonomischen Vorteil verschaffen. Auf Youtube sind Reaktionsvideos ein eigenes Genre. Und reagieren lässt sich auf manches: Musik, Werbung, Mode, Trailer. Teil solcher Clips sind expressive Gesten und Mimik. "Ich ertappe mich manchmal dabei", schreibt Kohout, "wie ich beim Ansehen eines schockierenden Videos instinktiv mitreagiere, obwohl niemand zusieht."
Die Autorin pflegt einen selbstkritischen und deswegen glaubwürdigkeitssteigernden Blick und zeigt an gut gewählten Beispielen aus ihrer Screenshot-Sammlung, wie die Reaktionskultur Missverständnisse befördert. Kern des Essays ist das, was sie "Hyperinterpretation" nennt. Im Gegensatz zu einer auf Nachvollziehbarkeit setzenden, nüchtern-wohlwollenden Deutung, die die eigene historische Situation bedenkt, fördert die im Netz sich Bahn brechende Hyperinterpretation eine antagonistische Diskursform: Indem ich sage, wofür ich bin, sage ich zugleich, was mir stinkt. Die Hyperinterpretation macht Bilder zu "Werkzeugen politischer, unternehmerischer oder persönlicher Interessen", sie "radikalisiert den Verdacht . . . , als wäre die Entlarvung die einzig legitime Form des Verstehens".
Um der Netzgemeinschaft Evidenzerlebnisse zu verschaffen, braucht es nicht viel: "Ein Screenshot, ein roter Kreis um ein 'verdächtiges' Detail, ein suggestiver Kommentar - schon steht die forensische Analyse". Mit einem Vergleichsbild wiederum lässt sich der Eindruck historischer Analogie erzeugen. Ein Diagramm mit Kurven fingiert die Datenanalyse. Wer da nach einem langen Forscherleben mit Studienergebnissen und "peer reviews" ankommt, hat Schwierigkeiten, sich gegen die in fünfzig Sekunden zur Schau gestellte "Kennerschaft" eines minderjährigen Influencers zu behaupten. Die zersetzenden Folgen solcher Zustände sind bekannt, Annekathrin Kohout illustriert deren Mechanismen - Schritt für Schritt und mit Sinn für Anschaulichkeit. Gefällt mir.
Annekathrin Kohout:
"Hyperreaktiv".
Wie in Sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wird.
Wagenbach Verlag, Berlin 2025. 192 S., Abb., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.