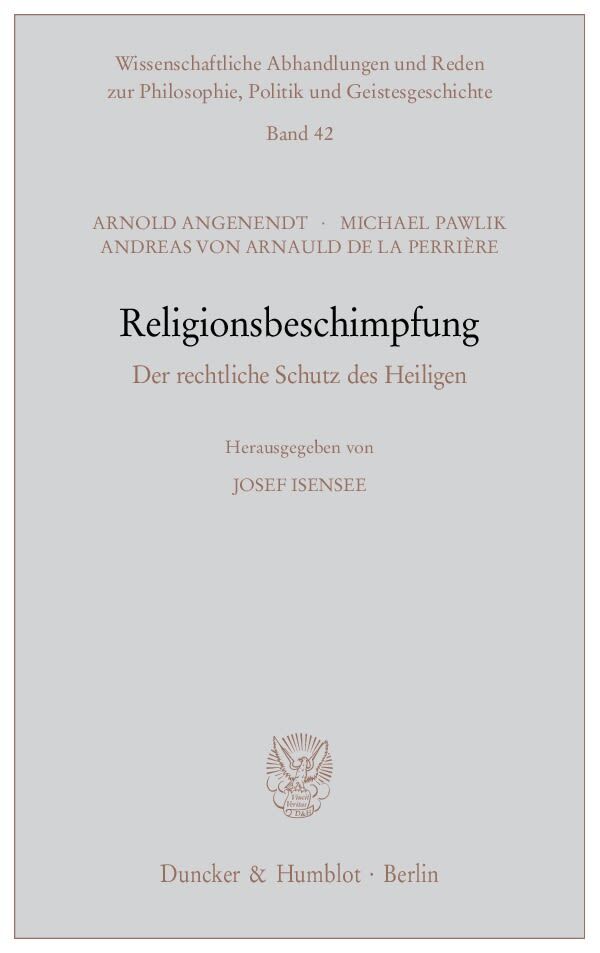
Zustellung: Do, 17.07. - Sa, 19.07.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Gotteslästerung - bislang in europäischen Augen ein atavistischer Tatbestand aus versunkenen, finsteren Zeiten - erlangt jäh schockierende Aktualität, seit sich in der islamischen Welt Massenprotest wider die Beleidigung ihrer religiösen Gefühle durch westliche Medien erhebt und heiliger Eifer in Zorn, Haß und Gewalt entlädt. Die Empfindlichkeit der Muslime, die zu Recht oder Unrecht ihren Glauben geschmäht sehen, kontrastiert der Gleichgültigkeit westlicher Gesellschaften gegenüber der Schmähung des Christentums. Seit der Aufklärung gilt es in "liberalen" Kreisen als Ausweis von Witz und Intellektualität, sich über Christentum und Kirche zu mokieren. "Ecrasez l'infâme" tönt als Parole der Toleranz. Christophobie präsentiert sich heute als politisch korrekt. Der säkulare Staat tut sich schwer, mit rechtsstaatlichen Mitteln religiöse Gefühle zu schützen. Die noch immer geltende Strafdrohung für Religionsbeschimpfung greift praktisch ins Leere. Zwar hat auch die moderne Gesellschaft ihre Tabus. Doch der Schutz religiöser Gefühle gehört nicht dazu. Taugen denn auch bloße Gefühle des einen zum Maß der Freiheit des anderen? Unter den Bedingungen grundrechtlicher Freiheit muß jedermann ein bestimmtes Quantum an lästigem zwischenmenschlichen Verhalten ertragen, an Unmoral und Geschmacklosigkeit, soweit sie nicht in Verletzung von Rechtsgütern umschlagen. Als schutzwürdiges Rechtsgut gilt der innere Friede der Gesellschaft. Folgt daraus, daß, wer die Macht hat, die Straße zu mobilisieren und die Öffentlichkeit einzuschüchtern, die Freiheit aller beschränken darf? Der freiheitliche Staat stößt an die Grenzen seiner Möglichkeiten, wenn er das Heilige schützen soll. Eben deshalb ist es angebracht, diesen Grenzen nachzugehen. Im europäischen Verfassungsstaat verlaufen sie anders als in der Rechtswelt des Islam. Der Zündstoff, der sich wegen dieses Unterschiedes anhäuft, zwingt dazu, das Verhältnis des Verfassungsstaates zum Phänomen der Blasphemie neu zu überdenken. Diese Rückbesinnung führt zu den Fundamenten, auf denen die Kultur des Westens, in ihr sein Rechtssystem, baut. Das komplexe Thema wird aus verschiedenen fachlichen Perspektiven betrachtet, denen der Theologie und der Geschichte, der Staats- und Verfassungstheorie, des Verfassungsrechts sowie des Strafrechts. Aus dem Vorwort des Herausgebers
Inhaltsverzeichnis
Inhalt: A. Angenendt, Gottesfrevel. Ein Kapitel aus der Geschichte der Staatsaufgaben - M. Pawlik, Der strafrechtliche Schutz des Heiligen - A. von Arnauld de la Perrière, Grundrechtsfreiheit zur Gotteslästerung? - J. Isensee, Nachwort: Blasphemie im Koordinatensystem des säkularen Staates
Produktdetails
Erscheinungsdatum
06. Juni 2007
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
140
Reihe
Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesgeschichte
Autor/Autorin
Arnold Angenendt, Michael Pawlik, Andreas von Arnauld de la Perrière
Herausgegeben von
Josef Isensee
Weitere Beteiligte
Andreas von Arnauld
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
188 g
Größe (L/B/H)
210/130/11 mm
ISBN
9783428124916
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"[...] Die Kunst ist frei, auch wo sie in ihrer Unbedingtheit andere verletzt, und sei es in deren religiösem Empfinden. Ein kleines, sehr orientierendes Buch diskutiert das unter dem Titel 'Religionsbeschimpfung. Der rechtliche Schutz des Heiligen'. Und obwohl die Autoren die Sache der Religion mit Anteilnahme betrachten - das Buch ist hervorgegangen aus einer Veranstaltung der katholischen Görres-Gesellschaft -, ist der Befund eindeutig: Die Religion vor öffentlicher Herabsetzung zu schützen ist dem Staat nicht gegeben. Die Freiheit der Meinungsäußerung und der Kunst stehen dem gebieterisch entgegen.
Zwar wird nach Paragraph 166 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis anderer 'in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören'. Aber Verurteilungen nach dieser Norm gibt es so gut wie nicht mehr, und so ist es auch richtig. Verfassungsmäßige Freiheiten können nur durch andere verfassungsmäßige Bestimmungen eingeschränkt werden. Gott und Glauben sind keine derart festgestellten Rechtsgüter. Auch das religiöse Gefühl scheidet in seiner Unbestimmtheit als Grenze aus. Wohl ist die Freiheit des Glaubens und der Religionsausübung grundsätzlich garantiert, aber sie leidet nicht unter Pamphleten. Trotz [...] Mohammed-Karikaturen kann jeder europäische Muslim so fromm sein, wie er mag.
Der Regensburger Strafrechtler Michael Pawlik gibt sehr vorsichtig zu bedenken, ob die Schmähung der Religion nicht den Achtungsanspruch des Gläubigen verletze. Unser Handeln richtet sich nach Normen, und die letzten Normen, denen der Gläubige folgt, die seines Glaubens zu verspotten heißt, ihn selbst zu kränken. Pawlik hält des aber zuletzt doch für falsch, auf diesen Gedanken eine strafrechtliche Ahndung zu stellen: Das Strafrecht übernimmt sich, wenn es sittliche Standards verteidigen will, die in der Gesellschaft keinen Rückhalt mehr haben. Aber seine Argumentation erklärt, warum die Religionsbeschimpfung etwas Ernstes ist, warum die Erregung der Gläubigen verständlich ist und nicht bloß gekränktes Stammeskriegertum." Stephan Speicher, in: Süddeutsche Zeitung, 7. April 2008
"[...] Es ist [...] verdienstvoll, dass Josef Isensee, ein Streiter für eine wirkungsvolle Kultur der Ehre, diesen Band herausgegeben hat, der eine rechtshistorische, eine strafrechtliche und zwei verfassungsrechtliche Analysen des rechtlichen Schutzes des Heiligen gegen Beschimpfungen bietet.
"[...] Andreas von Arnauld de la Perriére und Josef Isensee in seinem Nachwort decken umfänglich und detailgenau die verfassungsrechtlichen Probleme ab. Beide schildern ausführlich die einschlägigen Beispiele von Rushdie über die Fernsehserie 'Popetown' bis zu Papst Benedikt. Sie weisen auf den demographischen Hintergrund der islamischen Kritik am westlichen Meinungsfreiheitsverständnis hin, sensibilisieren für Ehr- und Heiligkeitsansprüche, verweisen aber ebenso deutlich auf die drohende 'Tyrannei des Gruppenveto' (ein Ausdruck von Timothy Garton Ash), die dort einsetzt, wo jede Gruppe die eigene heilige Kuh strafrechtlich außer Kritik stellen will. [...] In Kernpunkten sind [die beiden Verfassungsrechtler] einig: § 166 StGB ist kein scharfes Schwert gegen Religionsbeschimpfung und wird auch keines mehr werden. Wenn, dann ist eine Neubesinnung über Sinn und Zweck des § 166 StGB selbst erforderlich (Pawlik) oder aber wir kämpfen politisch, in der Gesellschaft, fortiter in re, aber suaviter in modo für eine zivilisierte Kultur der Ehre (Isensee) und für eine Inklusion aller Bürger mit ihren unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen (Arnauld). Ein lesenswerter Band, der aufklärt, nicht zuletzt über Stärken und Schwächen der Aufklärung selbst!" Winfrid Brugger, in: Der Staat, 1/2008
Zwar wird nach Paragraph 166 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis anderer 'in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören'. Aber Verurteilungen nach dieser Norm gibt es so gut wie nicht mehr, und so ist es auch richtig. Verfassungsmäßige Freiheiten können nur durch andere verfassungsmäßige Bestimmungen eingeschränkt werden. Gott und Glauben sind keine derart festgestellten Rechtsgüter. Auch das religiöse Gefühl scheidet in seiner Unbestimmtheit als Grenze aus. Wohl ist die Freiheit des Glaubens und der Religionsausübung grundsätzlich garantiert, aber sie leidet nicht unter Pamphleten. Trotz [...] Mohammed-Karikaturen kann jeder europäische Muslim so fromm sein, wie er mag.
Der Regensburger Strafrechtler Michael Pawlik gibt sehr vorsichtig zu bedenken, ob die Schmähung der Religion nicht den Achtungsanspruch des Gläubigen verletze. Unser Handeln richtet sich nach Normen, und die letzten Normen, denen der Gläubige folgt, die seines Glaubens zu verspotten heißt, ihn selbst zu kränken. Pawlik hält des aber zuletzt doch für falsch, auf diesen Gedanken eine strafrechtliche Ahndung zu stellen: Das Strafrecht übernimmt sich, wenn es sittliche Standards verteidigen will, die in der Gesellschaft keinen Rückhalt mehr haben. Aber seine Argumentation erklärt, warum die Religionsbeschimpfung etwas Ernstes ist, warum die Erregung der Gläubigen verständlich ist und nicht bloß gekränktes Stammeskriegertum." Stephan Speicher, in: Süddeutsche Zeitung, 7. April 2008
"[...] Es ist [...] verdienstvoll, dass Josef Isensee, ein Streiter für eine wirkungsvolle Kultur der Ehre, diesen Band herausgegeben hat, der eine rechtshistorische, eine strafrechtliche und zwei verfassungsrechtliche Analysen des rechtlichen Schutzes des Heiligen gegen Beschimpfungen bietet.
"[...] Andreas von Arnauld de la Perriére und Josef Isensee in seinem Nachwort decken umfänglich und detailgenau die verfassungsrechtlichen Probleme ab. Beide schildern ausführlich die einschlägigen Beispiele von Rushdie über die Fernsehserie 'Popetown' bis zu Papst Benedikt. Sie weisen auf den demographischen Hintergrund der islamischen Kritik am westlichen Meinungsfreiheitsverständnis hin, sensibilisieren für Ehr- und Heiligkeitsansprüche, verweisen aber ebenso deutlich auf die drohende 'Tyrannei des Gruppenveto' (ein Ausdruck von Timothy Garton Ash), die dort einsetzt, wo jede Gruppe die eigene heilige Kuh strafrechtlich außer Kritik stellen will. [...] In Kernpunkten sind [die beiden Verfassungsrechtler] einig: § 166 StGB ist kein scharfes Schwert gegen Religionsbeschimpfung und wird auch keines mehr werden. Wenn, dann ist eine Neubesinnung über Sinn und Zweck des § 166 StGB selbst erforderlich (Pawlik) oder aber wir kämpfen politisch, in der Gesellschaft, fortiter in re, aber suaviter in modo für eine zivilisierte Kultur der Ehre (Isensee) und für eine Inklusion aller Bürger mit ihren unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen (Arnauld). Ein lesenswerter Band, der aufklärt, nicht zuletzt über Stärken und Schwächen der Aufklärung selbst!" Winfrid Brugger, in: Der Staat, 1/2008
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Religionsbeschimpfung." und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









