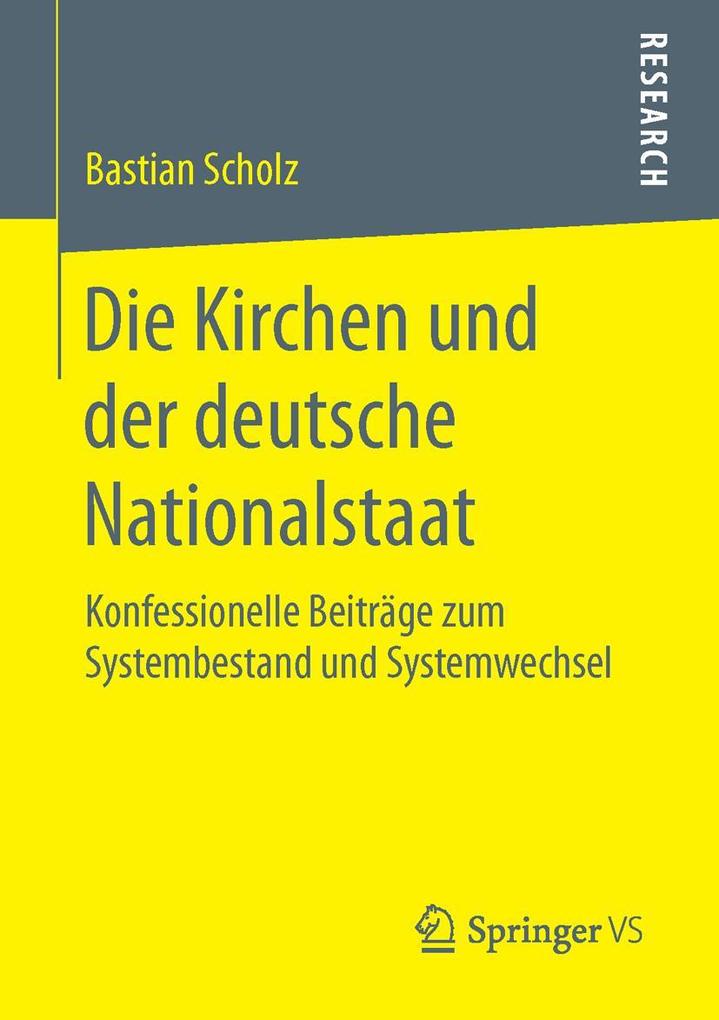
Zustellung: Fr, 11.07. - Mo, 14.07.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Bastian Scholz legt die erste diachrone, konfessionsvergleichende Analyse der staatspolitischen Haltungen beider christlicher Großkirchen in Deutschland vor. Er erörtert ihren Einfluss auf die Stabilität der politischen Systeme des 19. , 20. und 21. Jahrhunderts sowie ihre Rolle während der staatlichen Umbrüche. Für Deutschlands Geschichte war die konfessionelle Spaltung der Bevölkerung ebenso schicksalhaft wie die Vielzahl von Systemtransformationen. Die katholische Kirche pflegte nach 1803 allgemeine Staatsdistanz, war opportunistische wie risikoscheue Wegbereiterin des Verfassungsstaates. Erst im Vaticanum II 1962-65 bekannte sie sich zur Demokratie. Die evangelische Kirche opponierte in Deutschland lange gegen die Demokratisierung und idealisierte die Monarchie bis zur Kirchenspaltung durch Hitler. Mit der Bundesrepublik erwies sich nur jenes System als stabil, das frühzeitig die Loyalität beider Konfessionen genoss.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung. - Theoretischer Bezugsrahmen. - Pfadbeginn: Staatskirchenrechtliche Umwälzungen ab 1803. - Die Kirchen und der Deutsche Bund (1815-66). - Die Kirchen und das Deutsche Kaiserreich (1866/71-1918). - Die Kirchen und die Weimarer Republik (1918/19-33). - Die Kirchen und die nationalsozialistische Diktatur (1933-45). - Die Kirchen und die Bundesrepublik Deutschland (1945/49-90). - Die Kirchen und die Deutsche Demokratische Republik (1945/49-90). - Vergleich des synchronen Pfadverlaufs in Bundesrepublik und DDR. - Die Kirchen und das wiedervereinte Deutschland (seit 1990). - Beitrag der Kirchen zur Systemstabilität im deutschen Nationalstaat. - Schlussbetrachtung.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
16. November 2015
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage 2016
Seitenanzahl
872
Autor/Autorin
Bastian Scholz
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
XXI, 847 S.
Gewicht
1104 g
Größe (L/B/H)
210/148/47 mm
ISBN
9783658115074
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Kirchen und der deutsche Nationalstaat" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.








