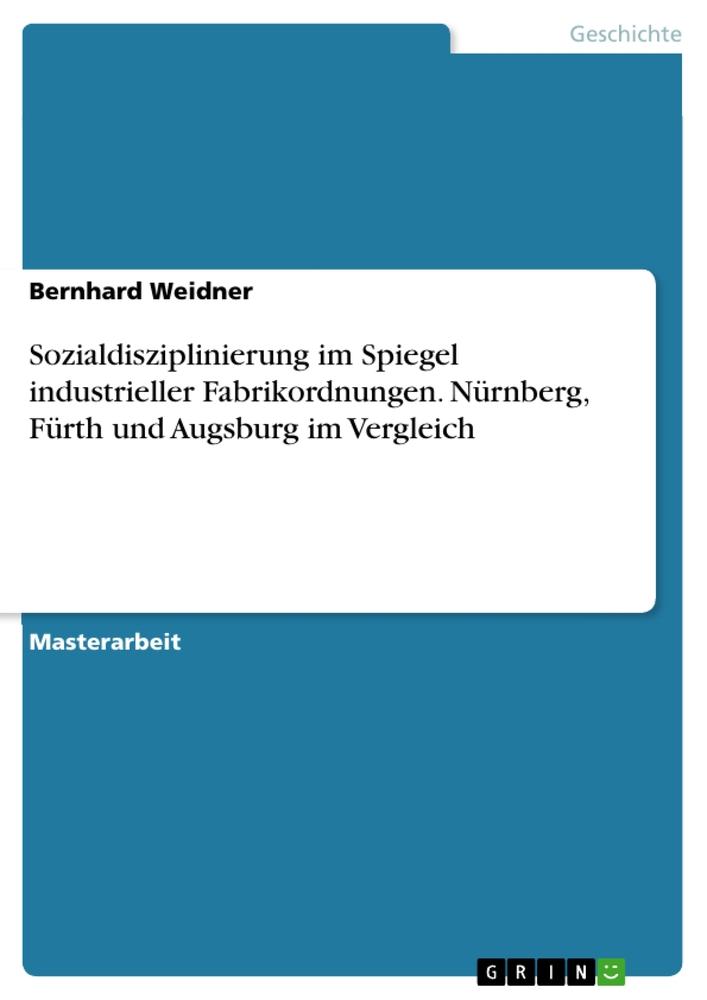
Zustellung: Mo, 26.05. - Mi, 28.05.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Geschichte Europas - Neuzeit, Absolutismus, Industrialisierung, Note: 1, 0, Friedrich-Alexander-Universitä t Erlangen-Nü rnberg (Department Geschichte, Fachbereich und Lehrstuhl fü r Bayerische und Frä nkische Landesgeschichte), Sprache: Deutsch, Abstract: § 20.
Wer wä hrend der Frei-Viertelstunden und wä hrend der Freistunde Mittags ohne Erlaubniß in den Garten geht, wird mit Tag und wer im Garten Vö gel fangt, mit 1 Tag Lohnabzug bestraft.
In obigem auf den ersten Blick amü sant anmutenden Paragraph von 1872 aus den Vorschriften und Anordnungen fü r die Arbeiter der Bleistiftfabrik von A. W. Faber in Stein konstituieren sich die Verhaltensansprü che, die an Fabrikarbeiter des 19. und 20. Jahrhunderts gerichtet waren. Sie sind Ausdruck des groß en sozialen und gesellschaftlichen Umwä lzungsprozesses im Europa dieser Jahrhunderte der Industrialisierung und damit verbundener Normengenese. Der vielschichtige und vieldiskutierte Epochenbegriff Industrialisierung beschreibt die Ausweitung des industriellen Wirtschaftsbereichs in einer Volkswirtschaft im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen wie dem Handwerk oder dem Handel , wie sie fü r den nach heutigem Verstä ndnis deutschen Raum schon vielfach untersucht und dargestellt wurde.
So durchlief Bayern seit 1806 Kö nigreich und vor der Aufgabe sich als souverä ner Staat zu organisieren lediglich eine punktuelle Industrialisierung, die sich primä r auf die groß stä dtischen Rä ume wie Augsburg, Nü rnberg, Fü rth, Hof und Mü nchen konzentrierte. Vor allem ab der zweiten Hä lfte des 19. Jahrhunderts lä sst sich fü r diese Verdichtungszonen ein Ü bergangsprozess von agrarischer hin zu industrieller, technisierter Produktion nachvollziehen, basierend auf Innovationen wie Eisenbahn, Dampfmaschine oder mechanischem Webstuhl.
Natü rlich bedingten diese Verä nderungen im Wirtschaftsbereich auch umfassende Umwä lzungen in Produktion und Arbeitsstruktur, sowie eine Verä nderung der traditionellen Arbeitsgewohnheiten weg von zü nftischem Gewerbe, Manufaktur und Verlagswesen hin zum Fabrikwesen und es entstand die neue Gesellschaftsschicht der Fabrikarbeiter. Die bayerische Fabrikarbeiterschaft in den Industriezentren entwickelte sich als ein Konglomerat von Zuwanderern aus den lä ndlichen Unterschichten, verarmten Handwerkern oder aus gescheiterten Heimgewerben. Anpassungsschwierigkeiten jenes neuen sozialen Milieus der arbeitenden Klasse an die neue Organisationsform Fabrik und damit einhergehende Disziplinprobleme bedingten eine Neustrukturierung der Arbeitswelt, welche sich in sogenannten Fabrikordnungen manifestierte.
Wer wä hrend der Frei-Viertelstunden und wä hrend der Freistunde Mittags ohne Erlaubniß in den Garten geht, wird mit Tag und wer im Garten Vö gel fangt, mit 1 Tag Lohnabzug bestraft.
In obigem auf den ersten Blick amü sant anmutenden Paragraph von 1872 aus den Vorschriften und Anordnungen fü r die Arbeiter der Bleistiftfabrik von A. W. Faber in Stein konstituieren sich die Verhaltensansprü che, die an Fabrikarbeiter des 19. und 20. Jahrhunderts gerichtet waren. Sie sind Ausdruck des groß en sozialen und gesellschaftlichen Umwä lzungsprozesses im Europa dieser Jahrhunderte der Industrialisierung und damit verbundener Normengenese. Der vielschichtige und vieldiskutierte Epochenbegriff Industrialisierung beschreibt die Ausweitung des industriellen Wirtschaftsbereichs in einer Volkswirtschaft im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen wie dem Handwerk oder dem Handel , wie sie fü r den nach heutigem Verstä ndnis deutschen Raum schon vielfach untersucht und dargestellt wurde.
So durchlief Bayern seit 1806 Kö nigreich und vor der Aufgabe sich als souverä ner Staat zu organisieren lediglich eine punktuelle Industrialisierung, die sich primä r auf die groß stä dtischen Rä ume wie Augsburg, Nü rnberg, Fü rth, Hof und Mü nchen konzentrierte. Vor allem ab der zweiten Hä lfte des 19. Jahrhunderts lä sst sich fü r diese Verdichtungszonen ein Ü bergangsprozess von agrarischer hin zu industrieller, technisierter Produktion nachvollziehen, basierend auf Innovationen wie Eisenbahn, Dampfmaschine oder mechanischem Webstuhl.
Natü rlich bedingten diese Verä nderungen im Wirtschaftsbereich auch umfassende Umwä lzungen in Produktion und Arbeitsstruktur, sowie eine Verä nderung der traditionellen Arbeitsgewohnheiten weg von zü nftischem Gewerbe, Manufaktur und Verlagswesen hin zum Fabrikwesen und es entstand die neue Gesellschaftsschicht der Fabrikarbeiter. Die bayerische Fabrikarbeiterschaft in den Industriezentren entwickelte sich als ein Konglomerat von Zuwanderern aus den lä ndlichen Unterschichten, verarmten Handwerkern oder aus gescheiterten Heimgewerben. Anpassungsschwierigkeiten jenes neuen sozialen Milieus der arbeitenden Klasse an die neue Organisationsform Fabrik und damit einhergehende Disziplinprobleme bedingten eine Neustrukturierung der Arbeitswelt, welche sich in sogenannten Fabrikordnungen manifestierte.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
24. Juli 2014
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
260
Autor/Autorin
Bernhard Weidner
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
382 g
Größe (L/B/H)
210/148/19 mm
Sonstiges
Paperback
ISBN
9783656702207
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Sozialdisziplinierung im Spiegel industrieller Fabrikordnungen. Nürnberg, Fürth und Augsburg im Vergleich" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









