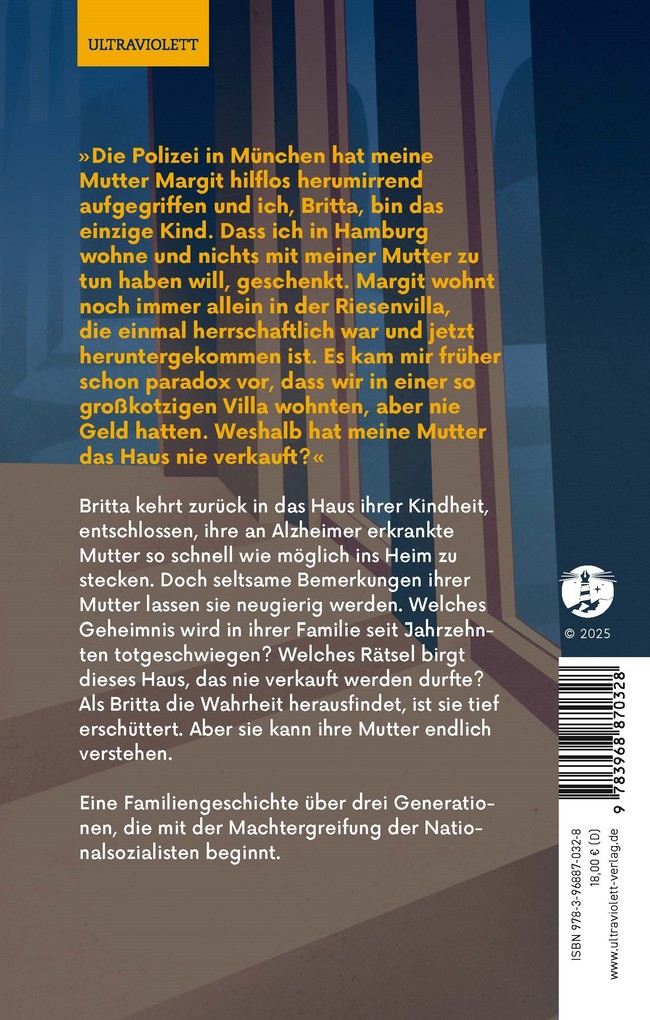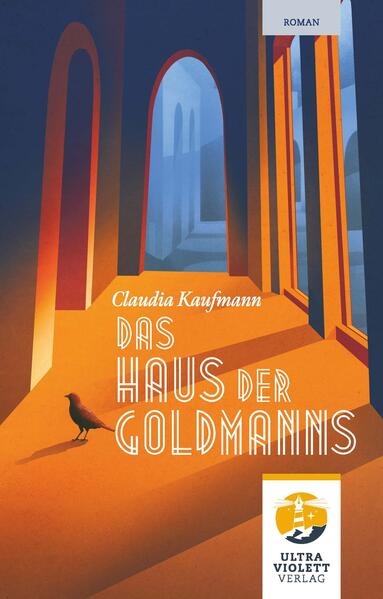
Zustellung: Fr, 23.05. - Mo, 26.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Polizei in München hat meine Mutter Margit hilflos herumirrend aufgegriffen und ich, Britta, bin das einzige Kind. Dass ich in Hamburg wohne und nichts mit meiner Mutter zu tun haben will, geschenkt. Margit wohnt noch immer allein in der Riesenvilla, die einmal herrschaftlich war und jetzt heruntergekommen ist. Es kam mir früher schon paradox vor, dass wir in einer so großkotzigen Villa wohnten, aber nie Geld hatten. Weshalb hat meine Mutter das Haus nie verkauft?
Britta kehrt zurück in das Haus ihrer Kindheit, entschlossen, ihre an Alzheimer erkrankte Mutter so schnell wie möglich ins Heim zu stecken. Doch seltsame Bemerkungen ihrer Mutter lassen sie neugierig werden. Welches Geheimnis wird in ihrer Familie seit Jahrzehnten totgeschwiegen? Welches Rätsel birgt dieses Haus, das nie verkauft werden durfte? Als Britta die Wahrheit herausfindet, ist sie tief erschüttert. Aber sie kann ihre Mutter endlich verstehen.
Eine Familiengeschichte über drei Generationen, die mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten beginnt.
Britta kehrt zurück in das Haus ihrer Kindheit, entschlossen, ihre an Alzheimer erkrankte Mutter so schnell wie möglich ins Heim zu stecken. Doch seltsame Bemerkungen ihrer Mutter lassen sie neugierig werden. Welches Geheimnis wird in ihrer Familie seit Jahrzehnten totgeschwiegen? Welches Rätsel birgt dieses Haus, das nie verkauft werden durfte? Als Britta die Wahrheit herausfindet, ist sie tief erschüttert. Aber sie kann ihre Mutter endlich verstehen.
Eine Familiengeschichte über drei Generationen, die mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten beginnt.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
13. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
348
Altersempfehlung
von 16 bis 99 Jahren
Reihe
Ultraviolett Roman
Autor/Autorin
Claudia Kaufmann
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
358 g
Größe (L/B/H)
187/124/23 mm
ISBN
9783968870328
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
am 11.05.2025
Drei-Generationen-Roman mit noch immer aktueller Botschaft
Britta, die Enkelin und Ich-Erzählerin, wird plötzlich mit der Alzheimer-Erkrankung ihrer Mutter Margit konfrontiert und muss und möchte möglichst schnell eine Lösung, nämlich eine Heimunterbringung organisieren. Britta lebt in Hamburg und ihre Mutter in München und ihre Beziehung ist denkbar schlecht.
Elisabeth, die Großmutter, kommt 1933 mit ihrem Mann vom Land in die Stadt München. Sie wollen fern von der Enge des Dorflebens etwas Neues beginnen. Doch dann kommt Hitler an die Macht und dadurch verändert sich alles.
Margit, die Mutter, kommt 1938 als lang ersehntes Kind zur Welt. In den Wirren des Krieges wird sie jedoch für längere Zeit zu einer Familie aufs Land geschickt und im Sinne des Nationalsozialismus erzogen.
Diese drei Perspektiven, getrennt parallel erzählt, bilden die Grundlage dieses berührenden Buches.
Einfühlsam und ohne Wertung wird die Erkrankung der Mutter beschrieben und auch die Schwierigkeiten im Umgang mit ihr. Für eine Unterbringung ist Geld notwendig.
Zum ersten Mal fragt sich Britta, wieso lebt die Familie in solch einem großen Haus, obwohl sie eigentlich kaum Geld haben. Wieso hat die Mutter es nicht verkauft und weigert sich beharrlich, dieses zu tun? Ganz allmählich nach intensiven Recherchen kommt sie dem Geheimnis auf die Spur und kann die Entfremdung zwischen ihr und ihrer Mutter, aber auch die zwischen Margit und Elisabeth verstehen.
Es gibt ja etliche Familienromane, die das Erleben und die Auswirkungen des Nationalsozialismus beschreiben, aber noch nie habe ich einen gelesen, der das Thema -Wer ist wann unter welchen Umständen an sein Haus gekommen-, anspricht. Ein sehr heißes Thema, das gut in die Debatte um das deutsche Tabu- worüber Familien bis heute nicht sprechen (siehe Spiegel Nr. 19 vom 13.5.2025) passt.
Wieder einmal hat die Autorin von das Fräulein mit dem karierten Koffer ein Buch geschrieben, das ich nicht zur Seite legen konnte, bevor ich es zu Ende gelesen hatte.
am 07.05.2025
großer Familienroman mit wichtiger Botschaft
2023 Britta lebt in Hamburg und hat einen neuen Job in Aussicht, da bekommt sie einen Anruf von der Polizei aus München. Ihre Mutter ist umher geirrt und wusste nicht wo sie hin gehört und so muss sich Britta aufmachen in das große Haus ihrer Kindheit und sich nicht nur ihren eigenen Ängsten stellen, sondern auch der langen Geschichte.
1933 Elisabeth macht sich mit dem Korb Wäsche auf zur Familie Goldmann, hier verdient sie gutes Geld und kann sich so in München mit ihrem Karl eine kleine Wohnung leisten. Sie wollen fern von ihren Familien und der Enge des Dorflebens etwas Neues beginnen und alles läuft auch gut für die Zwei, aber dann kommt Hitler an die Macht und Deutschland verändert sich und für Elisabeth und Karl bricht eine ganz andere Zeit heran und verändert alles.
1938 Margit kommt zur Welt und das in den Wirren des Krieges und das Regime sieht eine enorme Strenge bei der Kindererziehung vor und da die Zeiten unruhig sind, kommt Margit weg von den Eltern und zu einer großen Familie aufs Land und verbringt hier einige Jahre und wird im Sinne des Volkes erzogen.
Drei Frauen, drei Schicksale und alles eng verwoben und ein großes Haus, dass eine enorme Macht hat.
Claudia Kaufmann hat einen großen Familienroman geschrieben, der auch ein Zeitzeugnis ist. Die Deutsche Geschichte ist eng mit dem Roman verwoben und ihre drei Frauenfiguren sind starke Charaktere und Persönlichkeiten, die alle mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben und das Schweigen zieht sich durch Generationen hindurch und verhindert so ein Zusammenleben, ein Verstehen und ein Weiterkommen. Ohne Wertung, aber mit viel Gespür für die Gefühle, die Probleme und Momente, nimmt uns Claudia Kaufmann mit in eine unruhige Zeit, die noch heute nachhallt und die uns eigentlich viel lehren soll. Denn nie wieder, ist jetzt. Das Buch ist groß und verdient ein großes Publikum. Ich packe es in meinen Bücherkoffer und trage die Geschichte von Elisabeth, von Margit, von Britta und die der Goldmanns, sehr gerne in die Welt der Literaturfans hinaus.