Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
15% Rabatt11 auf ausgewählte eReader & tolino Zubehör mit dem Code TOLINO15
Jetzt entdecken
mehr erfahren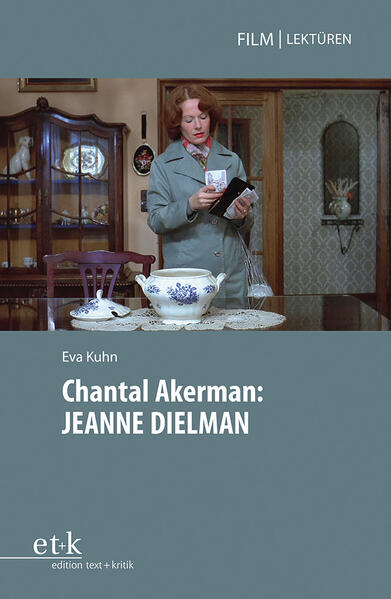
Zustellung: Sa, 23.08. - Di, 26.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
"For the first time in 70 years the Sight and Sound poll has been topped by a film directed by a woman - and one that takes a consciously, radically feminist approach to cinema. Things will never be the same." Laura MulveyIm Dezember 2022 wurde in der alle zehn Jahre stattfindenden Umfrage von Sight and Sound überraschend Chantal Akermans "Jeanne Dielman" (1975) zum "besten Film aller Zeiten" gewählt. Mit ihren rituell ausgeführten, repetitiven Gesten produzieren die Figur Jeanne Dielman und ihre Darstellerin Delphine Seyrig nicht nur ein Bild von sich selbst - ein Bild, das jedem unterstellenden Blick standhält -, sondern machen auch ein in den Privatbereich abgeschobenes Arbeitsfeld öffentlich: die unbezahlte, weil unzahlbare Haus- und Sorgearbeit. Durch eine einzigartige Verklammerung von Film(-arbeit) und Hausarbeit bildet "Jeanne Dielman" ein Bollwerk gegen die Kapitalisierung von Lebenszeit und ermöglicht im geteilten Kinoerlebnis den Fokus auf jene Dinge zu lenken, die den feinen und schließlich entscheidenden Unterschied machen. Insofern hat der Film nichts von seiner damaligen Schlagkraft eingebüßt: "It felt as though there was a before and after Jeanne Dielman just as there had once been a before and an after Citizen Kane" (Laura Mulvey). Im Gegenteil: Die stille Revolution, die der Film anstößt, scheint ihr volles Potenzial erst in der Zwischenzeit entwickelt zu haben.
Inhaltsverzeichnis
1. Eigenzeit und die kooperative Arbeit an der Darstellung einer Frau 7
1. 1. Gestaltungsspielräume wider den »male gaze«: Porträt, Genrebild und Stillleben 11
1. 2. Gegen die Unterstellung von Sichtweisen: Aufmerksamkeit und Nähe statt Identifikation 19
2. Unsichtbares Sichtbarmachen: Das Private ist politisch 30
2. 1. Film- und Hausarbeit: Zeitliche Verbindlichkeit, Serialität und die Logik des Spurlosen 35
2. 2. Die stumme Sprache der Gesten: Hausarbeit und Schauspiel als performative Praxis 45
3. Erhaltung und Entfaltung: Zwei gleichwertige Systeme 56
3. 1. Freigesetzte Zeit: Zeitgestaltungen und die Produktion von Sinn 64
3. 2. Die Verletzlichkeit des Gegenübers: Beziehung und Solidarisierung statt Autonomie 75
4. Register
1. 1. Gestaltungsspielräume wider den »male gaze«: Porträt, Genrebild und Stillleben 11
1. 2. Gegen die Unterstellung von Sichtweisen: Aufmerksamkeit und Nähe statt Identifikation 19
2. Unsichtbares Sichtbarmachen: Das Private ist politisch 30
2. 1. Film- und Hausarbeit: Zeitliche Verbindlichkeit, Serialität und die Logik des Spurlosen 35
2. 2. Die stumme Sprache der Gesten: Hausarbeit und Schauspiel als performative Praxis 45
3. Erhaltung und Entfaltung: Zwei gleichwertige Systeme 56
3. 1. Freigesetzte Zeit: Zeitgestaltungen und die Produktion von Sinn 64
3. 2. Die Verletzlichkeit des Gegenübers: Beziehung und Solidarisierung statt Autonomie 75
4. Register
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. April 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
schwarz-weiße Abbildungen.
Seitenanzahl
90
Reihe
Film|Lektüren
Autor/Autorin
Eva Kuhn
Herausgegeben von
Jörn Glasenapp
Illustrationen
schwarz-weiße Abbildungen
Verlag/Hersteller
Originalsprache
deutsch
Produktart
kartoniert
Abbildungen
schwarz-weiße Abbildungen
Gewicht
146 g
Größe (L/B/H)
226/147/7 mm
ISBN
9783967079975
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Vor 50 Jahren wurde 'Jeanne Dielman' (1975) von Chantal Akerman in Cannes uraufgeführt, im selben Jahr der Verlag edition text+kritik gegründet. Nun ist eine maßgebliche Betrachtung zu jenem 'Meilenstein der Filmgeschichte' erschienen." Jörg Becker, ray Filmmagazin
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Chantal Akerman: JEANNE DIELMAN" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.













