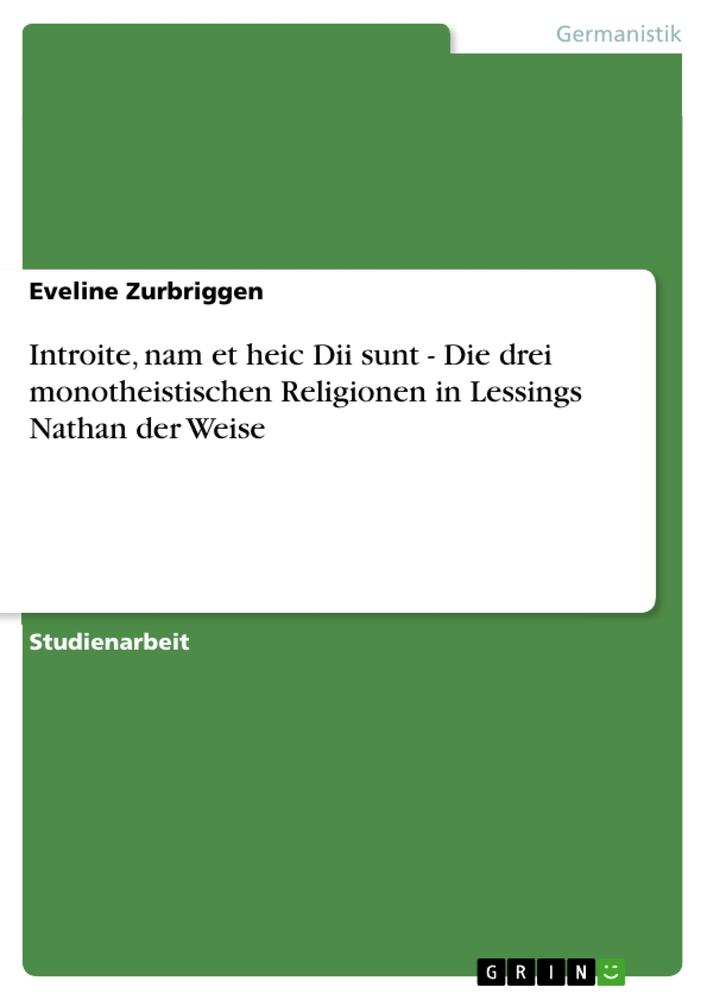
Zustellung: Mo, 26.05. - Mi, 28.05.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Studienarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: sehr gut, FernUniversitä t Hagen (Neuere deutsche Literaturwissenschaft II), Sprache: Deutsch, Abstract: Gotthold Ephraim Lessings Nathan der Weise ist oft als Vermä chtnis eines grossen Aufklä rers bezeichnet worden. Betrachtet man Werke als Klassiker, die zu verschiedenen Zeiten immer wieder die Auseinandersetzung mit ihnen selber und der jeweiligen Gegenwart provozieren, dann kann dieses dramatische Gedicht mit Recht so bezeichnet werden. Es hat in den zwei Jahrhunderten seit seinem ersten Erscheinen 1779 nicht zuletzt wegen den darin angesprochenen religiö sen Aspekten manche Diskussionen angeregt, und es ist sicher kein Zufall, dass der Nathan von den Nationalsozialisten genauso rigoros abgelehnt wurde wie er nach dem Zweiten Weltkrieg quasi als kompensatorische Gegenreaktion auf allen wichtigen Bü hnen gespielt wurde. Ein Aufruf vielleicht zu Vö lkerverstä ndigung und Toleranz - darin liegt auch heute noch seine Aktualitä t, aber auch seine Brisanz.
Lessing zeigt uns die drei monotheistischen Religionen, das Christentum, den Islam und das Judentum, ganz direkt im Wirken und im Charakter der dramatis personae, die bereits im Personenverzeichnis mit ihrer jeweiligen Glaubenszugehö rigkeit ausgewiesen werden. Er lä sst die Figuren also nicht einfach nur ü ber Religion reden, sondern Religion sein. Im folgenden soll deshalb erö rtert werden, wie das Christentum, der Islam und das Judentum - reprä sentiert von den dramatis personae - im Nathan dargestellt werden, in welchem Verhä ltnis sie zueinander stehen (sollten) und welche Rolle dabei die in der Ringparabel entwickelten Ideen spielen.
Lessing zeigt uns die drei monotheistischen Religionen, das Christentum, den Islam und das Judentum, ganz direkt im Wirken und im Charakter der dramatis personae, die bereits im Personenverzeichnis mit ihrer jeweiligen Glaubenszugehö rigkeit ausgewiesen werden. Er lä sst die Figuren also nicht einfach nur ü ber Religion reden, sondern Religion sein. Im folgenden soll deshalb erö rtert werden, wie das Christentum, der Islam und das Judentum - reprä sentiert von den dramatis personae - im Nathan dargestellt werden, in welchem Verhä ltnis sie zueinander stehen (sollten) und welche Rolle dabei die in der Ringparabel entwickelten Ideen spielen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
18. Juli 2007
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
32
Autor/Autorin
Eveline Zurbriggen
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
62 g
Größe (L/B/H)
210/148/3 mm
Sonstiges
Paperback
ISBN
9783638678230
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Introite, nam et heic Dii sunt - Die drei monotheistischen Religionen in Lessings Nathan der Weise" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









