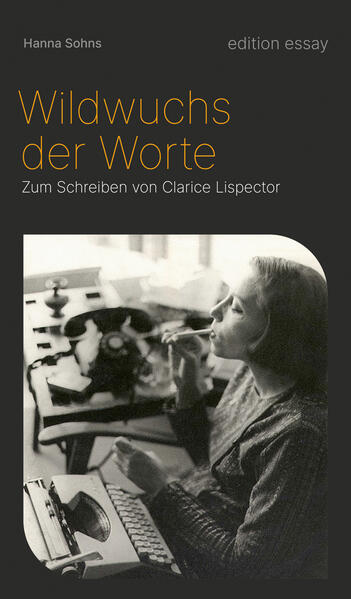Besprechung vom 03.09.2025
Besprechung vom 03.09.2025
Weiblich ist, was in der Mitte zerquetscht wird
Clarice Lispector und die Sache mit den Schaben: "Die Passion nach G. H." und eine Studie zur Autorin
Eine Kulturgeschichte der Kakerlake steht noch aus. An Material bestünde kein Mangel: Küchenschabenwettrennen, heißt es, wurden schon im sechzehnten Jahrhundert veranstaltet. Das jedem geläufige Lied "La Cucaracha" diente Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts als Spottlied auf einen mexikanischen General. Eine große Karriere hat die Kakerlake im Film gemacht, kulminierend in der Riesenschabe aus dem All, die in "Men in Black" alles daransetzt, die Menschheit auszurotten.
In der Literatur wird Kafkas Gregor Samsa von vielen Lesern als Kakerlake wahrgenommen, auch wenn die Bezeichnung in der Erzählung nie fällt. Die brasilianische Autorin Clarice Lispector kannte "Die Verwandlung" zweifellos, als sie 1964 "Die Passion nach G. H." veröffentlichte. Auch bei ihr ist das Insekt Inbild des Grauens und existenzieller Verunsicherung. Lispectors Kakerlake ist, neben der Erzählerin, das einzige Lebewesen in dem Werk. Zumindest auf den ersten Seiten. Dann ist die Schabe tot. Und die Erzählerin, die das Tier in einer Schranktür zerquetscht hat, gerät in eine Art Ekstase: "Diese gelassene Frau, die ich immer gewesen war, war sie vor Lust verrückt geworden? Die Augen immer noch geschlossen, bebte ich vor Jubel. Getötet zu haben - war so viel größer als ich."
So heißt es in Luis Rubys Neuübersetzung des Textes, den "Roman" zu nennen zumindest gewagt ist. In der deutschen Fassung von Sarita Brandt und Christiane Schrübbers aus dem Jahr 1990 ist von einer "besonnenen Frau" die Rede, was überzeugender ist, weil eine "gelassene Frau" gemeinhin mit sich im Reinen ist. Das ist die Erzählerin aber keinesfalls. Die Begegnung mit der Schabe löst etwas in ihr aus; ein Prozess der Zersplitterung und Neufindung wird in Gang gesetzt, eine zweihundertseitige Meditation darüber, wer sie ist und sein kann. Der Anblick der herausquellenden Innereien, die Angst und der Ekel sind dabei so etwas wie der Motor oder besser noch das Schmiermittel der Selbstfindung.
"Die Passion nach G. H." ist ein radikales Buch, in seiner gedanklichen Abstraktion ungeheuer fordernd, teils ins Mystische ausgreifend, ein seinsphilosophisches Werk geradezu, das sich in einem fast leeren Zimmer abspielt. Nur ein Schrank, ein Stuhl und eine Schabe möblieren dieses in seiner Nacktheit fast Beckett'sche Kammerspiel. Ein ontologischer Roman, in dem die Welt nicht vorkommt - keine anderen Menschen, keine Szenen, keine Situationen oder Erinnerungsbilder. "Die Passion nach G. H." ist, weil wir weder etwas über das Leben der Frau noch über ihre Zeit wissen, ein gänzlich ahistorischer Text, auch wenn irgendwann klar wird, dass im Hintergrund der Erschütterung eine Trennung und eine Abtreibung stehen.
Aber selbstverständlich erschien der Roman nicht im luftleeren Raum - man kann ihn in Verbindung bringen mit der damals noch jungen Tradition des französischen Existenzialismus, zumal die Sehnsucht der Erzählerin nach einer Neutralität des Gefühls, der Wunsch nach Ausdruckslosigkeit und Entpersonalisierung an Albert Camus' "Der Fremde" erinnert. Auch die zur gleichen Zeit sich entwickelnde confessional poetry einer Anne Sexton oder Sylvia Plath vollzieht sich im selben Hallraum wie Lispectors Prosa.
Andererseits ist 1964 auch das Jahr des Militärputsches in Brasilien, eine Zeit also, in der sich in Lispectors Heimatland schwerlich so etwas wie ein Gesellschaftsroman schreiben ließ, wollte man nicht einen wichtigen Aspekt der gesellschaftlichen Wirklichkeit - Panzer auf den Straßen - ausblenden. Die gesellschaftliche Realität tritt in "Die Passion nach G. H." in anderer Weise in Erscheinung: "Doch da ist sie nun, die neutrale Kakerlake", heißt es genau in der Mitte des Romans, "ohne Namen aus Schmerz und Liebe. Ihre einzige Unterscheidung im Leben ist, dass sie Männchen oder Weibchen sein musste. Ich hatte sie nur als Weibchen gedacht, denn was in der Mitte zerquetscht wird, ist weiblich."
Der anfängliche Abscheu vor dem Insekt bleibt, doch zunehmend identifiziert sich die Erzählerin mit ihrer zerquetschten Geschlechtsgenossin. Auch ich, schreibt sie, "bin ein Tier aus großen feuchten Tiefen". Sie liebe die Kakerlake, und diese Liebe sei eine Liebe aus der Hölle. Aus Liebe wird Identifikation, und die Identifikation führt zur Inkorporation: Kurz vor Schluss schiebt sich die Erzählerin den aus der zerquetschten Schabe quellenden weißen Brei in den Mund.
Ein schwieriger und widerspenstiger Text also, den Luis Ruby auch im Deutschen in seiner Widerspenstigkeit und begrifflichen Sperrigkeit belassen hat. Ruby hat bereits Lispectors Romane "Der Lüster" und "Der große Augenblick" und - für manche ihr bedeutendstes Werk - zwei Bände mit den gesammelten Erzählungen der 1929 in der Ukraine geborenen und 1977 in Rio de Janeiro gestorbenen Autorin übersetzt. Und in der Edition Text und Kritik erscheint dieser Tage ein großer Essay zum Werk der Autorin: "Wildwuchs der Worte" heißt Hanna Sohms instruktive Studie, in der sie anhand der Romane "Von Traum zu Traum", "Aqua Viva" und eben "Die Passion nach G.H." einem zentralen Moment im Schreiben von Clarice Lispector nachspürt. Lispector, so Sohms, versuche alles, was Form und Begriff ist, zu vermeiden, denn in Form und Begriff sei das Leben eingehegt und jede "sinnliche Lebendigkeit" abgestreift. Das eigentliche Leben fände sich jenseits der Form.
Der "Kern" des Lebens, wenn man so will, ist nicht hart und fest, sondern flüssig und chaotisch. Deswegen spiele die Figur der Qualle in "Aqua viva" eine so wichtige Rolle und mehr noch der weiße Brei aus Innereien in "Die Passion nach G. H.". Die zerteilte Schabe sei Lebendigkeit ohne jede Transzendenz: "Wenn es eine Nähe zur mystischen Literatur gibt, so nur zu einer radikalen Form mystischen Denkens, in der nicht die Erfahrung der Gnade, sondern ihr Fehlen im Zentrum steht." Lispector verfolge nicht das Ziel, die Welt zu ordnen und zu verstehen. Sie wolle, schreibt Sohms, die Dinge vielmehr in ihrer Fragilität und Flüchtigkeit bewahren, statt sie in ein Korsett aus Sprache zu zwingen. Es gehe ihr um den titelgebenden "Wildwuchs der Wörter".
Aber was bleibt, wenn man Sprache ihrer Funktion entledigt, Geschichten zu erzählen, Bilder und Vorstellungen zu fixieren, Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen? Sie wird, so heißt es bei Lispector, idealerweise zu einer "geraden Linie im Weltraum". Am Ende freilich, das lehrt uns zumindest Hollywood, treffen wir auch im All wieder auf nichts anderes als Schaben. TOBIAS LEHMKUHL
Clarice Lispector: "Die Passion nach G. H.".
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Luis Ruby. Penguin Verlag, München 2025.
224 S. geb., 24,- Euro.
Hanna Sohns: "Wildwuchs der Worte". Zum Schreiben von Clarice Lispector.
Edition Text und Kritik, München 2025.
140 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.