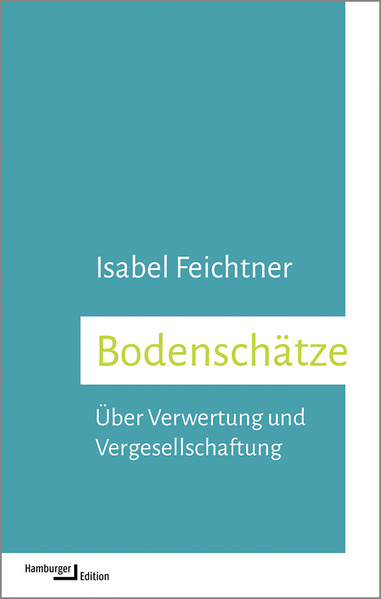Besprechung vom 16.07.2025
Besprechung vom 16.07.2025
Aufruf an die Bodenbewohner
Von Kreuzberg nach Kingston und wieder
zurück: Isabel Feichtner mobilisiert das Recht als Beistand zur Abwehr von Verwertungsinteressen.
In Luis Murschetz' Kinderbuchklassiker über den Maulwurf Grabowski wird der titelgebende Mull enteignet und vertrieben. Die Wiese, auf der er bis eben noch glücklich lebte, wird vom Eigentümer, einem ohnehin über die Erdhügel erbosten Landwirt, verkauft, dann vermessen und schließlich bebaut. Gras, Blumen und Bäume weichen erst Baggern, dann Gebäuden. Vor der drohenden Versiegelung flieht Grabowski über viel befahrene Straßen, doch findet sich am Ende ein neues, noch unzerstörtes Zuhause.
Dass der Bauer das von Grabowski bewohnte Land überhaupt verkaufen kann, ist eigentlich weder selbsterklärend noch alternativlos, sondern Ergebnis der von und für Menschen getroffenen Entscheidung, dass Boden Privateigentum sein kann. Grundeigentum ist gewissermaßen das "Leitbild des Privateigentums", hält die Würzburger Juristin Isabel Feichtner in ihrem Buch "Bodenschätze" früh fest, und dazu bedarf es ausgefeilter Infrastrukturen: Vermessungs- und Verwaltungstechniken münden in Register, Kataster und Flächennutzungspläne, ökonomische und rechtliche Verfahren begründen Preisermittlung und Eigentumsansprüche. Recht und Ökonomie sind einander dabei komplementär: Nicht nur teilen sie ein in aller Regel unreflektiert anthropozentrisches Weltbild, das Rechtsinstitut des Privateigentums schafft auch die Grundlage dafür, dass Boden zu Kapital wird, während die Geldwirtschaft das Mittel bereitstellt, mit dem Ansprüche abgegolten, verrechnet und kompensiert werden können.
Für die Öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht lehrende Juristin sind hierin historisch gleich zwei Fehlentwicklungen angelegt: das Primat individuellen Eigentums vor kollektivem Eigentum einerseits und die Privilegierung menschlicher Bedürfnisse und Wünsche gegenüber der Natur andererseits. Beider nimmt sich Feichtner an, indem sie die Wohnungspolitik in deutschen Städten, zuvorderst die Debatte um die Vergesellschaftung riesiger Wohnungsunternehmen in Berlin, mit der international geführten Diskussion um die wirtschaftliche Nutzung des Meeresbodens und die Rolle der in Jamaika angesiedelten International Seabed Authority verschränkt.
Dass Kreuzberg und Kingston näher liegen, als man annehmen mag, demonstriert Feichtner eindrücklich. Die Juristin ist ebenso vertraut mit der langen ideengeschichtlichen Tradition, die Privateigentum mit individueller Freiheit, Wohlstandsmehrung und sozialer Stabilität korreliert, wie mit den Verschachtelungen (multi)nationaler Konzerne, die aus Wohnraum Assets machen und den völkerrechtlichen Status von Mikrostaaten nutzen, um Zugang zu Manganknollen und anderen Ressourcen zu gewinnen. Die breite Forschung aufnehmend zeigt sie überdies, wie das koloniale Erbe des Völkerrechts unterschiedliche Haltungen zum "Menschheitserbe" Meeresboden erklärt: mal zur Abwehr einer fortgesetzten Politik der Ungleichheit, mal als Argument gegen Belehrungen des globalen Nordens, doch bitte Rücksicht bei der Rohstoffgewinnung walten zu lassen.
In tragischer Weise exemplifiziert dies der Inselstaat Nauru: Erst deutsche Kolonie, dann australisches Mandat, war Nauru lange ein lukrativer Phosphorlieferant, ehe die Vorräte schwanden. Gebeutelt von Finanzkrise und Klimawandel kapitalisiert die dortige Regierung nun die eigene Souveränität, um sich als exterritoriales Flüchtlingslager, Steueroase und Partner für die Ausbeutung des Meeresbodens anzubieten, mit ungewissen Folgen für das Ansteigen des Meeresspiegels, der buchstäblich das Land abzugraben droht. In Kingston warnen die nauruischen Delegierten einerseits vor existenziellen Gefahren, befördern aber andererseits die Dominanz einer Verwertungslogik, die in Boden vor allem potentiellen Profit sieht.
Das Bild, das Feichtner von der Meeresbodenbehörde zeichnet, ist ambivalent. Zwar wohnt ihr seit der epochalen Rede des maltesischen UN-Botschafters Arvid Pardo 1967 das Potential inne, als "planetare Planungsinstanz" einer hemmungslos extraktivistischen Ausbeutung Einhalt zu gebieten. Doch sorgen die stetige Verwässerung ihres Auftrages und die Obstruktion zahlreicher nationaler Regierungen dafür, dass sie eher einer "Bergbaubehörde" mit begrenzter Autorität gleicht. Mehr noch, in Kingston dominieren meist jene Stimmen, die noch in der Bewertung von Umweltzerstörung auf Monetarisierung als unterliegendes Prinzip setzen und damit "die Investoren- und Verwertungsperspektive auf den gesamten Tiefseeboden als Quelle fiktiver Waren und Kapitalanlagen" ausdehnen. Analog gilt dies auch für die Anerkennung indigener Rechte: Werden diese als private Eigentumstitel anerkannt, wird der Boden - ob im Meer oder an Land - verfüg- und damit veräußerbar. Natur wird dann wieder in die Verwertungsdynamik einbezogen, nicht ihr entzogen.
Statt einer solchen Naturkapitalbewertung spricht sich Feichtner für eine Sozialwertberechnung aus, die nicht auf Marktwerte, sondern auf jene Werte abstellt, die erst gemeinsame Nutzung (und Nichtnutzung) generiert. Auch hier führt - und das ist ernüchternd - kein Weg am Geld vorbei: Nur so lässt sich Entscheidungsträgern in Barcelona oder Berlin vermitteln, dass sich ein Park mehr als ein Parkplatz lohnt. Wie dies bewerkstelligt werden kann und welche Rolle dabei das Recht spielt, erklärt der abschließende Teil der Darstellung. Hier wechselt der Ton, die Hoffnung überwiegt: Statt wie Grabowski zu fliehen - und Feichtner gesteht freimütig ein, dass ihr die Idee gelegentlich komme -, ruft sie auf, das eigene soziale, politische und kulturelle Kapital zu nutzen. Das Recht müsse dem Kapital nicht dienen, sondern könne ebenso helfen, gesellschaftliche Alternativen zu ermöglichen.
Was Feichtner vorschwebt, ist nicht weniger als ein Paradigmenwechsel weg von einer im Wortsinne konservativen, hin zu einer "transformative[n] Rechtswissenschaft", welche die Infrastrukturen der Verwertung abzubauen und solche der Commons zu etablieren hilft. Besteht die Rolle der Juristen darin, vorhandene "Gegenrechte" wie den Vergesellschaftungsartikel 15 des Grundgesetzes ebenso wie eher technische Instrumente des Genossenschafts- und des Gesellschaftsrechts zu nutzen, sind es Laien, also Bodenbewohnerinnen, deren Rechtspraxis zum emanzipatorischen Projekt wird. In diesem letzten Teil tritt der globale dann doch hinter den lokalen Aspekt zurück; small is still beautiful, und der Widerstand gegen Verwertungslogiken erscheint im Konkreten machbarer.
Das alles wird präzise dargelegt, mit scharfem juristischem Sachverstand, naturwissenschaftlicher Neugier und historischer Sensibilität. Zugleich meistert Feichtner die in ihrer eigenen Person angelegten Perspektivwechsel, wenn sie auf drei Ebenen agiert: als Akteurin (die Mieterin), als Beobachterin erster Ordnung (die Hochschullehrerin und Sachverständige) und als Beobachterin zweiter Ordnung (die Kommentatorin ebendieser Expertise), ohne sich in diesen verschiedenen Rollen zu verheddern. Feichtners Buch ist engagierte Literatur im besten Sinne: aus Überzeugung motiviert, glänzend argumentiert und stets einleuchtend. Weder ökonomische noch rechtliche Strukturen folgen schließlich unverrückbaren Gesetzmäßigkeiten, sondern sind Resultat von kontingenten Entscheidungen. Darin folgt die Juristin Torben Kuhlmanns "Maulwurfstadt", einem jüngeren Echo der Murschetz'schen Parabel. Hier sind es die anthropomorphen Maulwürfe selbst, deren unersättliche Suche nach Bodenschätzen Grabowskis Wiese zerstört. Am Ende stellt sich Einsicht ein, doch erst auf der allerletzten Seite. Feichtners Buch lieferte überzeugende Argumente, nicht so lange zu warten. KIM CHRISTIAN PRIEMEL
Isabel Feichtner: "Bodenschätze". Über Verwertung und Vergesellschaftung.
Hamburger Edition, Hamburg 2025.
304 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.