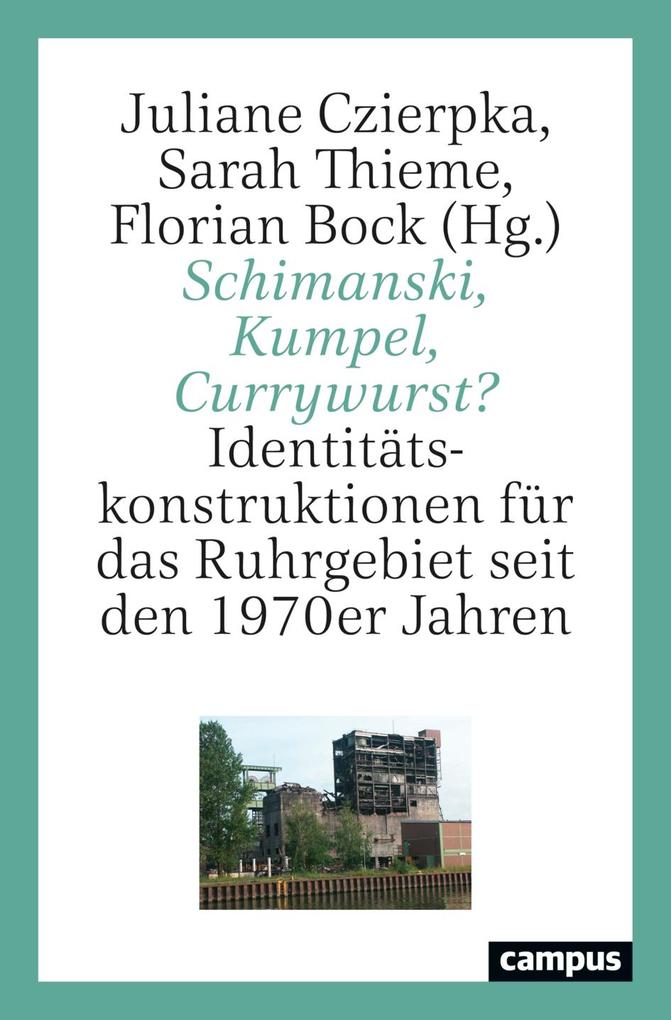
Zustellung: Di, 13.05. - Do, 15.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Jenseits der Klischees von Schimanski, Kumpel und Pommes-Currywurst bleibt die Identität des Ruhrgebiets und seiner Bewohner:innen merkwürdig blass. Dass es hier eine Pluralität von vordergründig sichtbaren oder versteckten Identitäten gibt, legen die Beiträge dieses interdisziplinär angelegten Bandes aus der Perspektive der Geschichts- und Politikwissenschaft, der Kulturwissenschaft sowie der Theologie offen. Im Zeitraum »nach dem Boom« der 1950er- und 1960er-Jahre entfalteten sich hier - so die These - um die Kern-Identität des schwer malochenden Kumpels unter Tage Teilidentitäten, die in ihrem Kern zwar noch eng mit Bergbau und Stahlindustrie verwoben waren, sich aber in »Subkulturen« wie Sport, Musik, Kunst oder Religion zeigten. Entstehungszeitraum dieser Identitäten waren die 1970er Jahre: eine Zeitspanne, in der die Deindustrialisierung des Ruhrgebiets schon seit einigen Jahren lief, nun aber weitreichende Transformationen - etwa eine erhöhte Arbeitslosigkeit oder der Ölpreisschock - hinzukamen, die das Ruhrgebiet als einst wichtigste Montanregion Europas vor besondere Herausforderungen stellten.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. Juli 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
369
Autor/Autorin
Juliane Czierpka, Sarah Thieme, Igor Birindiba Batista, Florian Bock, Stefan Berger
Herausgegeben von
Juliane Czierpka, Sarah Thieme, Florian Bock
Unter Mitwirkung von
Igor Birindiba Batista, Florian Bock, Stefan Berger, Juliane Czierpka, Johanna Danhauser, Stefan Goch, Anja Junghans, Fabian Köster, David Rüschenschmidt, Marco Swiniartzki, Sarah Thieme, Lea Torwesten, Helen Wagner, Julia Wambach, Constanze von Wrangel
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
459 g
Größe (L/B/H)
213/142/30 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783593519449
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 26.02.2025
Besprechung vom 26.02.2025
Unter Malochern
Ein Band fragt nach den Identitäten des Ruhrgebiets
Die immer dickeren und bunteren Bücher über das Ruhrgebiet, wie etwa zuletzt "RuhrGold" (F.A.Z. vom 14. Januar), zeigen es an: Das Revier sucht neue Bilder, die Fotografien von rauchenden Schloten und glühenden Hochöfen gehören, im Jahr sieben nach Schließung der letzten Zeche, der Vergangenheit an und treffen keine Gegenwart mehr. Es geht um beides, um Außen- und Innensicht, Imagebildung und Selbstbewusstsein. Dahinter steht die Frage der Identität, das Gummiwort wird gedehnt und strapaziert.
Stefan Berger schlägt, mit Stuart Hall, vor, "Identität" durch "Identifikation" zu ersetzen, da dieser Begriff "ein höheres Moment an Selbstreflexivität" habe und sich "seiner eigenen Konstruiertheit bewusst" sei. Die "Meistererzählung", die sich im Verlauf der IBA Emscher Park (1989 bis 1999) verstärkt und seitdem verfestigt habe, stelle Industrialisierung und Deindustrialisierung in den Mittelpunkt und reduziere das Ruhrgebiet auf seine Montangeschichte; Mittelalter und frühe Neuzeit kämen so wenig vor wie andere Industrien (Chemie, Textil, Glas), Kapitalismuskritik werde historisiert, die destruktive Energie des technologischen und wirtschaftlichen Fortschritts marginalisiert, der "Wert der Solidarität" einseitig entpolitisiert, Kontinuitäten zwischen nationalsozialistischer und bundesrepublikanischer Gesellschaft ausgeklammert und der zunehmend beliebte Heimatbegriff unkritisch adoptiert.
Berger, Leiter des Instituts für Soziale Bewegungen in Bochum und so etwas wie der Chefhistoriker des Ruhrgebiets, fordert, die Meistererzählung zu pluralisieren und auch "vergangene Zukünfte" (Reinhart Koselleck) in den Blick zu nehmen, wobei die Dekonstruktion mit jenen Akteuren beginnen sollte, die für die homogene Erzählung verantwortlich zeichnen und sie festschrieben: Künstler, Akademiker, Intellektuelle. Die "Vervielfältigung der Geschichten" müsse die "Gastarbeiter" und auch Arbeiterinnen, vor allem der Textilindustrie, umfassender wahrnehmen. Diskursiv wie auch politisch seien, so Berger, agonistische Formen des Erinnerns geboten.
Was Berger umreißt, liest sich wie eine Einführung: "Welche Vergangenheits- und Zukunftserzählungen braucht die Gegenwart des Ruhrgebiets?" Doch diese Frage eröffnet nicht, sondern beschließt den Sammelband, der sich der "seltsam unbestimmten Identität" jenseits der Stereotype von "Schimanski, Kumpel, Currywurst" annähert, indem er spezifische Entwürfe aus verschiedenen Bereichen auffächert: Ausgehend von Oral-History-Interviews sondiert Constanze von Wrangel, wie individuelle Lebenswege mit Orten der Industriekultur verknüpft werden; Stefan Goch erklärt, wie Museumsleute zu erinnerungspolitischen Akteuren werden (können); Helen Wagner zeigt auf, wie die Industriegeschichte seit den späten Achtzigerjahren imagepolitisch funktionalisiert wurde und sich für eine Vereinnahmung durch rechte Gruppen öffnete; und Julia Wambach zeichnet nach, wie Schalke 04 sich erst während der Deindustrialisierung auch aus kommerziellem Kalkül als "Kumpel- und Malocherclub" inszenierte.
Einblicke in die männlich geprägte Metal-Szene im Revier gibt Marco Swiniartzki; Johanna Danhauser begreift das Fortleben der bergmännischen Chorkultur als performative Musealisierung, Fabian Köster arbeitet heraus, wie die Ausstellung "Kunst der 60er Jahre in Gelsenkirchen" 1988/89 die Polarität von Krise und Prosperität spiegelte, Lena Torwesten untersucht, wie sich das Narrativ des "Arbeiterbistums" Essen auch ohne Arbeiter mit neuen Inhalten füllte und die Nähe zur Lebenswelt bewahrte; David Rüschenschmidt nimmt den christlich-islamischen Dialog im Ruhrgebiet als Ausweis für eine weitgehende Integration der religiösen und kulturellen Vielfalt.
Es ist bemerkenswert und mag erstaunen, dass Traditionen der sogenannten Hochkultur als identitätsstiftende Faktoren so gut wie keine Rolle spielen. "Wandel durch Kultur - Kultur durch Wandel", das Motto der Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010, findet kein Echo, Folkwang-Museum oder Aalto-Oper kommen nur am Rande vor, das Schauspielhaus Bochum, seit jeher Stolz der Stadt, wird nicht einmal erwähnt. War das Ruhrgebiet da vielleicht schon einmal weiter? "Bochums Dreiklang - merk ihn Dir: Kohle - Eisen - Schlegel-Bier!" Als eine lokale Brauerei in den Sechzigerjahren damit warb, kursierte, auf den Intendanten des Schauspielhauses gemünzt, eine kulturelle Variante: "Bochums Dreiklang - merk ihn Dir: Shakespeare - Schalla - Schlegel-Bier!" ANDREAS ROSSMANN
"Schimanski, Kumpel, Currywurst?" Identitätskonstruktionen für das Ruhrgebiet seit den 1970er Jahren.
Hrsg. von J. Czierpka, S. Thieme und F. Bock. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2024. 369 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Schimanski, Kumpel, Currywurst?" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









