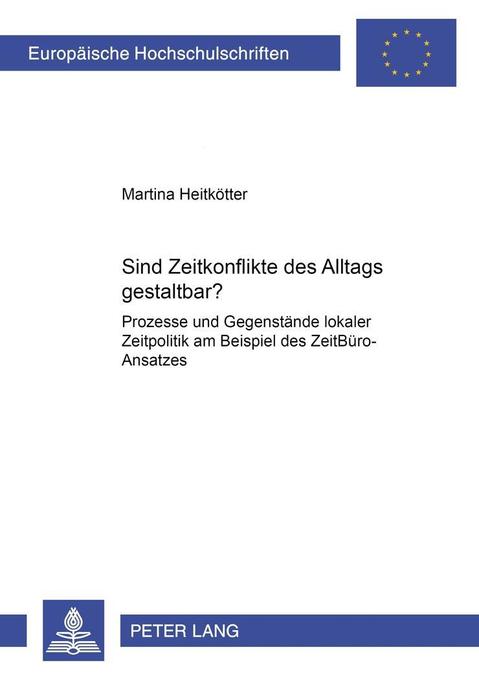
Zustellung: Fr, 16.05. - Mo, 19.05.
Versand in 4 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Zeit wird vor allem im Alltag zunehmend als Konflikt erfahren. Gesellschaftliche Zeitstrukturen, private Lebensverhältnisse sowie Arbeitsbedingungen haben sich tief greifend gewandelt. Dort, wo die veränderten Alltagsanforderungen an inadäquate, unabgestimmte Zeitstrukturen und Dienstleistungen im lokalen Nahraum stoßen, brechen Zeitkonflikte auf. Diese gehen hauptsächlich zulasten der Individuen und werden häufig als Zeitnot erlebt. Neue Ansätze kollektiver und demokratisierter Zeitpolitik vor Ort sind gefragt. Am Beispiel des ersten deutschen ZeitBüros in Bremen-Vegesack untersucht die Studie die Bestimmungsfaktoren lokaler Zeitkonflikte sowie die Prozessbedingungen einer örtlichen Zeitgestaltung, die sich an den Zeitinteressen des Alltags ausrichtet. Der gewählte demokratietheoretische Zugang sieht in diskursiv-kooperativen Politikformen sowie in zivilgesellschaftlicher Artikulation lebensweltlicher Interessen neue Bewältigungschancen. Perspektivisch werden neue konzeptionelle Pfade einer an Zeitwohlstand orientierten Zeitpolitik formuliert.
Inhaltsverzeichnis
Aus dem Inhalt: Problemaufriss: Wandel gesellschaftlicher Zeitstrukturen, private Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen Neue Formen gesellschaftlicher Konfliktbearbeitung Demokratietheoretische Einordnung Begriffslogische Bestimmung der Kategorie lokale Zeitkonflikte Methodologie: Aktionsforschung und Fallstudienansatz Fallstudie - Modellprojekt ZeitBüro Bremen-Vegesack Bausteine einer Theorie lokaler Zeitpolitik Bestimmung der politischen Formelemente lokaler Zeitpolitik und Institutionalisierungsperspektiven Praxislogische Bestimmung lokaler Zeitkonflikte Perspektiven einer an Zeitwohlstand orientierten Zeitpolitik - konzeptionelle Bezüge zum Verwirklichungschancenansatz (A.Sen).
Produktdetails
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
330
Reihe
Europäische Hochschulschriften / European University Studies/Publications Universitaires Européenne
Autor/Autorin
Martina Heitkötter
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
450 g
Größe (L/B/H)
18/148/210 mm
ISBN
9783631548349
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Sind Zeitkonflikte des Alltags gestaltbar?" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









