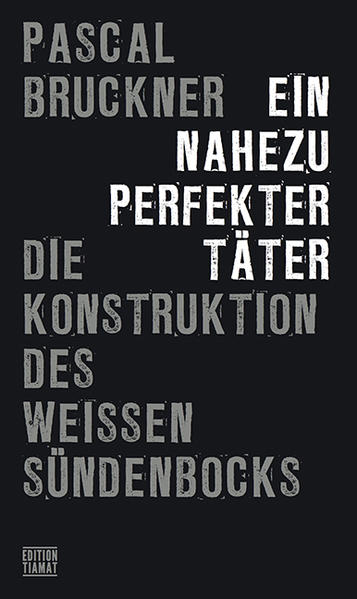
Zustellung: Di, 05.08. - Do, 07.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Der Fall der Berliner Mauer hat die europäische Linke in Ratlosigkeit gestürzt. Auf dem Kampffeld der Ideen sind Fortschritt, Freiheit und Universalismus einer neuen, aus den USA importierten Triade gewichen: Geschlecht, Identität, »Rasse«. Progressive kämpften einst im Namen der Arbeiterklasse, der Dritten Welt und den Verdammten dieser Erde. Heute dominieren die Diskurse des Neofeminismus, Antirassismus und Postkolonialismus, die den weißen Mann als Feind auserkoren haben. Seine Anatomie macht ihn zum geborenen Raubtier, seine Hautfarbe zum Rassisten, seine Macht zum Ausbeuter aller »Unterdrückten«. Dieser Essay analysiert, wie die Konkurrenz der Geschlechter, der Rassen und der Communities den Klassenkampf ersetzt und die Idee einer gemeinsamen Menschheit zerstört. Wer aus dem weißen Mann den Sündenbock der »intersektionalen« Minderheiten macht, tauscht lediglich einen Rassismus durch einen anderen aus und bereitet den unheilvollen Weg in eine tribalisierte Gemeinschaft, in der sich am Horizont der Krieg aller gegen alle abzeichnet.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
30. September 2021
Sprache
deutsch
Untertitel
Die Konstruktion des weißen Sündenbocks.
Originaltitel: Un coupable presque parfait.
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur.
Seitenanzahl
328
Reihe
Critica Diabolis
Autor/Autorin
Pascal Bruckner
Übersetzung
Mark Feldon
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
kartoniert
Gewicht
404 g
Größe (L/B/H)
211/126/32 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783893202812
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 16.10.2021
Besprechung vom 16.10.2021
Die neue Lust am Büßen
Rassismus unter umgekehrtem Vorzeichen: Pascal Bruckner nimmt die Selbstgeißelungen des Westens ins Visier.
Von Thomas Thiel
Man könnte meinen, Pascal Bruckner schreibe derzeit Bücher im Serientakt. In Wirklichkeit liegen zwischen seiner Kritik der Anti-Rassismus-Bewegung, die vergangenes Jahr auf Deutsch erschien (F.A.Z. vom 13. November 2020), und dem jetzt ebenfalls auf Deutsch vorgelegten "Ein nahezu perfekter Täter" mehr als drei Jahre. Bruckners Bücher sind ein emphatisches Bekenntnis zur europäischen Zivilisation und schonungslose Analyse ihrer aktuellen Schwäche. Europas großer Vorzug, Selbstreflexion und Selbstkritik, sind nach Bruckner in einen Schuldkult umgeschlagen. Das Problem bestehe darin, dass der Westen Maßstäbe an sich anlege, die er anderen erspare. Das führe zu einer moralischen Asymmetrie, die sich für Bruckner zu einer kulturell existenzbedrohenden Krise ausgewachsen hat.
Kein Autokrat dieser Welt, sei er aus China, der Türkei oder Russland, käme auf die Idee, sich für vergangenes Unrecht zu schämen, der Westen lasse sich dagegen auf die Unterstellung ein, er sei mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Rückzug aus seinen Kolonien mehr als je zuvor von einem kolonialen Geist durchzogen, der ihm, wie von postkolonialen Aktivisten behauptet wird, wie eine Erbsünde anhafte. Beispielhaft dafür nennt Bruckner die Behauptung des französischen Komitees gegen Islamophobie, Frankreich sei "ontologisch fremdenfeindlich", könne also nie und nimmer aus seiner Haut.
Der Anti-Rassismus-Kampf bringt für Bruckner einen neuen Hautfarbenrassismus unter umgekehrtem Vorzeichen hervor: die neue Inkarnation des Bösen ist der alte weiße Mann. Das Zerrbild entstehe, weil die Anti-Rassismus-Bewegung über den Rassismus an anderen Orten der Welt, auch und gerade in Afrika und der islamischen Welt, schweige und weil auch die dominante Spielart des Feminismus über die Frauenunterdrückung dort hinwegsehe.
Bruckner liefert eine ganze Reihe von Beispielen einer bis zur Militanz gesteigerten Verachtung, die man bei Leuten, die sich als Opfer inszenieren, nicht erwarten sollte. Darüber hinaus zeigt er die Mechanismen auf, wie der kulturelle Ausdruck beschnitten wird, etwa in Gestalt von "sensiblen Lesern", die in immer mehr Verlagen nach Formulierungen fahnden, die Lesern Unbehagen verursachen könnten (als wäre es die Aufgabe von Literatur, eine leidfreie Welt zu präsentieren), oder in Form von Leitfäden, die schon intensive Blicke zwischen Kollegen verbieten (wie der vormalige Arbeitgeber von Kevin Spacey verfügte). Man sieht hier, wie die neue Prüderie und der neue Opferkult einem gemeinsamen Ziel zustreben: dem Ideal des perfekten Angestellten in einer reizarmen Arbeitswelt.
Das alles ist leicht zu durchschauen und mittlerweile vielfach beschrieben. Interessanter ist die Frage, warum es in Europa und anderen westlichen Ländern auf fruchtbaren Boden fällt. Bei der Antwort darauf erreicht Bruckner nicht die analytische Brillanz der vorausgegangenen Publikation zum Rassismus. Sein neues Buch schreibt bekannte Motive fort, präsentiert aber keine wirklich originelle These. Der Keim des Übels kommt für Bruckner aus Frankreich selbst, wo die poststrukturalistische Vernunftkritik ihren Ausgang nahm. An amerikanischen Hochschulen habe sie sich mit identitärem Denken aufgeladen und kehre nun als Bumerang zurück. Das Problem ist jedoch nicht die Vernunftkritik selbst, die durchaus legitim sein kann, wo sie Verengungen oder überzogenen Ansprüchen gilt, sondern die Entsorgung jeglicher Vernunftansprüche. Dann bleibt nur noch das magische Denken und tribalistischer Machtkampf. Die aktivistischen Gruppen, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen, sind für Bruckner auch daran zu messen, ob sie sich derselben Logik der Segregation verschreiben, die sie kritisieren.
Einwenden lässt sich, dass sich der Autor auf beispielhafte Aussagen von Aktivisten verlässt. Davon präsentiert er zwar viele, doch wie weit sich das, was er als Virus und Krankheit beschreibt, in die Tiefen der europäischen Kultur eingefressen hat, wird darüber nicht deutlich. Nicht jede aktivistische Forderung wird zum Gesetz oder zur Alltagsnorm. Auch der Rückgriff auf medizinische Metaphern ist nicht glücklich.
Seine Kritik an doppelten Maßstäben beim Urteil über den Westen ist dagegen zu unterstreichen. Es gibt nur wenige Autoren, die so unbefangen über den innerafrikanischen und arabischen Sklavenhandel schreiben. Bekanntlich hat dieser Handel in der arabisch-muslimischen Welt nicht nur deutlich mehr Menschen in Unfreiheit gebracht als der transatlantische, wie Bruckner mit den Historikern Tidiane N'Diaye und Malek Chebel ausführt, er forderte aufgrund seiner besonders grausamen Natur auch mehr Menschenleben. Kaum ein Schwarzer überlebte ihn. In Ländern wie Mauretanien oder Sudan existiert er bis heute fort, ohne dass sich antirassistische Aktivisten lautstark darüber empören. Warum spielt das im postkolonialen Diskurs kaum eine Rolle? Und warum äußern sich afrikanische Eliten so selten zum innerafrikanischen Sklavenhandel?
Es gibt keinen Grund, deshalb die Nabelschnur zur Vergangenheit zu durchtrennen, wie Bruckner fordert, postkoloniale Exzesse sind kein Argument gegen die Aufarbeitung des Kolonialismus. Aber man sollte beim Urteil über vergangenes und gegenwärtiges Unrecht alle Seiten betrachten. In Bruckners Lob der europäischen Zivilisation liegt so mehr Hoffnung als in den opportunen Selbstgeißelungen, die sich als Läuterung präsentieren.
Pascal Bruckner: "Ein nahezu perfekter Täter". Die Konstruktion des weißen Sündenbocks.
Aus dem Französischen von Mark Feldon. Edition Tiamat, Berlin 2021. 400 S., br.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Ein nahezu perfekter Täter" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









