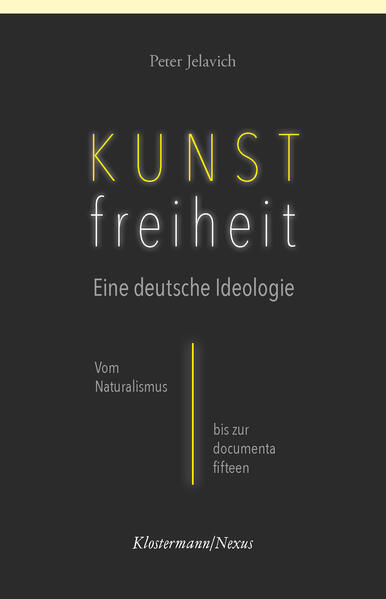Besprechung vom 26.07.2025
Besprechung vom 26.07.2025
Bühne frei für die Moralapostel
Das Schöne darf nicht zu sinnlich sein: Peter Jelavich denkt über die Kunstfreiheit vom Kaiserreich bis heute nach
Peter Jelavichs Buch beginnt mit der erstaunlichen Feststellung, dass die Kunstfreiheit in der Bundesrepublik einen größeren Schutz genießt als andere Formen der Meinungsäußerung, etwa die politische Rede. Das Grundgesetz deklariere nämlich in Artikel 5 zuerst die Freiheit der Meinung, schränke diese dann in Absatz 2 sogleich wieder ein, ehe zum Schluss und damit jenseits der Einschränkung Kunst und Wissenschaft genannt werden. Keine andere demokratische Verfassung kennt diesen Sonderstatus. Wie erklärt man das Kuriosum?
Der an der Johns Hopkins University lehrende Historiker Jelavich zieht dazu die Geschichte heran: Im Gegensatz zu Franzosen und Engländern besaßen die Deutschen im achtzehnten Jahrhundert noch keinen einheitlichen Nationalstaat. Die verspätete Nation (Helmuth Plessner) kompensierte den Mangel kulturell. Das progressive Bürgertum förderte die Künste, die wiederum eine gegen den Adel gerichtete Freiheitsliebe ausbildeten, für welche bei Jelavich Friedrich Schiller bürgt. Der erste in der Paulskirche ausgearbeitete Verfassungsentwurf kannte entsprechend keine besondere Kunstfreiheit, sie zählte einfach zur politischen Meinung. Das wandelte sich erst mit dem Scheitern der demokratischen Verfassungsgebung: "Nach der Niederschlagung der Revolutionen von 1848 änderte sich die Funktion der Kunst in den deutschen Staaten tiefgreifend. Hatten Schiller und andere die ästhetische Sphäre noch als Zwischenstation auf dem Weg zur politischen Freiheit betrachtet, wurde sie nun zum Selbstzweck."
Diese Anpassung des bürgerlichen Kunstverständnisses schlägt sich im Titel von Jelavichs Buch nieder: "Kunstfreiheit - Eine deutsche Ideologie". Er spielt auf Karl Marx und dessen Polemik an, die mangelnde politische Tatkraft der Deutschen habe sich einen geistigen Ersatz gesucht. Philosophie statt Revolution, Kant statt Robespierre. Jelavich folgt diesem Gedanken und spricht vom ästhetisch-juristischen Idealismus als deutschem Sonderweg. In eine autonome Sphäre abgeschoben, verlor die Kunst ihr politisches Potential, fügte sich dem Status quo: "Die Kunstfreiheit degenerierte zu einer Ideologie im klassischen marxistischen Sinne: zu einem Wertesystem, das ein historisch spezifisches Sozialgefüge widerspiegelt und unterstützt."
Kunstfreiheit ist für Jelavich folglich ein ambivalenter Begriff. Was geschützt wird, kann selbst nicht schaden. Vom revolutionären Impetus befreit, diente die Kunst der Selbstkultivierung des Bürgertums. Das Schöne durfte dabei nicht zu sinnlich sein, nicht zu wirklich und materiell. Ein solchermaßen ätherisches Kunstbild war, das zeigt Jelavich im Hauptteil seiner Studie, Voraussetzung der juristischen Zensur: Immer dann, wenn Künstler einen Übertritt in die Realsphäre wagten, sich also nicht an den historischen Kompromiss hielten, wurden sie als sittenwidrig zensiert.
Eine widersprüchliche Beziehung also. Jelavich verfolgt sie vom Kaiserreich bis in die Gegenwart, wobei er schlaglichtartig relevante Gerichtsfälle beleuchtet. Es entsteht eine knapp gefasste Geschichte der Kunstfreiheit als Geschichte ihrer Einschränkung: Ist die Darstellung der Io von Correggio unzüchtig? Nicht wenn sie in einem Museum hängt, das ihr Weihe verleiht, sehr wohl hingegen als massenhaft reproduzierte Postkarte oder im Schaufenster, wo die Jugend den Po der Figur bewundern kann.
So und so ähnlich argumentieren die von Jelavich mit Vorliebe "Moralapostel" genannten Wächter des Bestehenden noch bis in die frühe Bundesrepublik, in der das Filmdrama "Die Sünderin" (1951) mit Hildegard Knef als Prostituierter zu Proteststürmen führte - und einem polizeilichem Verbot. Erst in den Sechzigerjahren fallen schließlich die "sittlichen" Einschränkungen. Das Persönlichkeitsrecht bildet seither die Grenze ästhetischer Autonomie.
Jelavich, Autor mehrerer Bücher über Kunst in der Weimarer Republik, richtet sich mit seiner Darstellung an eine breitere Öffentlichkeit, die Orientierung in Zeiten des Bildersturms gut gebrauchen kann. Sie ist so etwas wie die juristisch fokussierte Ergänzung zu Hanno Rauterbergs "Wie frei ist die Kunst" (2018) und Wolfgang Ullrichs "Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie" (F.A.Z. vom 12. März 2022), die gegenwärtige Kulturkämpfe in der Kunstwelt behandeln. Bei Jelavich ist wenig von gestürzten Denkmälern und übermalten Gedichten zu lesen, was man für ein Manko halten kann. Doch tatsächlich sind die jüngeren Entwicklungen verfassungsmäßig nicht von Belang.
Das wird im Schlusskapitel zur Documenta 15 deutlich, die Jelavich als Gremienmitglied begleitet hat. Seine These: Antisemitische Kunst ist ein politisches, kein juristisches Problem: "Es steht Künstlern und Interpreten frei, antisemitische, rassistische, frauenfeindliche oder queerfeindliche Meinungen zu äußern: Sie sind nicht verpflichtet, die Antidiskriminierungsklauseln des Grundgesetzes einzuhalten." Das sollte man also wohl aushalten, auch wenn man es nicht staatlich fördern muss. Ein Bild abzuhängen ist allerdings erst dann Zensur, wenn es gar nicht mehr gezeigt werden darf, und der Streit um öffentliche Gelder keine Frage des Rechts.
Der neuerdings auch von linker Seite an die Kunst gerichtete Anspruch, sie müsse beim Betrachter Verletzungen vermeiden und also an die moralische Leine genommen werden, wird vor dem Hintergrund von Jelavichs Darstellung als Kategorienfehler erkennbar. HAZIRAN ZELLER
Peter Jelavich: "Kunstfreiheit". Eine deutsche Ideologie. Vom Naturalismus bis zur documenta fifteen.
Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2025. 184 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.