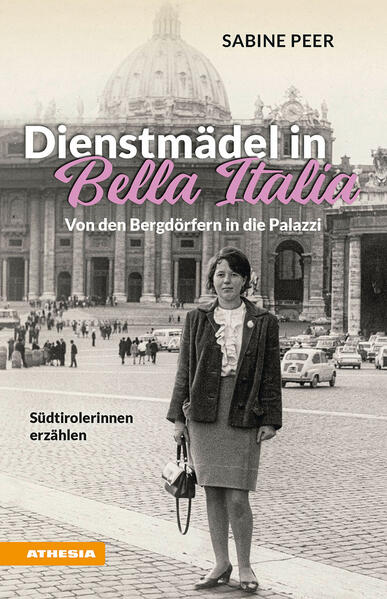Wie schon im ersten Band gibt Sabine Peer auch diesmal wieder Südtirolerinnen eine Stimme, die in den 1950er und 1960er Jahren als Kindermädchen oder Haushaltshilfe in wohlhabende italienische Haushalte kamen.
Obgleich im gleichen Land, kamen sich die jungen Frauen wohl wie in einer anderen Welt vor, so groß waren die Unterschiede zwischen ihren heimatlichen Bergdörfern und den großen, modernen Städten, in denen sie Anstellung fanden. In großer Armut, konservativ und erzkatholisch erzogen und oft mit nur sehr spärlicher Schulbildung aufgewachsen mussten sich die Südtirolerinnen in der Ferne teils ohne italienische Sprachkenntnisse zurecht finden. Heimweh war vorprogrammiert, doch eine vorzeitige Rückkehr kam aufgrund der wirtschaftlichen Not nicht in Frage.
Das Buch entstand anhand der Methode der sogenannten "Oral History", d.h. die Autorin sprach persönlich mit den Hauptpersonen bzw. deren Angehörigen und erhielt so Informationen aus erster und zweiter Hand. Peer versteht es hervorragend, Nähe zu den Protagonistinnen zu schaffen. Sie schildert die ergreifenden Lebensumstände, die Gedanken und Gefühle der jungen Frauen, die manch Schönes erlebten, aber auch unfassbar Schreckliches, wie etwa sexuelle Übergriffe in einem der reichen Herrschaftshäuser. Dabei bleibt die Erzählung voller Empathie, aber ohne Sensationsgier. Peer bindet in ihrer Erzählung die persönlichen Schicksale der "Dienstmädel" geschickt in politische und geschichtliche Hintergründe ein, so dass die Lektüre nicht nur fesselnde Einblicke in Einzelbiografien gibt, sondern überdies anschaulich Zeitgeschichte vermittelt.
Sehr gut hat mir das hilfreiche Glossar gefallen, in dem sowohl südtirolerische und italienische Begriffe übersetzt werden als auch wichtige Schlagworte erklärt sind.
Ein sehr empfehlenswertes Büchlein, das einen weitgehend unbeachteten Aspekt der südtiroler Geschichte beleuchtet.