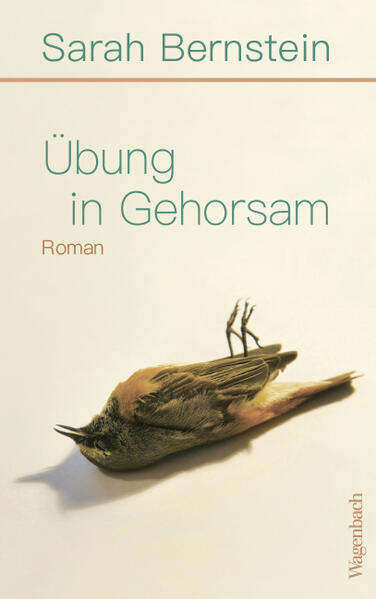Besprechung vom 16.10.2025
Besprechung vom 16.10.2025
Das Stockholm-Syndrom als letzter Ausweg
Auf blutgetränkter Erde: Sarah Bernsteins "Übung im Gehorsam" ist ein dunkles Kammerspiel über Judenfeindschaft, Macht und älteste Gefühlsstrukturen.
Es hört einfach nicht auf. In westlichen Gesellschaften, gerade auch in Deutschland, bricht sich der Antisemitismus wieder Bahn - mal laut und aggressiv auf der Straße oder im Netz, mal leise und scheinbar beiläufig im Alltag, auch im Kunst- und Literaturbetrieb. Die historischen Zäsuren erweisen sich als trügerisch. Feindbilder kehren zurück (wenn sie jemals ganz verschwunden waren), Verschwörungsmythen verbinden sich mit aktuellen Krisen und Konflikten. Projektionen, Schuldumkehr und Dämonisierung wirken zäh und böse fort.
Sarah Bernstein, aus Montreal stammend, in Schottland lebend, erzählt von einer namenlosen Frau, die zu ihrem verlassenen Bruder aufs Land zieht, ihn versorgt und im abgelegenen, sprachlich und kulturell fremden Dorf zur Außenseiterin wird. Wo dieses Dorf liegt, bleibt unklar, irgendwo "im Norden". Was wir allerdings erfahren, ist, dass es sich um blutgetränkte Erde handelt: Von brennenden Dörfern, die es hier einst gegeben hat, ist die Rede, von Gruben, in die man Leichen massenhaft verscharrt hat, darunter auch die Vorfahren der eigenen Familie, die ihrerseits ein Leben in der "Neuen Welt" aufbauen konnte. Dem Leser steht ein Ort in den "Bloodlands" (Timothy Snyder) vorm inneren Auge - jene Landschaften zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, in denen Millionen Menschen dem blutigen Furor der Nazis und der Stalinisten erlagen.
In dem Dorf begegnen der Frau offenes Misstrauen, subtile Feindseligkeit, bald auch eine wachsende Welle von Schuldzuweisungen, in denen älteste Reflexe nachwirken: Missernten, tote Tiere und Unglücksfälle werden ihr angelastet. Ihre beharrlichen Versuche, sich anzupassen - die Sprache zu lernen, den Gepflogenheiten zu folgen -, bleiben wirkungslos. Über allem liegt etwas Unheimliches, Abergläubisches und Ritualhaftes, das in rätselhaften Gesten, verstohlenen Blicken und dumpfem Schweigen spürbar ist. Am Ende kommt es zum Showdown in der Kirche: Die Dorfbewohner, gekleidet in identische Trainingsanzüge, stehen wie zu einer Prozession versammelt. Im Halbdunkel liegt ein totes Schwein. Es ist eine Geste voller roher Demütigung und historisch tief verankerter antisemitischer Symbolik. Zugleich kippt im Verhältnis zum Bruder das Machtgefüge, als dieser schwer erkrankt - und die Unterworfene als Pflegende eine unerwartete Machtstellung einnimmt. "Übung im Gehorsam" ist ein dunkles, nicht leicht zu durchdringendes, aber gerade deswegen umso faszinierenderes Kammerspiel, das von Fremdheit und Ausgrenzung, Schuld und Schuldumkehr handelt. Man wird nicht schnell fertig damit.
Eingewoben in den Text sind vielerlei literarische und philosophische Bezüge und Anspielungen, über die ein kurzes Verzeichnis am Ende des Buches Auskunft gibt. Sarah Bernsteins intellektueller Kosmos umfasst Namen, die einem in dieser Kombination nirgendwo bisher begegnet sind: von Klassikern der Moderne wie Virginia Woolf, Susan Sontag und Ingeborg Bachmann (ausdrücklich genannt wird "Malina", aus dem Bernstein auch das sprachkritische Motto für ihren Roman entnommen hat) über die französische Autorin Marie N'Diaye und die vietnamesische Theoretikerin Trinh Thi Minh Hà bis zu einigen männlichen Denkern und Autoren, wobei insbesondere Franz Kafka eine wesentliche Rolle zu spielen scheint: Jenseits der von Sarah Bernstein im Anhang vermerkten einzelnen Passage kommt einem der Verfasser des "Proceß" bei der Lektüre immer wieder in den Sinn - und das nicht nur im Fall der allgemeinen Erwägungen über Macht, Ekel und Scham, Hass und Selbsthass, sondern auch in Gestalt von Anspielungen und Zitaten: "Leg dich hin, kleines Hündchen, nun leg dich schon hin", so gibt die Erzählerin die Worte wieder, die sie, die zur Unter- und Einordnung erzogen worden ist, ihr Leben lang begleitet haben. "Wie ein Hund!", so endet der "Proceß" und mit ihm die quälende Hinrichtung von Josef K., der er sich still unterworfen hat.
Das Verstörende an Sarah Bernsteins Buch, dessen kühlen Ton der Beobachtung und Vorsicht Beatrice Faßbender mit großer Sensibilität ins Deutsche übertragen hat, ist aber noch etwas anderes. Sie führt uns erzählerisch und psychologisch vor Augen, wie tief der Antisemitismus einwirkt - und zwar sowohl auf Opfer- als auch auf Täterseite. Gerade diese Doppelperspektive macht das Buch so verstörend und aufschlussreich: Während die Erzählerin zum Ende der Erzählung "tieftraurig" für sich erkennt, dass "all ihre Anstrengungen" umsonst gewesen sind (sie hat sich freiwillig als Arbeiterin auf einem Gemeinschaftshof gemeldet, wo sie umstandslos niedrigste und schwerste Tätigkeiten verrichtete), ja dass all ihre Bemühungen "zum Scheitern" führen mussten, findet das Dorf in der hasserfüllten Ablehnung und der Reaktivierung nur scheinbar verschütteter judenfeindlicher Motive auf perverse Weise zu sich selbst. Mit der stoischen Verzweiflung Josef K.s stellt die Erzählerin an einer Stelle sogar fest, dass die Ausgrenzung, die sie erlebt, "einen im Interesse des gemeinschaftlichen Zusammenhalts geleisteten Dienst darstellte". Die Herausbildung einer Art von Stockholm-Syndrom wird zur letzten Option, sich in einer Gesellschaft, die einer "jahrhundertealten Gefühlsstruktur" unterliegt, einen Ort und eine Aufgabe zu geben - und sei es um den Preis der eigenen Selbstauslöschung. KAI SINA
Sarah Bernstein: "Übung im Gehorsam". Roman.
Aus dem Englischen von Beatrice Faßbender.
Wagenbach Verlag, Berlin 2025. 160 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.