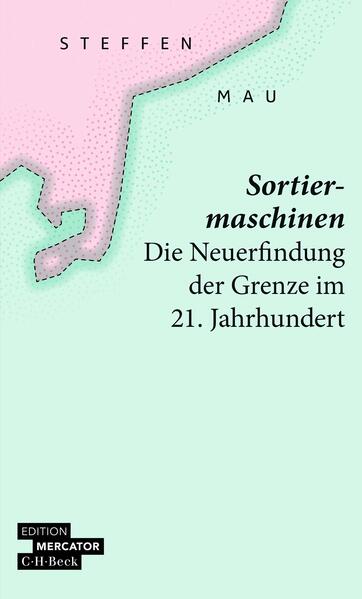
Zustellung: Mi, 14.05. - Fr, 16.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
VON ERWÜNSCHTEN UND UNERWÜNSCHTEN REISENDEN - DIE NEUEN MAUERN DER GLOBALISIERUNG
Der kosmopolitische Traum von einer grenzenlosen Welt hat in den letzten Jahren tiefe Risse bekommen. Aber war er überhaupt jemals realistisch? Steffen Mau zeigt, dass Grenzen im Zeitalter der Globalisierung von Anbeginn nicht offener gestaltet, sondern zu machtvollen Sortiermaschinen umgebaut wurden. Während ein kleiner Kreis Privilegierter heute nahezu überallhin reisen darf, bleibt die große Mehrheit der Weltbevölkerung weiterhin systematisch außen vor.
Während die Mobilität von Menschen über Grenzen hinweg in den letzten Jahrzehnten stetig zunahm und Grenzen immer offener schienen, fand gleichzeitig eine in Wissenschaft und Öffentlichkeit unterschätzte Gegenentwicklung statt. Vielerorts ist es zu einer neuen Fortifizierung gekommen, zum Bau neuer abschreckender Mauern und militarisierter Grenzübergänge. Grenzen wurden zudem immer selektiver und - unterstützt durch die Digitalisierung - zu Smart Borders aufgerüstet. Und die Grenzkontrolle hat sich räumlich massiv ausgedehnt, ja ist zu einer globalen Unternehmung geworden, die sich vom Territorium ablöst. Der Soziologe Steffen Mau analysiert, auf welche Weise und mit welchen Mitteln die neuen Sortiermaschinen Mobilität und Immobilität zugleich schaffen: Für erwünschte Reisende sollen sich Grenzen wie Kaufhaustüren öffnen, für andere sollen sie fester denn je verschlossen bleiben. Nirgends tritt das Janusgesicht der Globalisierung deutlicher zutage als an den Grenzen des 21. Jahrhunderts.
Der kosmopolitische Traum von einer grenzenlosen Welt hat in den letzten Jahren tiefe Risse bekommen. Aber war er überhaupt jemals realistisch? Steffen Mau zeigt, dass Grenzen im Zeitalter der Globalisierung von Anbeginn nicht offener gestaltet, sondern zu machtvollen Sortiermaschinen umgebaut wurden. Während ein kleiner Kreis Privilegierter heute nahezu überallhin reisen darf, bleibt die große Mehrheit der Weltbevölkerung weiterhin systematisch außen vor.
Während die Mobilität von Menschen über Grenzen hinweg in den letzten Jahrzehnten stetig zunahm und Grenzen immer offener schienen, fand gleichzeitig eine in Wissenschaft und Öffentlichkeit unterschätzte Gegenentwicklung statt. Vielerorts ist es zu einer neuen Fortifizierung gekommen, zum Bau neuer abschreckender Mauern und militarisierter Grenzübergänge. Grenzen wurden zudem immer selektiver und - unterstützt durch die Digitalisierung - zu Smart Borders aufgerüstet. Und die Grenzkontrolle hat sich räumlich massiv ausgedehnt, ja ist zu einer globalen Unternehmung geworden, die sich vom Territorium ablöst. Der Soziologe Steffen Mau analysiert, auf welche Weise und mit welchen Mitteln die neuen Sortiermaschinen Mobilität und Immobilität zugleich schaffen: Für erwünschte Reisende sollen sich Grenzen wie Kaufhaustüren öffnen, für andere sollen sie fester denn je verschlossen bleiben. Nirgends tritt das Janusgesicht der Globalisierung deutlicher zutage als an den Grenzen des 21. Jahrhunderts.
- Die dunkle Seite der Globalisierung
- Borders are back
- Die Globalisierung hat nicht die Auflösung von Grenzen zur Folge - sie kehren in neuer Gestalt wieder
Inhaltsverzeichnis
1. Borders are back!
2. Staatlichkeit, Territorialität und Grenzkontrolle
3. Öffnung und Schließung: Die Dialektik der Globalisierung
4. Fortifizierung: Grenzmauern als Bollwerke der Globalisierung
5. Filtergrenzen: Die Gewährung ungleicher Mobilitätschancen
6. Smart Borders: Informationelle und biometrische Kontrolle
7. Makroterritorien: Rückbau von Binnengrenzen, Aufwertung von Außengrenzen
8. Exterritorialisierung von Kontrolle: Die Ausweitung der Grenzzone
9. Globalisierte Grenzen
Danksagung
Anmerkungen
Register
2. Staatlichkeit, Territorialität und Grenzkontrolle
3. Öffnung und Schließung: Die Dialektik der Globalisierung
4. Fortifizierung: Grenzmauern als Bollwerke der Globalisierung
5. Filtergrenzen: Die Gewährung ungleicher Mobilitätschancen
6. Smart Borders: Informationelle und biometrische Kontrolle
7. Makroterritorien: Rückbau von Binnengrenzen, Aufwertung von Außengrenzen
8. Exterritorialisierung von Kontrolle: Die Ausweitung der Grenzzone
9. Globalisierte Grenzen
Danksagung
Anmerkungen
Register
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. Januar 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
189
Autor/Autorin
Steffen Mau
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
mit 5 Abbildungen
Gewicht
242 g
Größe (L/B/H)
205/123/18 mm
Sonstiges
Klappenbroschur
ISBN
9783406775703
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
" Steffen Maus Buch mit der zentralen These, dass andere unsere wachsende Mobilität mit wachsender Immobilität bezahlen, ist hervorragende Reiselektüre.
taz, Lennart Laberenz
" Räumt mit einem allzu einseitigen Blick auf die Globalisierung auf. Ein so instruktiver wie erfreulich nüchterner Beitrag zur politisch-soziologischen Zeitdiagnose.
Süddeutsche Zeitung, Miryam Schellbach
" Erzählt, wie die sichtbaren und unsichtbaren Grenzen in unserer Welt immer weiter ausgebaut werden.
NZZ am Sonntag, Peer Teuwsen
" Der Soziologe Steffen Mau erklärt, warum Grenzen trotz zunehmender Mobilität nicht verschwinden.
NZZ, Florian Coulmas
Ein Buch, das genug Sprengsätze des Nachdenkens bereithält. Ein Buch, das inspiriert.
Lesart, Helmut Lethen
" Mau ist Globalisierungsrealist. Allein der Titel seines Buches ist ein Augenöffner: Die Grenzen der Gegenwart sind Sortiermaschinen`, sie schließen nicht einfach aus, sie selektieren. "
SPIEGEL, Tobias Becker
" Sein Buch hilft, Weltentwicklung besser zu verstehen, auch weil es verschiedene Ebenen zusammendenkt. Steffen Mau schreibt als Wissenschaftler, aber auch als Bürger und Mensch. "
Deutschlandfunk Andruck, Tom Schimmeck
" Wunderbar für ein allgemeines Publikum geeignet, das sich eventuell gern ein wenig in Selbstgewissheiten eigener Liberalität ergeht. "
Soziopolis. de, Klaus Schlichte
" Ein großer Wurf. " Dresdner Morgenpost
" Ebenso präzise wie theoretisch anspruchsvoll, aber auch für den nichtsoziologischen Leser immer nachvollziehbar
SWR 2, Jochen Rack
" Erinnert daran, dass Globalisierung mit der Justierung von Grenzen einhergeht. " Frankfurter Allgemeine Zeitung, Herfried Münkler
" Ein Buch als Weckruf. Eindringlich warnt er immer wieder davor, dass die neuen Grenzen zu neuen Benachteiligungen führen. Die Kehrseite der Öffnung sei eine Schließungsglobalisierung` mit fatalen Folgen etwa mit Blick auf Menschenrechte. "
Deutschlandfunk Kultur, Vera Linß
" Eine tiefschürfende, geistreiche Analyse" SWR 2, Pascal Fischer
" Spannendes, aufschlussreiches Buch. " rbb kulturradio, Peter Claus
" Sein Buch ist der erste Band der neuen Edition Mercator, die C. H. Beck gemeinsam mit der Stiftung Mercator herausgibt. Man darf von einem gelungenen Auftakt sprechen, da Mau die einst durch den namensgebenden Geografen gezogenen Grenzen neu verortet und bestimmt. " Tagesspiegel, Michael Wolf
" Überzeugend und differenziert macht eindrücklich deutlich, dass Grenzen nur scheinbar offener geworden sind. " OE1 Kontext, Holger Heimann
" Der Schein der verschwindenden Grenzen trügt. "
Deutschlandfunk Kultur, Liane von Billerbeck
" Überaus treffliches Diskursbuch. "
kultur-punkt. ch
" Sehr zu empfehlen. "
Deutschlandfunk Kultur, Korbinian Frenzel
taz, Lennart Laberenz
" Räumt mit einem allzu einseitigen Blick auf die Globalisierung auf. Ein so instruktiver wie erfreulich nüchterner Beitrag zur politisch-soziologischen Zeitdiagnose.
Süddeutsche Zeitung, Miryam Schellbach
" Erzählt, wie die sichtbaren und unsichtbaren Grenzen in unserer Welt immer weiter ausgebaut werden.
NZZ am Sonntag, Peer Teuwsen
" Der Soziologe Steffen Mau erklärt, warum Grenzen trotz zunehmender Mobilität nicht verschwinden.
NZZ, Florian Coulmas
Ein Buch, das genug Sprengsätze des Nachdenkens bereithält. Ein Buch, das inspiriert.
Lesart, Helmut Lethen
" Mau ist Globalisierungsrealist. Allein der Titel seines Buches ist ein Augenöffner: Die Grenzen der Gegenwart sind Sortiermaschinen`, sie schließen nicht einfach aus, sie selektieren. "
SPIEGEL, Tobias Becker
" Sein Buch hilft, Weltentwicklung besser zu verstehen, auch weil es verschiedene Ebenen zusammendenkt. Steffen Mau schreibt als Wissenschaftler, aber auch als Bürger und Mensch. "
Deutschlandfunk Andruck, Tom Schimmeck
" Wunderbar für ein allgemeines Publikum geeignet, das sich eventuell gern ein wenig in Selbstgewissheiten eigener Liberalität ergeht. "
Soziopolis. de, Klaus Schlichte
" Ein großer Wurf. " Dresdner Morgenpost
" Ebenso präzise wie theoretisch anspruchsvoll, aber auch für den nichtsoziologischen Leser immer nachvollziehbar
SWR 2, Jochen Rack
" Erinnert daran, dass Globalisierung mit der Justierung von Grenzen einhergeht. " Frankfurter Allgemeine Zeitung, Herfried Münkler
" Ein Buch als Weckruf. Eindringlich warnt er immer wieder davor, dass die neuen Grenzen zu neuen Benachteiligungen führen. Die Kehrseite der Öffnung sei eine Schließungsglobalisierung` mit fatalen Folgen etwa mit Blick auf Menschenrechte. "
Deutschlandfunk Kultur, Vera Linß
" Eine tiefschürfende, geistreiche Analyse" SWR 2, Pascal Fischer
" Spannendes, aufschlussreiches Buch. " rbb kulturradio, Peter Claus
" Sein Buch ist der erste Band der neuen Edition Mercator, die C. H. Beck gemeinsam mit der Stiftung Mercator herausgibt. Man darf von einem gelungenen Auftakt sprechen, da Mau die einst durch den namensgebenden Geografen gezogenen Grenzen neu verortet und bestimmt. " Tagesspiegel, Michael Wolf
" Überzeugend und differenziert macht eindrücklich deutlich, dass Grenzen nur scheinbar offener geworden sind. " OE1 Kontext, Holger Heimann
" Der Schein der verschwindenden Grenzen trügt. "
Deutschlandfunk Kultur, Liane von Billerbeck
" Überaus treffliches Diskursbuch. "
kultur-punkt. ch
" Sehr zu empfehlen. "
Deutschlandfunk Kultur, Korbinian Frenzel
 Besprechung vom 15.09.2021
Besprechung vom 15.09.2021
Wer hineindarf und wer nicht
Korrektur einer voreiligen Erwartung: Der Soziologe Steffen Mau erinnert daran, dass Globalisierung mit der Justierung von Grenzen einhergeht.
Die große Erzählung von der Revolutionierung der politischen Ordnung infolge der Globalisierung enthält immer auch einen Abschnitt über das Verschwinden der Staatsgrenzen. Für die Europäer, an erster Stelle für die Deutschen, hatte das durch den Fall der Berliner Mauer und das Verschwinden des quer durch Europa verlaufenden Grenzregimes eine unmittelbare Erfahrbarkeit. Der Aufbau des Schengenraums als zusätzlicher Bestandteil der EU-Ordnung kam hinzu: In ihm können unbeschadet der fortbestehenden nationalstaatlichen Grenzen Personen und Güter, Kapital und Dienstleistungen frei zirkulieren. Dieser Schengenraum wurde als ein vorerst noch regional beschränktes Modell für das angesehen, was sich im Verlauf des 21. Jahrhunderts im globalen Maßstab entwickeln würde: eine Welt ohne Grenzen. Umso überraschter waren viele, als bald nach der Ausbreitung von Covid-19 in Europa die nationalstaatlichen Grenzen erneut hochgezogen und auch der Schengenraum politisch parzelliert wurde. Das sei freilich nur eine pandemiebedingte, zeitlich beschränkte Maßnahme, versicherte die Politik.
Dass derlei indes nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist und dass es sich bei der Vorstellung vom Verschwinden der Grenzen infolge der Globalisierung um eine perspektivische Täuschung handelt, ist die zentrale These von Steffen Maus Buch über die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Es sind vor allem drei Beobachtungen, die der an der Berliner Humboldt-Universität beheimatete Soziologe miteinander verbindet: die eines Gestaltwandels der Grenze, durch den ein generelles Kontrollregime in eine Filterfunktion überführt worden sei; die der Entstehung von politisch-ökonomischen Makroräumen, innerhalb deren die Binnengrenzen gefallen und dafür die Außengrenzen des neuen Wirtschaftsraums umso mehr gehärtet worden sind; und schließlich die einer Sortierung zwischen denen, die als Einreisende gern gesehen und erwünscht sind, und jenen, die als unerwünscht gelten und deren Anwesenheit als hochgradig riskant angesehen wird. Das neue Grenzregime soll also beides zugleich leisten: einerseits die Mobilität von Menschen und Gütern erleichtern und andererseits diese Mobilität erschweren, wenn nicht überhaupt unmöglich machen.
Nun kann man dagegen einwenden, so neu, wie von Mau angenommen, sei das keineswegs, denn auch die Mauern, Türme und Tore mittelalterlicher Städte hatten bereits beide Aufgaben, Erwünschte hereinzulassen und gleichzeitig Unerwünschte - politische Feinde, suspekte Gestalten, infektiöse Kranke und soziale Kostgänger - draußen zu halten. Der Unterschied zwischen diesem alten und dem neuen Grenzregime liegt danach weniger in seiner prinzipiellen Funktion als vielmehr in deren technisch-organisatorischer Umsetzung. An die Stelle des Unterscheidungsvermögens der Torwächter, die wohlhabende Kaufleute und dringend benötigte Arbeitskräfte von Bettlern und zwielichtigen Figuren zu unterscheiden hatten, ist nun ein auf große Datenmengen gestütztes Erkennungssystem getreten, das seinem Anspruch nach sehr viel zuverlässiger arbeitet als die einstigen Wächter. Das dürfte tatsächlich der Fall sein, wenngleich eine gewisse Skepsis gegenüber den Anpreisungsformeln der Hersteller solcher Erkennungssysteme angebracht ist.
Richtet sich Maus Leitthese von der Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert also gar nicht so sehr auf einen tatsächlichen Funktionswandel von Grenzregimen - wenn man denn in Rechnung stellt, dass es von der Stadt über die Territorialherrschaft und den Nationalstaat bis zu den wirtschaftlich integrierten Territorien immer größere Räume sind, die von Grenzen umgeben werden - als gegen die sozialwissenschaftlichen Prognosen und lebensweltlichen Erwartungen, die sich im Übergang vom zwanzigsten zum 21. Jahrhundert mit dem Catch-all-Begriff der Globalisierung verbunden haben? Man kann das Buch jedenfalls so lesen, dass es gar nicht so sehr um eine Neuerfindung der Grenze durch die Politik, sondern um die Wiederentdeckung der Grenze als Modus der Trennung seitens der Soziologie geht.
So gesehen handelt es sich bei Mau um die realitätsbezogene Korrektur der zeitweilig überschäumenden Erwartungen von Globalisten und den ihnen folgenden Wissenschaftlern, die ihre eigenen Reiseerfahrungen mit denen der großen Mehrheit verwechselt haben beziehungsweise die, wenn ihnen auch klar war, dass ihr eigenes Pendeln zwischen internationalen Kongressen mit den Mobilitätsradien von Menschen in großen Teilen der Welt nichts zu tun hatte, sich als Avantgarde verstanden, die schon jetzt so lebe, wie dies in einigen Jahrzehnten der Großteil der Menschheit tun würde. Steffen Mau macht dazu die Gegenrechnung auf: Die modifizierten Grenzregime werden verhindern, dass diese Prognose jemals eintritt. Eine solche Erdung soziologischer Prognosen ist nicht das geringste Verdienst seines Buches.
Darüber hinaus kann Mau aber auch zeigen, wo darüber hinaus ein grundlegender Gestaltwandel der Grenzen erfolgt ist. Da ist zunächst die Vorverlegung der Grenzregime über Hunderte, wenn nicht Tausende von Kilometern vor die eigentliche Grenze eines Staates oder Wirtschaftsraumes; es sind sodann die grenzziehenden Kontrollen innerhalb eines Binnenraumes, also auch dann, wenn man die eigentliche Grenze längst passiert hat. Ersteres exemplifiziert Mau an den Maßnahmen der Vereinigten Staaten wie der EU, die Migrationsbewegungen nicht erst an ihren jeweiligen Außengrenzen, sondern bereits in Mittelamerika oder im transsaharischen Afrika zu stoppen suchen und dazu die Staaten des betreffenden Raumes für sich in Anspruch nehmen.
Für die Grenzziehungen im Binnenraum könnte Mau aktuell die Debatte über 3-G- oder 2-G-Regelungen beim Besuch von Gaststätten und Veranstaltungen in Anschlag bringen. Auch das sind Grenzziehungen von einiger Bedeutung für die Lebensführung - mit dem erheblichen Unterschied freilich, dass sie zu relativieren in die Entscheidung der Betroffenen gestellt ist, etwa indem die so Ausgeschlossenen sich impfen lassen. Die Grenzen der Privilegierten sind solche, auf die sie selber Einfluss nehmen können; bei den Grenzen dagegen, die für den Großteil relevant sind, handelt es sich um Regime, denen diese Menschen ohne Einflussmöglichkeit unterworfen sind. Die Sortiermaschinen, als die Mau die Grenzen bezeichnet, sind also unterschiedlich kalibriert. Man könnte geradezu von einer Grenze zwischen unterschiedlichen Maschinen der Sortierung sprechen, und die wiederum ziehen Trennlinien, die für das Leben zumeist bedeutsamer sind als alles andere. HERFRIED MÜNKLER.
Steffen Mau: "Sortiermaschinen". Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert.
C. H. Beck Verlag, München 2021. 189 S., br.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.








