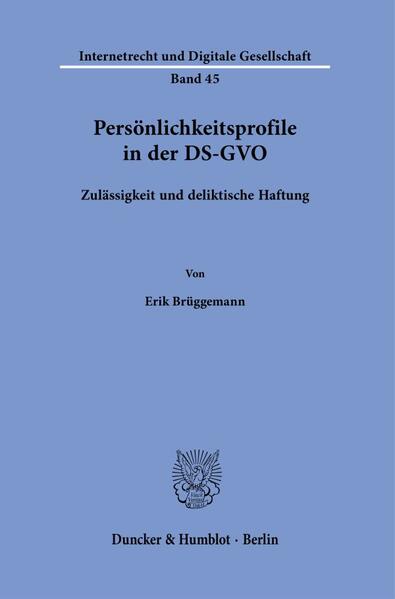
Zustellung: Mo, 12.05. - Mi, 14.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Vermessung unserer Welt in Nullen und Einsen macht vor dem Menschen nicht halt. Von uns werden digitale Abbilder erstellt und kommerziell verwertet. Ihre sensibelste Form ist die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils. Sofern dies mit dem Datenschutzrecht nicht vereinbar ist, drängt sich die Frage nach Teilhabe der Betroffenen durch Kompensation in Geld auf. Inwieweit diese aufgrund der zentralen Norm Art. 82 Abs. 1 DS-GVO zu leisten ist, wird hier untersucht.
Das Buch beginnt mit einer Beschreibung von Persönlichkeitsprofilen. Diese bestehen aus den Verarbeitungskomplexen der Akkumulation personenbezogener Daten, der Profilbildung und der -verwendung. Anschließend werden sie unter die Tatbestandsmerkmale der Haftungsnorm Art. 82 Abs. 1 DS-GVO subsumiert. Für die hier anzustellende Bewertung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung werden die Grundsätze des Art. 5, die Erlaubnistatbestände des Art. 6 sowie die Spezialnormen der Art. 21 und 22 DS-GVO ausgelegt. Es wird gezeigt, inwieweit die Verarbeitungskomplexe mit ihnen vereinbar sind. Im Ergebnis ist das nur dann der Fall, wenn über sie ausreichend informiert wird und die Betroffenen wirksam zugestimmt haben. Auch die weiteren Haftungsvoraussetzungen können durch sie verwirklicht werden. Anspruchsberechtigter und -verpflichteter, Exkulpationsmöglichkeiten sowie Rechtsfolgen werden herausgearbeitet. Persönlichkeitsprofile können also einen Anspruch auf Schadensersatz auslösen.
Inhaltsverzeichnis
A. Problematik der Persönlichkeitsprofile
Digitalisierung Persönlichkeitsprofile Deliktische Haftung Persönlichkeitsprofile in der Forschung
B. Akkumulation, Bildung und Verwendung von Persönlichkeitsprofilen
Wirtschaftliche und politische Anreize Akkumulierung durch Digitalisierung Bildung von Persönlichkeitsprofilen Verwendung von Persönlichkeitsprofilen Einordnung als »Big Data«- Anwendung
C. Deliktische Haftung
Begründung und Rechtsfolge des Anspruchs nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO Gesamtergebnis
D. Fazit
Literaturverzeichnis
Digitalisierung Persönlichkeitsprofile Deliktische Haftung Persönlichkeitsprofile in der Forschung
B. Akkumulation, Bildung und Verwendung von Persönlichkeitsprofilen
Wirtschaftliche und politische Anreize Akkumulierung durch Digitalisierung Bildung von Persönlichkeitsprofilen Verwendung von Persönlichkeitsprofilen Einordnung als »Big Data«- Anwendung
C. Deliktische Haftung
Begründung und Rechtsfolge des Anspruchs nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO Gesamtergebnis
D. Fazit
Literaturverzeichnis
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. Mai 2023
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
247
Reihe
Internetrecht und Digitale Gesellschaft
Autor/Autorin
Erik Brüggemann
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
480 g
Größe (L/B/H)
236/160/18 mm
ISBN
9783428187522
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Persönlichkeitsprofile in der DS-GVO" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









