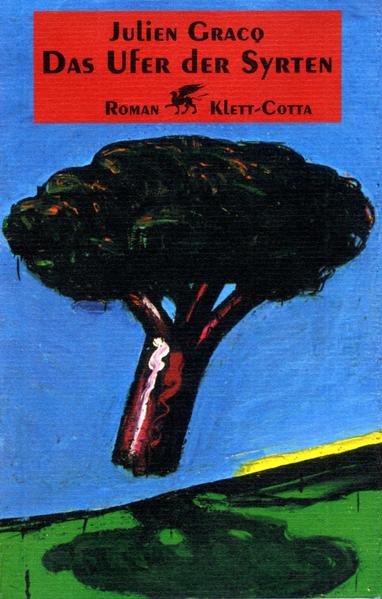
Zustellung: Mo, 12.05. - Mi, 14.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Das Ufer der Syrten erzählt von der Republik Orsenna, die seit einiger Zeit ihrem Untergang entgegengeht. Erinnerungen an ihre frühere Größe halten sie noch am Leben. Der Krieg gegen Farghestan gegenüber dem Meer der Syrten, der vor 300 Jahren begann, ist ein Kalter Krieg geworden. Ado, ein Adliger, will die Lethargie überwinden.
Gracq untersucht in diesem Roman, wie der Mensch sich mit seinem Schicksal auseinandersetzt. Wie wird er sich angesichts eines Ereignisses mit unbekannten Folgen entscheiden zu handeln? Soll man sich engagieren oder abwarten? Ado wartet nicht ab und handelt eher unbewußt, weil er mehr aus Zufall sich bei einer Ausfahrt zu sehr Farghestan nähert.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. August 2017
Sprache
deutsch
Auflage
3. Druckaufl
Seitenanzahl
358
Autor/Autorin
Julien Gracq
Übersetzung
Friedrich Hagen
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
kartoniert
Gewicht
394 g
Größe (L/B/H)
203/123/32 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783608962567
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 12.02.2025
Besprechung vom 12.02.2025
Die gefährliche Sehnsucht nach der erlösenden Tat
Julien Gracqs "Das Ufer der Syrten" handelt vom Untergang eines Staats. Der Roman zeigt: Was persönlich steigernd wirkt, kann politisch verheerend sein.
Julien Gracq ist der bekannteste Geheimtipp der französischen Literatur. Hochgeschätzt von einer gar nicht so kleinen Liebhabergemeinde, hat er schon wegen seiner stilisierten Sprache und abgelegenen Themen nie den Klassikerstatus eines Flauberts oder Prousts erreicht. Gracq trug selbst zum Mythos des Autors für Eingeweihte bei: Geboren 1910, hielt er sich zeitlebens vom Literaturbetrieb fern, wies dessen wichtigste Auszeichnung, den "Prix Goncourt", ebenso zurück wie später Einladungen zum Abendessen mit Präsident François Mitterrand. Statt durch die Talkshows und Journale zu tingeln, arbeitete er als Geschichtslehrer in Paris und zog sich nach seiner Pensionierung ganz in seinen Geburtsort an der Loire zurück, in dessen Nähe er 2007 starb.
Es gäbe viele gute Gründe, den Kreis der Eingeweihten zu erweitern und "Das Ufer der Syrten" zu lesen, Gracqs bedeutendstes Werk, für das er 1951 besagten "Prix Goncourt" erhalten sollte: die magisch-realistische Atmosphäre, die poetischen Beschreibungen, die geschichtsphilosophischen Reflexionen. Doch als "Pflichtlektüre für Demokraten"? Der fiktive Staat Orsenna, den Gracq in seinem Roman entwirft, hat mit dem alten Rom oder Venedig zweifellos mehr zu tun als mit dem Deutschland des 21. Jahrhunderts: Orsenna ist eine Adelsrepublik, deren jahrhundertealte Strukturen von wenigen Familien dominiert werden und in der Formen und Rituale derart wichtig sind, dass das Leben beinahe in ihnen erstarrt. Kaum etwas scheint weiter von der Sparkassenrepublik Deutschland entfernt.
Um zu verstehen, was "Das Ufer der Syrten" uns hier und heute dennoch zu sagen hat, müssen wir der Geschichte des Ich-Erzählers Aldo folgen. Aldo gibt sich wie andere Sprösslinge des alten Adels zunächst einer "überlegenen Langeweile" (ennui supérieur) hin, einem Leben zwischen einsamen Ausritten, akademischen Disputen und amourösen Abenteuern. Dessen überdrüssig, lässt er sich als politischer Beobachter ans Meer der Syrten versetzen (das ebenfalls fiktiv ist, aber an die "Kleine" und "Große Syrte", die antiken Namen der Golfe vor der tunesischen und libyschen Küste erinnert). Der kleine Stützpunkt dort gilt als verschlafen und militärisch unbedeutend: Zwar liegt jenseits des Meeres der Staat Farghestan, mit dem Orsenna sich offiziell im Krieg befindet, doch hat es Kampfhandlungen seit dreihundert Jahren nicht mehr gegeben.
Vom fernen Farghestan fühlt sich Aldo bald geradezu magisch angezogen. Das Festungsleben scheint ihm ebenso leer wie zuvor der Müßiggang in der Stadt. Dass der Kommandant sich lieber um die Weidewirtschaft als um die militärische Verteidigung kümmert, empfindet er als Verrat; überall sieht er unaufhaltsamen, aber uneingestandenen Verfall. Dagegen ist Aldo wie gebannt, wenn er im Kartenzimmer die Seegrenze nachzeichnet oder von einer Insel aus den kolossalen Vulkan an der Küste Farghestans erblickt. Immer mehr bildet er sich ein, dass etwas geschehen müsse, was die Mittelmäßigkeit seiner und Orsennas Existenz durchbricht: "Alles schlief in der Festung, aber es war der verstörte und bange Schlaf einer von Vorzeichen und Wundern trächtigen Nacht."
Eines Nachts wird die Sehnsucht zu groß: In Abwesenheit des besonnenen Kommandanten lässt Aldo sein Patrouillenboot die Demarkationslinie überqueren und vor der Küste Farghestans aufkreuzen. Der Lohn sind Momente eines gesteigerten Lebensgefühls, das Gracq grandios beschreibt: "Mir schien, als hätten wir eine Traumtür aufgestoßen. Das atemberaubende Gefühl einer seit Kindheitstagen vergessenen Fröhlichkeit überkam mich. Vor uns tat sich der Horizont in Glanz und Herrlichkeit auf. Wie von einem uferlosen Strom war ich getragen, seinem Strömen gänzlich ergeben. Eine wunderbar einfache Freiheit reinigte die Welt. Ich sah zum erstenmal die Geburt des neuen Tags."
Nicht ganz zufällig mögen diese Passagen an einige von Ernst Jüngers ästhetisierte Darstellungen seiner Kriegserlebnisse erinnern. Gracq bewunderte den fünfzehn Jahre älteren Deutschen; die "Syrten" sind maßgeblich durch dessen Erzählung "Auf den Marmorklippen" (1939) inspiriert (noch frappierender sind die Ähnlichkeiten zu Dino Buzzatis Roman "Die Tartarenwüste" von 1940, den Gracq aber nach eigener Aussage beim Verfassen seines Werks nicht kannte).
Die Anleihen an Jünger verweisen zugleich auf das Ambivalente und Problematische an Aldos träumerischem Vitalismus. Wenn die existenzielle Gefahr und das heroische Bewusstsein, sich ihr willentlich auszusetzen, eine ungemeine Steigerung der Wahrnehmung bewirkt, so kann das Gefürchtete eben auch jeden Moment wirklich eintreten und allem Bewusstsein ein Ende bereiten: Während Jünger euphorisch die Schlachtfelder durchschreitet, fällt um ihn herum ein Kamerad nach dem anderen. Und nicht zuletzt die Sehnsucht nach einer befreienden Grenzüberschreitung war es bekanntlich, die dem Ersten Weltkrieg den intellektuellen Boden bereitete.
So auch bei Gracq: Zwar kann Aldos Patrouillenboot dem Geschützfeuer an der feindlichen Küste knapp entgehen, doch folgt auf seine abenteuerliche Überfahrt die Wiederaufnahme des Kriegs durch Farghestan, die unweigerlich zum Untergang des schwach gerüsteten Stadtstaats Orsenna führen wird. Was persönlich also stark und steigernd wirken mag, kann politisch verheerend falsch sein. Das ist eine Botschaft, deren Bedeutung gerade Demokraten kaum überschätzen können.
Denn wer hätte noch nie Überdruss empfunden bei Betrachtung des politischen Betriebs, der Kompromisse und Koalitionen, der Mischung aus Stückwerk und großen Versprechen? Wem wäre das nicht schon einmal unerträglich mittelmäßig erschienen? Vor allem Demokratien ist eine ausgesprochene Prozessorientierung zu eigen, die sicherstellen soll, dass die Macht so breit wie möglich gestreut wird, häufig genug aber ermüdend wirkt und Gefühlen historischer Größe unzuträglich ist.
Wir müssen jedoch nicht bis zum Ersten Weltkrieg zurückgehen, um zu sehen, wohin das unbestimmte Verlangen nach einem Befreiungsschlag führen kann. Auch das Brexit-Votum oder die Trump-Wahlen, überhaupt die allseitigen Erfolge der Populisten scheinen von dem Bedürfnis genährt, endlich einmal gegen die Vernunft der politischen Klasse zu verstoßen und in dieser Grenzüberschreitung eine gesteigerte Form der Selbstwirksamkeit zu erfahren.
Gerade in Deutschland braut sich derzeit eine gefährliche Stimmung zusammen, in der sich Niedergangsängste mit Ohnmachtsgefühlen verbinden. Und gerade die idealistischen Deutschen sind historisch besonders anfällig dafür, einer fixen Idee die Herrschaft über die Wirklichkeit einzuräumen: In einer Zwischenbetrachtung seiner Hitler-Biographie bezeichnet Joachim Fest treffend den "Wirklichkeitsverlust" und den "Mangel an humaner Vorstellungskraft" als das spezifisch Deutsche am Nationalsozialismus. Noch scheinen zumindest die Intellektuellen in Deutschland gegen die Versuchung der ultimativen Grenzüberschreitung gefeit. Noch steht die Bundesrepublik eher für Pragmatismus als für Radikalismus. Aber ob die Trägheit der Merkel-Jahre nicht doch in Umsturzutopien umschlagen könnte, wenn die gegenwärtige Unruhe keinen demokratischen Ausfluss findet?
Gracq, um noch einmal zum Roman zurückzukehren, ist ein zu guter Schriftsteller, um Aldos Tat anhand ihrer Folgen einseitig zu verurteilen. Das Schlusswort hat vielmehr der kühle Danielo, der sich als heimlicher Strippenzieher entpuppt und das alternde Orsenna durch seine Vernichtung dem Kreislauf der Geschichte anvertrauen möchte. Es bleibt dem Leser überlassen, ob er sich Danielos an Oswald Spengler geschulte Sicht zu eigen macht oder doch das Ende einer großen Zivilisation bedauert.
Tatsächlich spricht ja vieles dafür, ästhetisch auf die Welt zu blicken, Mittelmäßigkeit zu verurteilen, Gefallen wie Aldo an der großen Tat oder gar wie Danielo am Untergang zu finden. Moralisch und politisch aber ist es geboten, sich für jenen demokratischen Staat einzusetzen, der unserer Phantasie eine sichere Grundlage gibt. "Das Ufer der Syrten" hilft, diese beiden Perspektiven zu unterscheiden. JANNIS KOLTERMANN
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








