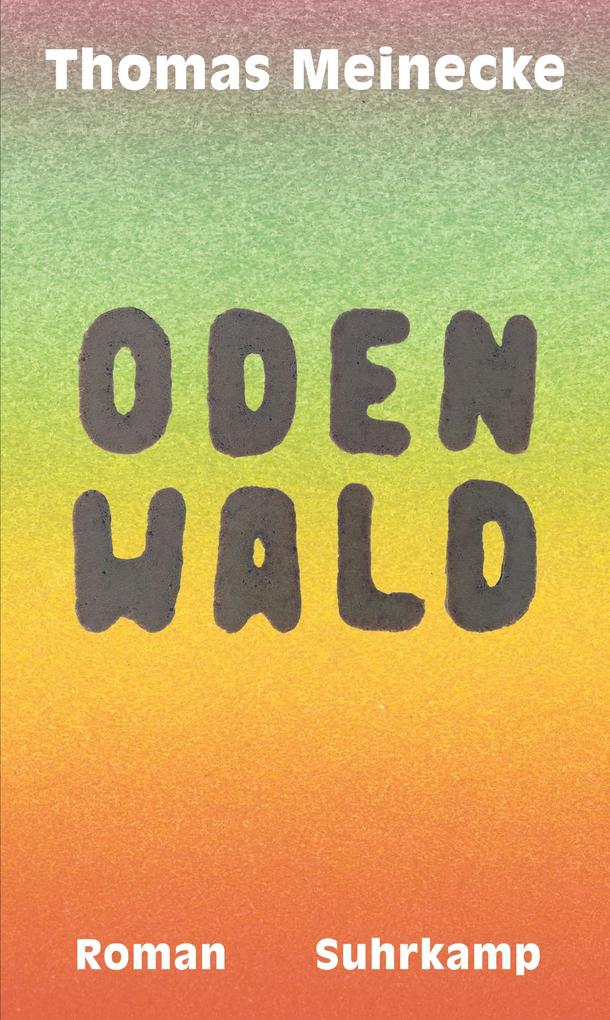
Sofort lieferbar (Download)
Amorbach im hinteren Odenwald, vor dem Hotel zur Post, in dem Theodor W. Adorno die Sommerfrische zu verbringen pflegte: Hier findet sich der Romancier Thomas Meinecke mit seinen Romanfiguren zu Forschungszwecken ein. Amorbach, so wird schnell klar, ist auch Adornobach, des exilierten Philosophen Traumort (an den hin er sich selbst von der Küste des Pazifiks häufig träumte). Der Odenwald bleibt nicht ohne Einfluss auf die Recherchen der Romanfiguren, er ist ein Oden- und ein Märchenwald, ein dunkler deutscher Forst, in dem neben Märchenfiguren auch als Räuber umherschweifende, vom regierenden Fürsten enteignete Waldbauern auftreten. Einige von ihnen wurden schon im 19. Jahrhundert nach Texas verfrachtet, so dass der Wilde Westen auch Thomas Meineckes neuem Roman seine Motive einschreibt.
In Odenwald flechten der Schriftsteller-Darsteller Meinecke und seine Hauptfiguren die roten Fäden einer ausgedehnten Recherche zum dekonstruktivistisch-feministischen Diskurszopf: Paul Preciados Rede vor Psychoanalytiker:innen in Paris geht mit gendersprachlich aufregenden mittelalterlichen Texten eine Verbindung ein. Die viel diskutierte Rückkehr der Körper, des Materiellen, des Materialismus wird verhandelt - auch im Privatleben der handelnden Personen. Und über allem liegt die Konzertmusik des 20. Jahrhunderts - das ist dieser Roman Adorno schuldig.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
14. Oktober 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
440
Dateigröße
2,15 MB
Autor/Autorin
Thomas Meinecke
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783518780398
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
». . . man kehrt bereichert aus der Lektüre zurück. « Moritz Bassler, Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung
». . . ein Buch, das sich allen Festlegungenentzieht. « Jakob Hayner, WELT AM SONNTAG
»Hier wird nicht behauptet, Literatur auf der Höhe der Zeit gehe nur so, hier probiert einer einfach aus, was passiert, wenn man einen Roman in die lässige Obsession verkehrt, mit allen möglichen Textsorten allen möglichen Motiven zu folgen. Ohne Anfang und Ende, Konflikt oder Erlösung. Fast wie im richtigen Leben. « Beate Meierfrankenfeld
»Ein Roman wie ein Rausch. « Heribert Vogt, Rhein-Neckar Zeitung
»Meinecke montiert, diskutiert und revidiert, von den Märchen der Gebrüder Grimm über Adorno bis zu Catherine Malabou und Paul B. Preciado. « Philosophie Magazin
». . . verspielt, anspruchsvoll und zugleich höchst vergnüglich. « Björn Hayer, der Freitag
»Die Materialfülle ist regelrecht kurzweilig. « Stefan Michalzik, Frankfurter Rundschau
»Wenn es je einem Roman . . . gelungen ist, die flimmernde Schönheit und Sinnlosigkeit des Wissens und der Welt in ein Buch zu binden, dann ist dies Odenwald von Thomas Meinecke. « Andreas Ammer, Münchner Feuilleton
». . . ein Buch, das sich allen Festlegungenentzieht. « Jakob Hayner, WELT AM SONNTAG
»Hier wird nicht behauptet, Literatur auf der Höhe der Zeit gehe nur so, hier probiert einer einfach aus, was passiert, wenn man einen Roman in die lässige Obsession verkehrt, mit allen möglichen Textsorten allen möglichen Motiven zu folgen. Ohne Anfang und Ende, Konflikt oder Erlösung. Fast wie im richtigen Leben. « Beate Meierfrankenfeld
»Ein Roman wie ein Rausch. « Heribert Vogt, Rhein-Neckar Zeitung
»Meinecke montiert, diskutiert und revidiert, von den Märchen der Gebrüder Grimm über Adorno bis zu Catherine Malabou und Paul B. Preciado. « Philosophie Magazin
». . . verspielt, anspruchsvoll und zugleich höchst vergnüglich. « Björn Hayer, der Freitag
»Die Materialfülle ist regelrecht kurzweilig. « Stefan Michalzik, Frankfurter Rundschau
»Wenn es je einem Roman . . . gelungen ist, die flimmernde Schönheit und Sinnlosigkeit des Wissens und der Welt in ein Buch zu binden, dann ist dies Odenwald von Thomas Meinecke. « Andreas Ammer, Münchner Feuilleton
 Besprechung vom 13.10.2024
Besprechung vom 13.10.2024
In den Beuteln des Textes
In seinem neuen Roman "Odenwald" gerät Thomas Meineckes postmoderne Zitatprosa unter den Druck aktueller Identitätsdebatten.
Thomas Meinecke's next novel begins in front of the Hotel zur Post in Amorbach, Odenwald", heißt es in Thomas Meineckes neuem Roman "Odenwald". Im englischen Originallaut wird hier die Ankündigung einer Lesung des Autors in den USA zitiert, und damit ist über die Machart dieses Buches schon einiges gesagt. Die vorbereitenden Reisen durch das titelgebende Mittelgebirge und durch die Archive, auf den Spuren Adornos, Siegfrieds oder der Grafen zu Leiningen sowie durch Texas zu den Nachkommen der im 19. Jahrhundert ausgewanderten Odenwälder, vor allem aber Meineckes wuchernde Sammlung von Texten über alle möglichen Formen von Gender-Trouble (von Achilles in Frauenkleidern bis zur feministischen Transphobie), aber auch über Jazz und Neue Musik, dazu Gespräche und Mails mit Freundinnen und Experten, Forschungsarbeiten bis hin zu eigenen Texten des Autors - all dieses Material geht nicht bloß in den Roman ein, es ergibt, sorgfältig zerschnitten, montiert und arrangiert, den Roman selbst.
Wer Meinecke liest, kennt das alles gut. Sowohl das Verfahren der Zitatmontage als auch die thematischen Schwerpunkte hat der Autor in seinem Gesamtwerk seit den Neunzigerjahren konsequent entwickelt. "Frauen, Körper, Phallus, die ganze speziell daran drangehängte Theorie", wie Rainald Goetz das etwas skeptisch nannte (natürlich im Roman zitiert), dazu Transatlantisches und Musik, das sind die vielbegangenen Orte, die Topoi von Meineckes diskursivem Schreiben. Mit der Rückkehr in den Odenwald wird insbesondere "Tomboy" "revisited", jener Roman, mit dem Meinecke in den späten Neunzigern zu einem führenden Vertreter des sogenannten Suhrkamp-Pop wurde (neben Goetz und Andreas Neumeister). Damit steht "Odenwald" in einer hochinteressanten Reihe von Gegenwartsromanen mit Benjamin von Stuckrad-Barres "Panikherz" und Christian Krachts "Eurotrash", die den Pop der frühen Jahre ("Soloalbum", 1998, respektive "Faserland", 1995) unter den Bedingungen einer Post-Postmoderne noch einmal prüfend Revue passieren lassen - Stuckrad-Barre im Sinne einer neuen Ernsthaftigkeit, Kracht auf der Suche nach einer komplexen, postironischen Form von Autofiktion. Und Thomas Meinecke?
Gleich zu Beginn zitiert der Roman ausführlich eine einschlägige Passage aus "Tomboy", in der zwei Protagonistinnen Dildosex im "real existierenden Judenwald" haben, und kommentiert dann: "Echt too much, findet Thomas heute." In der Tat hatte Meinecke bereits damals rasch erkannt, dass die komplexen Genderverwicklungen seiner Figuren bisweilen ungewollt komisch wirkten, während es ihm doch um eine Reflexion der Theorien Judith Butlers ging. Daraus zogen seine Nachfolgeromane von "Hellblau" (2001) an die Konsequenz, das Figurenarsenal zu stutzen und die Handlung zugunsten der Zitatflächen stark herunterzufahren. Dabei ist es geblieben: Die wenigen Figuren, die neben der Autorpersona Thomas in "Odenwald" noch auftreten, sind Paare, deren Ideal liebender Zweisamkeit darin zu bestehen scheint, sich interessiert über dessen oder verwandte Texte zu beugen und gelegentlich das Smartphone zu einzelnen Fakten zu befragen, womit sie die gewünschte Rezeption des Romans verkörpern.
Im Übrigen aber scheint Meinecke mit seinem einmal entwickelten Verfahren, dem Zitieren ohne Anführungszeichen und der hierarchiefreien Ausbreitung seiner Themen, bis heute ebenso glücklich zu sein wie mit Judith Butlers feministischer Postmoderne. Dass beides der queeren Sache angemessen ist, lässt er sich aus der Sekundärliteratur ebenso bestätigen wie von den bewährten postmodernen Theoretikern und Denkerinnen. In Ursula K. Le Guins feministischer, aktuell sehr angesagter Tragetaschentheorie des Erzählens findet er sogar noch eine neue Verbündete. Das Verwendbare in den Beutel des Texts sammeln, statt auf Killerpointen ausgerichtete Jagdgeschichten zu erzählen, entspricht in der Tat dem Grundprinzip seiner Literatur. Und Helden braucht man dazu auch nicht mehr, die sehen in der Tragetasche eh aus "wie Kartoffeln".
Nun stammt Le Guins Programmatik aus den Achtziger-, Meineckes Diskurspop-Prosa aus den Neunzigerjahren - und was man damals auf seinem intellektuellen Weg fand und an Theorie, Literatur und entlegener Musik (wie diesmal Julius Eastman und Arthur Russell) in den Sammelbeutel steckte, das war oft wirklich individuell und besonders; in Popzusammenhängen diente es nicht zuletzt der Distinktion. Wie ist es aber heute, da sämtliche kulturellen Bestände in den digitalen Archiven auf Knopfdruck zur Hand sind und alle alles in wenigen Minuten kennen können? Ähnelt unsere digitale Tragetasche nicht eher dem bekannten Warenkorb auf dem Bildschirm rechts oben ("An queeren Phänomenen interessiert? You may also like . . .")? Zumindest wären Le Guins Theorie und eine literarische Programmatik, die sich im 21. Jahrhundert darauf beruft, auf diese aktuellen Bedingungen hin neu zu reflektieren und womöglich auch zu modifizieren.
Sollte man meinen. Aber genau das, "die Infragestellung einer Position durch eine andere", ist ausdrücklich nicht das, was Thomas Meinecke sich unter Kritik vorstellt. Sein Roman feiert im Gegenteil die Einsicht, dass das "Wesen des kritischen Denkens nicht im Urteil" liege, sondern in dessen Unterbrechung, und somit auf "die Veränderung des Feldes" ziele, "auf dem die Setzungen, die Werte und Urteile verzeichnet sind". Passend zum Namen von Adornos Kindheitsort Amorbach soll Kritik eine Praxis der liebenden Verflüssigung bleiben, auch im (Oden-)Wald bleibt sie "des Baumes müde" und eher dezentralen Wurzelgeflechten zugeneigt. Mag das Hotel zur Post auch kaputtsaniert sein, die Postmoderne bleibt das geistige Dach.
"Writing is not arriving", wie Hélène Cixous zustimmend zitiert wird. Darin liegen die strenge formale Konsequenz wie auch der anhaltende Charme von Meineckes Büchern. Ob Texas oder Bayern - man reist in der Fläche und nicht, um irgendwo anzukommen. Die aufgesammelten Fundstücke werden zwar begeistert gelistet und besprochen, sie reichern das diskursive Gewebe des Romans an, aber argumentativ durchgearbeitet werden sie nicht. Dadurch bleiben die Texte einerseits angenehm offen und unideologisch. Selbst dort, wo Meinecke sich selbst zitiert, etwa mit Bemerkungen gegen Tendenzen in den "neueren Identitäts-Diskursen", handelt es sich eben um Zitate unter anderen, subjektiv wie historisch situiert und somit ausdrücklich zur Revision freigegeben.
Andererseits fragt man sich aber auch, was man damit jetzt eigentlich anfangen soll. Einen eigenen Tragebeutel aufmachen und sich aus den immerhin 430 Seiten von "Odenwald" das herausklauben, an dem man selbst Freude hat? Da findet sich sicher für jeden was, etwa die bahnbrechende Erfindung der Schneekugel aus dem Geiste des ovalen Rückfensters eines im Schnee stecken gebliebenen VW-Käfers, den Unterschied zwischen Romper und Jumpsuit oder das Singspiel "Der Schatz des Indianer-Joe", verfasst vom selben Adorno, der unnachgiebig auf den Jazz schimpft und dafür im Roman viel Platz eingeräumt bekommt. Das müsste man dann ja für sich nicht einsammeln. Aber ist es so gemeint? Letztlich geht es Meinecke doch um den Diskurs. Wenn also sein Roman, um ein Beispiel zu nennen, zum Thema Transmänner und -frauen, das bekanntlich seit einiger Zeit breit und ziemlich aufgeregt diskutiert wird, eine Reihe von historischen und aktuellen Phänomenen vorführt sowie diverse, darunter recht kritische Positionen zitiert (Trans affirmiere eigentlich die bipolare Geschlechtsordnung, beispielsweise): Sollen wir dann dazu eine eigene Position entwickeln? Oder sollen wir, im Sinne von Meineckes Begriff von Kritik, das Ganze bloß neutral als verändertes Feld zur Kenntnis nehmen? Was wäre damit gewonnen? Und wie steht es mit anderen potentiell kontroversen Dingen wie den zahlreichen Komplimenten, in denen sich Figuren des Romans, Frauen sowie feminine Männer, auch in einzelnen Körperteilen mit bekannten Personen vergleichen ("Bisschen wie diese eine französische Schauspielerin, - die aber nicht ganz so schön wie du ist.")? Ist das jetzt "uncharmant, übergriffig, ja, invasiv"? Und warum dann überhaupt?
Oder die häufige Verwendung des N-Wortes, auch des wirklich fiesen. Das findet sich beispielsweise in den Titeln des schwarzen, homosexuellen Musikers Eastman, und der durchgehende Zitatcharakter erlaubt Meinecke die unveränderte Aufnahme in seinen Romantext - obwohl er selbstredend auch hier die Problematik kennt. Will er mit dieser Entscheidung unser diskursives Feld erweitern, sollen wir uns daran reiben oder uns entspannen? Oder was sonst? Anders gefragt: Ist das jetzt echt too much oder womöglich im Gegenteil etwas zu wenig?
Ich sage mal so: Thomas Meinecke bleibt in "Odenwald" seinen Themen, seinem literarischen Ansatz und der postmodernen Theorie treu. Man liest das immer noch gern und kehrt bereichert aus der Lektüre zurück. Und doch hat sich etwas verändert: Das ganze Verfahren ist, könnte man sagen, durch die veränderten Umstände unter ungewohnten Druck geraten und weiß das auch, möchte sich aber nicht verteidigen. Die digitalen Archive, die verschärften Diskurse um Identität, Gender und kulturelle Appropriation, die Bedrohung der westlichen Demokratien, von der Klimakatastrophe gar nicht zu reden (merkt man davon im Odenwald noch nichts?): All das scheint auf Positionierungen zu drängen, die Meinecke bewusst verweigert.
Nun liegt es mir umgekehrt ganz fern, ihn deshalb aus Sicht irgendwelcher aktuellen Diskursparteien zu kritisieren, zu deren Immer-schon-recht-Haben sein literarisch-diskursives Langzeitprojekt ja eine wohltuende Alternative anbietet. Vielleicht trifft auf seine Romane am ehesten zu, was "Odenwald" zum Thema Reliquien sagt: Sie seien "so etwas wie die Boten aus einer Zeit, in der es auch alles oder wenigstens etwas hätte anders enden können". MORITZ BASSLER
Thomas Meinecke, "Odenwald". Roman. Suhrkamp, 440 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Odenwald" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









