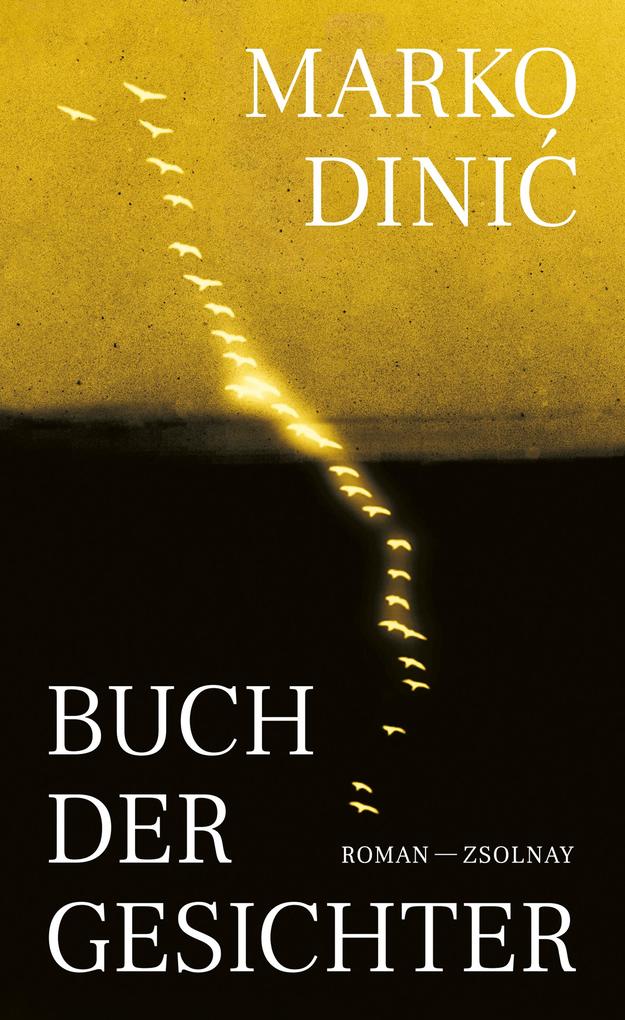Besprechung vom 25.07.2025
Besprechung vom 25.07.2025
Über Erwartungshorizonte hinaus
Einfache Sprache, komplexe Stoffe, große Liebe zur Literatur: Der kommende Bücherherbst hält viel Belletristisches parat, das uns beim Lesen herausfordern wird. Der Ausblick auf besonders bemerkenswerte Neuerscheinungen.
Ende der kommenden Woche kommt ein höchst ungewöhnliches Buch heraus. Es heißt "Einen Vulkan besteigen" und geht selbst einen riskanten Weg. Seine Autorin ist Annette Pehnt, ihres Zeichens nicht nur eine der profiliertesten und wandlungsfähigsten deutschen Schriftstellerinnen, sondern seit einigen Jahren auch Professorin am Literaturinstitut der Universität Hildesheim, das sich neben dem Deutschen Literaturinstitut Leipzig und dem in Biel angesiedelten Schweizerischen Literaturinstitut als einer der drei wichtigen Prüfstände für den Eintritt ins deutschsprachige literarische Leben etabliert hat. Man könnte auch sagen: Bevor junge Autoren nach Berlin umziehen, stellen sie ihr Talent in Hildesheim, Leipzig oder Biel auf die Probe. Unter anderen bei Annette Pehnt.
Die sich immer wieder auch selbst auf die Probe stellt. Diesmal mit einer Textsammlung, deren inneren Zusammenhang die Form bildet. Pehnt klassifiziert die Bestandteile ihres Buchs als "minimale Geschichten", deren längste denn auch gerade einmal vierzehn Seiten umfasst - und das jeweils in einem lockeren Zeilenumbruch, der an Prosagedichte denken lässt. Doch so populär diese Form jüngst auch geworden ist, das sind diese Texte nicht. Vielmehr gehorchen sie den Regularien eines Schreibprogramms, das Ende des letzten Jahrzehnts am Literaturhaus Frankfurt begründet wurde: LiES - Literatur in Einfacher Sprache. Seine Maximen, wie sie Pehnt in der Nachbemerkung zu "Einen Vulkan besteigen" (Piper Verlag, 281 S., geb., 24,- Euro; Erscheinungsdatum am 1. August) zusammenfasst: Verzicht auf komplizierten Satzbau und Passivkonstruktionen, auf Sprachbilder, indirektes Sprechen und Fachbegriffe, in jedem Satz nur eine Information und für jeden dieser Sätze eine eigene Zeile, knappe Geschichten in linearem Ablauf, Vermeidung von Zeitsprüngen und wechselnden Erzählperspektiven. Man ist versucht zu sagen: Da wird alles beseitigt, was anspruchsvolle Literatur ausmacht; einen "Ulysses" schreibt man so nicht. Aber wer schreibt den schon?
Annette Pehnt schreibt etwas ganz anderes, und das ist auf seine Weise auch meisterhaft und abenteuerlich. Nicht weil es in der Titelgeschichte tatsächlich an den Rand eines Vulkankraters geht und es mit dem letzten Satz offenbleibt, ob die Ich-Erzählerin abstürzt oder nicht. "Ich stolpere", lautet er, und das ist einer der kürzesten Sätze im Buch, dessen längster immerhin zwanzig Wörter umfasst ("Wenn wir ein Bier zusammen trinken, reden wir über seinen Urlaub, seine Geschäfte, seine Rennräder, seine Freunde Olli und Marc") und nicht mehr in eine einzige eigene Zeile passt, sondern deren drei benötigt. Da missachtet Annette Pehnt also durchaus souverän nicht nur eine der Einfachheitsregeln von LiES, sondern auch die empirisch gestützte Erkenntnis, dass ein Großteil der Menschen nach siebzehn Wörtern den Sinnzusammenhang eines Satzes verliert.
Es zeichnet die Autorin aus, dass sie also bisweilen ganz ohne erzählerische Not die selbst gewählten Grenzen überschreitet. Mutwillig ist das, im besten buchstäblichen Sinne. Man könnte auch sagen, Annette Pehnt lässt hier und noch ein paar weitere Male aufscheinen, was aus der Einfachen Sprache doch wieder zur Literatur führen könnte. Eine strikte Reduktion nach Regelwerk hätte ja auch etwas Herablassendes, würde diejenigen, die als Adressaten solcher Texte gelten, abstempeln zu unverbesserlich schlichten Gemütern - wie es etwa jeden Freitagabend in der schauerlichen Nachrichtensendung in Einfacher Sprache geschieht, die der Deutschlandfunk ausstrahlt (zum Glück nur dieses eine Mal in der Woche, was ja schon zeigt, dass da keine Überzeugung herrscht, etwas Sinnvolles zu tun; es ist peinliche Affirmation einer paternalistisch-politischen Erwartung). Pehnt erfüllt mit ihrem Buch keine Erwartungen, sie überrascht mit ihrem Wagemut in der einen wie der anderen Richtung: Hin zur Einfachen Sprache und dann doch auch wieder weg von ihr. Literatur, die diesen Namen verdient, reicht ja immer über den vertrauten und damit bequemen Horizont hinaus - erzählerisch, stilistisch und auch pädagogisch.
Natürlich auch geographisch. Etwa bis Guatemala, einem selten gesehenen Schauplatz deutschsprachiger Literatur. Der beste Roman dieses Bücherherbstes findet dort seinen Schauplatz: Dorothee Elmigers Roman "Die Holländerinnen" (Hanser Verlag, 159 S., geb., 23,- Euro; 19. August), und schon die Diskrepanz zwischen Titel und Schauplatz ist ein Coup. Elmiger durchlief die Kaderschmieden in Biel und Leipzig und hat mit jetzt vierzig Jahren schon drei viel beachtete andere Romane veröffentlicht, doch "Die Holländerinnen" übertrifft sie alle. Würde man den Gegenentwurf zur LiES-Poetik vorgeführt bekommen wollen, dann hier: Schon der erste Satz des ersten Kapitels (nicht der erste Satz des Buches!) geht über elf Zeilen mit fast hundert Wörtern, die Erzählperspektive wechselt permanent (eine auktoriale Stimme berichtet vom Vortrag einer Schriftstellerin, die darin von einem zurückliegenden Erlebnis im guatemaltekischen Urwald erzählt, das erst durch die Stimmen diverser daran Beteiligter in seiner Gesamtheit sichtbar wird und doch undurchschaubar bleibt. Das ist inhaltlich (Dschungel), formal (Erzählsituation) und vor allem metaphysisch (Konfrontation der westlichen Zivilisation mit ihren eigenen Abgründen im Erleben des Fremden) eine aktualisierende Hommage an Joseph Conrads berühmte Erzählung "Herz der Finsternis", was einmal auch durchs explizite Zitieren der berühmtesten Formulierung daraus klargestellt wird: "der Horror, der Horror". Und der, so wird von der erzählten Erzählerin ausgeführt, "liege naturgemäß außerhalb der Sprache". Natürlich weiß Dorothee Elmiger selbst es besser. Und führt es vor.
In diesem Roman wird demonstriert, was aus dem Wissen um und dem Umgang mit Klassikern zu gewinnen ist. Und zwar durch unmittelbare Anknüpfung, nicht durch die gängige Neukombination von deren Versatzstücken, wie es etwa einer der international bereits vor Erscheinen höchstgehandelten jungen Stimmen der deutschsprachigen Literatur betreibt. Nelio Biedermann, gerade einmal Anfang zwanzig, hat als sein bereits viertes Buch einen Roman namens "Lázár" (benannt nach der die Protagonisten stellenden ungarischen Familie; Rowohlt Berlin Verlag, 331 S., geb., 25,- Euro; 9. September) geschrieben, der alsbald in mehr als zwanzig Ländern erscheinen wird. Der Schweizer mit ungarischen Wurzeln väterlicherseits war nicht in Biel, Leipzig oder Hildesheim, sondern studiert noch an der Universität Zürich, unter anderem Filmwissenschaft, und die resultierende erzählerische Wahrnehmungserfahrung merkt man dem Konstruktionsprinzip von "Lázár" an: Schuss-Gegenschuss-Szenen zuhauf, harte Schnitte, gefühlssatte Dialoge, als müssten damit Starschauspieler gelockt werden. Dazu ein paar breitbeinig auftrumpfende Floskeln, wie sie das Privileg jugendlichen Ungestüms sind: "Der Schriftsteller fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem Glück, was nur verständlich ist, denn Schreiben ist Konservieren, Festhalten, Ordnen, das Glück aber meidet die Sprache, entzieht sich den Wörtern, versteckt sich in der Vergänglichkeit und zerfällt, wenn man es zu erklären versucht." Ein Glück, dass Biedermann selbst es bei diesem einen Erklärungsversuch belässt.
Was "Lázár" zu erzählen hat, ist indes allemal beachtlich: eine Geschichte Ungarns von der späten Doppelmonarchie über die Verstümmelung im Vertrag von Trianon 1920, die Etablierung als eigenständiges Königreich in der Zwischenkriegszeit, das Bündnis mit Hitlers Drittem Reich, die deutsche Besatzung von 1944 bis zur von der Sowjetunion bestimmten Politik nach dem Zweiten Weltkrieg, die schließlich den Aufstand von 1956 provozierte. Wer weiß das heute schon noch? Und was interessiert daran jemand, der Anfang zwanzig ist? Das Beeindruckendste neben der erzählerischen Süffigkeit von Biedermanns Roman ist, dass sich bei dessen Lektüre nie das Gefühl des Gesuchten einstellt - dass dem Autor der Stoff organisch zugefallen scheint. Und dass sich dieser junge Schriftsteller traut, sich zunächst unausgesprochen bei "Die Toten" von James Joyce zu bedienen, um drei Seiten später das Schicksal einer seiner Figuren - der interessantesten, obwohl sie gar nicht der Familie Lázár angehört - ganz offen mit einer der schönsten Liebeserklärungen an Proust zu verbinden.
Aber verglichen mit Elmigers Buch ist das Literaturliteratur, nicht eigenständig souveränes Erzählen: Wo der Roman "Die Holländerinnen" erklärtermaßen auf den Schultern eines literarischen Riesenwerks steht und gerade deshalb darüber hinausgelangt, klammert sich "Lázár" an seine literarischen Vorbilder (natürlich auch Thomas Mann oder der magisch angehauchte Realismus von Günter Grass) und gewinnt im Genre des psychologischen Romans nicht an Höhe. Das gelingt anderen Romanen der kommenden Saison: Sten Nadolnys in gleich dreifach gebrochener Erzählperspektive gehaltener "Herbstgeschichte" über die mit Verspätung lebensverändernde Begegnung zweier Männer mit einer Frau, dem ersten Buch des Altmeisters seit acht Jahren (Piper, 239 S., geb., 24,- Euro; 2. Oktober), Katerina Poladjans "Goldküste" über das Anerzählen eines Analysanden gegen seine Analytikerin (S. Fischer, 159 S., geb., 22,- Euro; 27. August) oder mit gewissen Abstrichen Marko Dinics "Buch der Gesichter" über einen Belgrader Schreckenstag im Zweiten Weltkrieg, von dem aus sich rückblickend Lebenswege von Nonkonformisten und Opportunisten erklären (Zsolnay, 461 S., geb., 28,- Euro; 19. August), sowie dem - Warnung an jargonsensitive Leser! - gendersprachenaffirmativen "Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich" von der Leipzig-Absolventin Kaska Bryla, in dem vom Überwinden der Isolation in Corona-Zeiten erzählt wird (Residenz, 256 S., geb., 26,- Euro; 11. August).
Ganz besonders psychologisch und stilistisch geglückt ist indes Dagmar Leupolds Roman "Muttermale" (Verlag Jung und Jung, 172 S., geb., 24,- Euro; 18. September). Sein Ausgangspunkt mag als oft gelesen gelten, zuletzt etwa in Dörte Hansens "Altes Land": die Fluchtgeschichte einer Frau aus Ostpreußen. Diese hier wird zur Mutter von Leupolds Ich-Erzählerin, und wie die frühe Prägung durch eine verlorene Heimat noch die nächste Generation beeinflusst, das ist selten so eindrucksvoll beschrieben worden wie hier. Das frühe Kapitel "Blümerant" etwa hebt an mit einer Beschreibung seines Titelworts: "Im dunkelsten Winkel der Asservatenkammer gelagert, in der Nähe des Pfui, bei dessen Aussprechen die Lippen so gespannt waren wie ein Katapult, damit das Verworfene und Verwerfliche so weit wie möglich wie nur irgend möglich ausgespien werden konnte. Blümerant dagegen war die einigermaßen behaglich auszusprechende Chiffre für einen Zustand des Unwohlseins, der, wie die Wortverhunzung des französischen bleu mourant selbst, trüb, unklar, schlammig blieb und dadurch ertragbar. Sterbendes Blau, die Farbe erfrorener Lippen." Und damit sind wir semantisch wieder bei der winterlichen Fluchterfahrung der Mutter angelangt.
Auch das, worauf der Roman hinausläuft, ist schon oft erzählt worden: der Tod der Mutter. Und im Krematorium erinnert sich die Tochter daran, was die Verstorbene am meisten fürchtete: "die Art von Schmerz, die durch Schwieriges erzeigt wird. Schwieriges, das seine Notwendigkeit nicht leugnet, sondern zeigt. Diesen Schmerz habe ich dir bereitet", die Tochter war Schriftstellerin geworden. Eine kompromisslose.
Das ist auch Leupold. Wir haben bei ihr alles andere als Einfache Sprache gelesen: fremdwortreich, bildmächtig, verschachtelt, im Auftaktsatz zur ersten zitierten Passage sogar ohne explizites Subjekt. Also noch ein Gegenstück zu Annette Pehnts minimalen Geschichten, obwohl sowohl Dagmar Leupold (die anderthalb Jahrzehnte lang das Studio Literatur und Theater der Universität Tübingen leitete) als auch Dorothee Elmiger ja dem Umfang ihrer Bücher nach so etwas wie minimale Romane geschrieben haben. Doch was für ein Sprach-, Stil- und Handlungsreichtum in beiden Büchern. Während sich Pehnt, wie sie ausführt, beim Schreiben ständig gefragt hat: "Worauf kommt es wirklich an? Und wie lassen sich in der radikalen Reduktion Zwischentöne, Anklänge, Unterschwelliges erzeugen?" Dass es ihr gelungen ist in den insgesamt fünfunddreißig Geschichten ihres Buchs, verdankt sich dessen innerem Verbund, der dann doch alles das wiederliefert, was zugunsten des LiES-Regelwerks auf der Mikroebene der Einzelgeschichten aufgegeben werden musste: Multiperspektivität, Zeitsprünge, Informationsvielfalt, Interlinearität. Mithin das, was Literatur ausmacht. Auch in Einfacher Sprache. ANDREAS PLATTHAUS
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.