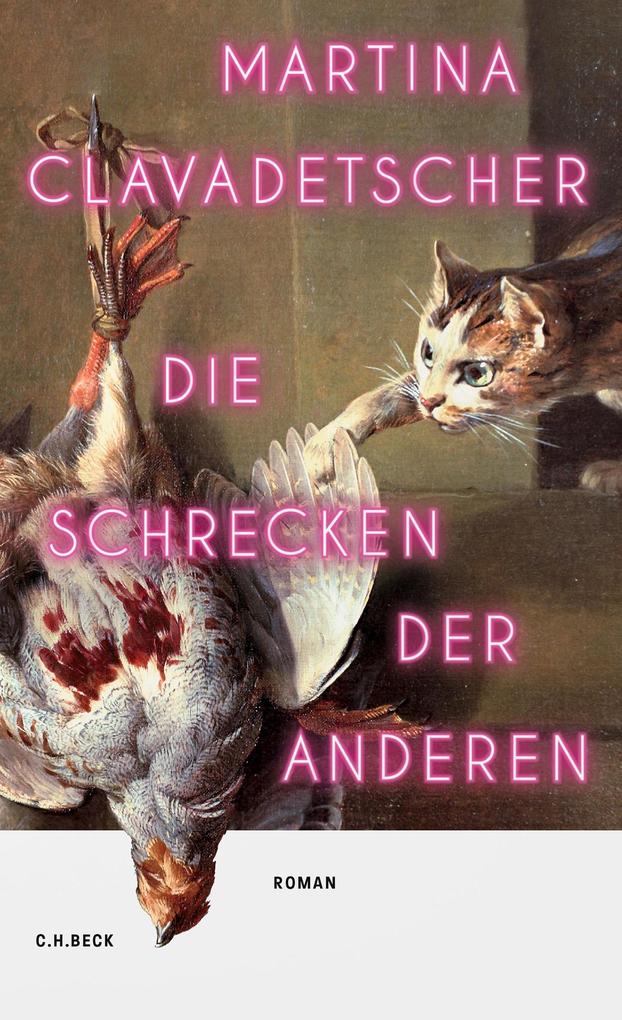
Ein Junge stößt beim Schlittschuhlaufen auf einen Toten im Eis und den Beginn einer sonderbaren Geschichte. Kern, ein schwerreicher Erbe, kann nicht länger ignorieren, dass seine Augen schwächer werden. Doch will er überhaupt klarsehen? Da ist Kerns hundertjährige Mutter, die den größten Teil des Tages im Dachgeschoss der Villa im Bett liegt, und doch mit brutaler Konsequenz die Fäden in der Hand hält. Da ist Schibig, ein einsamer Archivar, der sich mitreißen lässt von Rosa, der Alten aus dem Wohnwagen, die an den eigentlich unspektakulären Vorfällen ein spektakuläres Interesse hat - weil sie versteht, dass nichts je ins Leere läuft, sondern alles miteinander verbunden ist: Der Tote im Eis, die Zylinderherren im Gasthof Adler, Kerns Frau, die sich weigert, Kreide zu essen, ein geplantes Mahnmal, bedrohliche Bergdrachen und andere hartnäckige Legenden.
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 01.10.2025
Besprechung vom 01.10.2025
Drachen im Hochgebirge
Alte Seilschaften, neue Verantwortung: Martina Clavadetschers Roman "Die Schrecken der anderen" ergründet die Schweizer Geschichte.
Jeder Tote auf den ersten Seiten eines Romans ist ein jähes Zuviel, das hypothetisch, kriminalistisch, erzählerisch in die Gleichung eines Lebens gebracht werden muss. Der Tote muss ein Gestorbensein haben. In Krimis geschieht das meistens über Um- und Abwege. Am Anfang dieses Buchs flitzt hingegen ein Dreizehnjähriger auf den Schlittschuhen ziemlich gradlinig übers Eis, stolpert plötzlich, schaut näher hin, erschrickt, ruft die Polizei und setzt im Moorgebiet eines Schweizer Bergsees eine Fahndung in Gang, die tief in die Gründe rumorender Zeitgeschichte und alter Sagen hinabreicht.
Die Schweizerin Martina Clavadetscher. 2021 ausgezeichnet mit dem Schweizer Buchpreis, ist durch ihre Romane und Theaterstücke eine Spezialistin der Spannung zwischen Unter- und Vordergründigem. In ihrem vierten Roman dringt sie, vordergründig in Form eines Krimis, in die wohlgeordnete Welt einer Dorfgemeinschaft ein, wo mit fröhlicher Alltagslaune historische Altlasten auf Distanz gehalten werden.
Der von der Welt draußen überforderte Kriminalarchivar Schibig lässt sich widerwillig aufs Eis des Ödwilersees schicken, um die Sache nach dem Notruf jenes Jungen zu klären, der auf den Schlittschuhen über einen aus dem Eis ragenden Jeansfetzen gestolpert ist. Und tatsächlich liegt dort im Eis eine Leiche. "Die bleiben doch sonst unten bei dieser Jahreszeit", wundert sich der Mann.
Dasselbe findet auch eine Alte namens Rosa, die rauchend und whiskytrinkend aus ihrem Wohnwagenfenster am Rand des Sees so allerhand mitbekommt und nun plötzlich neben Schibig steht. Zu zweit machen die beiden - sie aus einem nicht ganz durchschaubaren Trieb zur Klärung, er an ihrer Seite in berauschender Wiederentdeckung des realen Lebens - sich ans Ermitteln eines Falls, der von den Behörden schnell als banaler Mord oder Selbstmord abgetan wird.
Auch dass die Identität und die Geschichte des Toten so gut wie bedeutungslos sind, entspricht in diesem Buch exakt den Gepflogenheiten des klassischen Krimis. Das Sterben, das ihm verweigert wird, kommt hier einer Hundertjährigen zu, die wirres Zeug faselnd, scharf denkend und dezidiert handelnd in einer Villa ihrem Ende entgegenstirbt. Sie ist Erbin eines reichen lokalen Fischzüchters, der in den Dreißigerjahren mit Berlin gute Geschäfte machte, dann vergeblich den Anschluss der Schweiz ans Reich erwartete, auch danach aber an diskreten, nunmehr aus Südamerika kommenden Geldflüssen beteiligt blieb. Dieses nicht nur finanzielle, sondern auch ideologische Erbe aus Weltläufigkeit und Bodenständigkeit verwaltet die Hundertjährige nun aus ihrem Sterbebett, weil ihr schwächlicher, mit halluzinatorischen Sehstörungen kämpfender Sohn, von allen nur mit seinem Nachnamen Kern genannt, dazu unfähig ist.
Wie Schibig sich aus der Realität in alte Drachensagen flüchtet, tappt dieser Kern in seinen "Star Wars"-Visionen herum. Er drückt sich davor, den Vorsitz der "Nationalen Front" zu übernehmen, eines obskuren Herrenklubs, der statt von politischen Bühnen herab lieber durch diskrete Förderung von Privatschulen der Jugend zu mehr völkischer Durchsetzungskraft verhelfen will. Das neue Denkmal des Zweiten Weltkriegs gleich neben dem ehemaligen Schlachtfeld, auf dem die Eidgenossen einst die Habsburger schlugen, vermag diese Lobby zwar nicht zu verhindern. Ein Monolith mit Reichsadler hinter dem Dorffriedhof bleibt aber stehen, und in einer Scheune treffen sich ein paar Wirrköpfe von der "Jungen Aktion", vom Nachrichtendienst überwacht und schnell vergessen.
All das ist schwere, vielleicht zu schwere Themenkost für dieses Buch. Was in den ersten Kapiteln atmosphärisch geschickt aufgebaut wird als bedrückende Größe einer Gebirgslandschaft, in welcher nicht nur das Methangas aus den halb verwesten Torfschichten heraufdrückt, verliert sich in Einzelszenen und überflüssige Nebenhandlungen. Die Autorin spielt auf aktuelle Ereignisse und historische Fakten an und nennt in den Anmerkungen auch ein paar Quellen. Da sie in ihrer Fiktion aber auf historische Genauigkeit nicht zu achten braucht, kann sie die aufgegriffenen Geschichtsmotive in meisterhafte Detailschilderung aufgehen lassen - ihr wahres Talent.
Ihr Roman liest sich wie ein fesselndes Filmdrehbuch. Erzählt wird im Präsens aus einer Perspektive, die bis in die feinsten Gehirnwindungen der Figuren hineinreicht. Schnitte und Gegenschnitte wechseln einander ab. Der Blick zoomt über die Felsen des Frakmonts in den Sternhimmel und wieder zurück auf das ironische Mundwinkelzucken der Alten. Aus dem Off hört man Stimmen oder fernes Hundegebell, und nachts führt ein Travelling im Scheinwerferlicht von Kerns Mercedes an der verschneiten Straßenkante entlang. Man fragt sich aber zunehmend, worauf das hinauswill. Historische Extrapolation? Warnung vor den Untoten? Oder doch Krimi?
Im Fortgang spitzt sich der Roman auf Zweiteres zu: auf den Kampf gegen konspirativ lauernde neofaschistische Kräfte. Ein Kampf, den die psychologisch fein gezeichneten Figuren allerdings nicht durchzuhalten vermögen. Die enigmatische Alte mit ihren klimpernden Ketten um den Hals, die nebst ihrem Wohnwagen offenbar mehr Unterkünfte rund um die Welt besitzt, als der Leser weiß, beharrt zwar auf ihrer Überzeugung, dass alles mit allem zusammenhängt und irgendwie Sinn ergibt. Deshalb versteht sie sich nicht als systematische Fahnderin, sondern eher als Sammlerin von Zufällen. Nach dem Endkampf mit der Hundertjährigen an deren Totenbett bleibt sie aber dabei: Man muss sich vor bösen Wiederholungen hüten. Wahrscheinlich, wie ihr Komplize Schibig einmal bemerkt, weil niemand jemals etwas von den Schrecken der anderen lernt. Schon gar nicht die so sehr mit sich selbst beschäftigten Figuren dieses Romans. Denn in ihrer Selbstbezüglichkeit sind sie am stärksten. JOSEPH HANIMANN
Martina Clavadetscher: "Die Schrecken der anderen". Roman.
Verlag C. H. Beck, München 2025. 333 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








