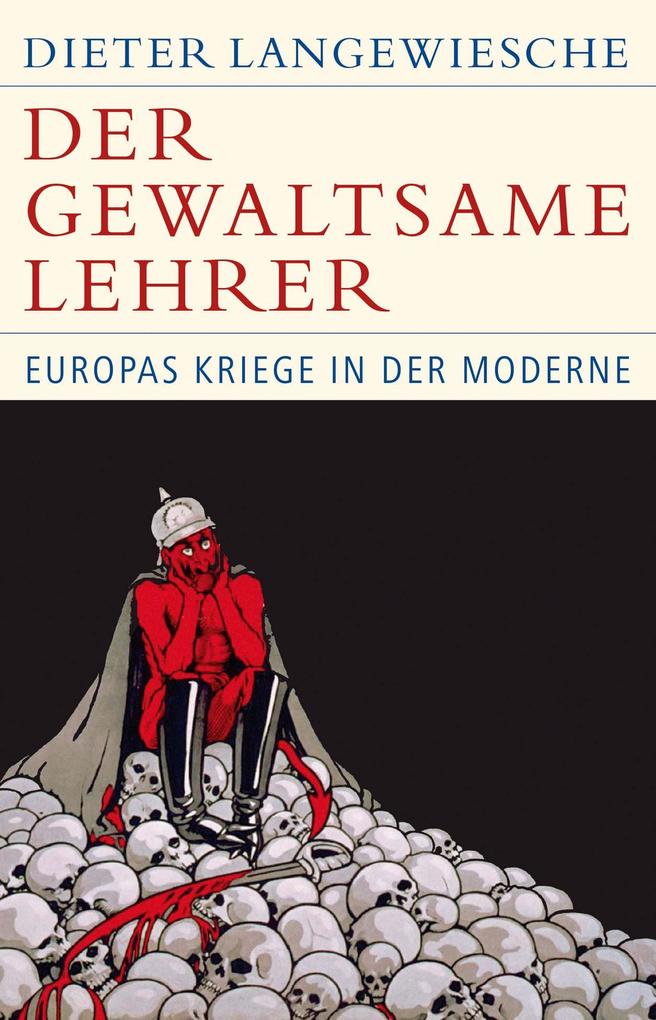Besprechung vom 27.08.2025
Besprechung vom 27.08.2025
Wer öffnete das Gehege?
Dieter Langewiesche über afrikanische Kriege
Dieter Langewiesche, Emeritus für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Tübingen, gehört zu den vielseitigsten deutschsprachigen Historikern. In den vergangenen Jahren trat er vor allem mit Studien zum Krieg hervor. Sein breit und durchaus kontrovers diskutiertes Opus magnum "Der gewaltsame Lehrer. Europas Kriege in der Moderne" (2019) enthält ein bisher wenig beachtetes Kapitel, das sich explizit mit Fragen des Kolonialkrieges auseinandersetzt. In einem englischsprachigen Aufsatz für das "Journal of Modern History" führte Langewiesche drei Jahre später einige im Buchkapitel behandelte Aspekte weiter (F.A.Z. vom 11. Januar 2023). Sein unlängst publizierter Essay "Warum wurde in Afrika anders Krieg geführt als in Europa?" stellt wiederum die wesentlich erweiterte Fassung dieses Aufsatzes dar. Das Büchlein ist der Auftaktband der neuen, in der Hagen University Press publizierten Reihe "en passant".
Die Kriege im Afrika des neunzehnten Jahrhunderts, sowohl vor als auch während der Kolonialzeit, waren, wie Langewiesche darlegt, keine "gehegten" Kriege. Nach 1815 funktionierte in den meisten Teilen Europas die Eindämmung der Kriegsführung, vor allem durch Trennung von Kombattanten und Zivilbevölkerung, hundert Jahre lang. Danach nicht mehr. Hatte das etwas mit den Kriegen zu tun, die Europäer in zunehmendem Maße in Afrika führten? Der Autor greift hier, ohne dies jedoch weiter zu reflektieren, eine klassische Frage der postkolonialen Studien auf: Wie haben Erfahrungen in den Kolonien die Geschichte europäischer Gesellschaften geprägt?
Die Auseinandersetzung mit dieser Frage bildet aber nur einen kleineren Teil des Essays. Ausführlich stellt Langewiesche Überlegungen zu Kriegsformen auf dem afrikanischen Kontinent an. Die zeitgenössischen Darstellungen europäischer Reisender und Militärs, die er vorab skizziert, helfen dabei nur wenig weiter. Sie sind durchtränkt von rassistischen und anderweitig stereotypischen Äußerungen. An einem Punkt jedoch treffen sie sich, behauptet er, mit den Einsichten der einschlägigen jüngeren historischen Afrikaforschung: Ein Kennzeichen der afrikanischen Art des Krieges in vorkolonialer Zeit sei der Angriff auf die Lebensgrundlagen des Feindes gewesen, das Abbrennen von Land, die Zerstörung von Vorräten sowie das Töten und Stehlen von Vieh. Frauen und Kinder wurden häufig verschleppt.
Langewiesche bietet in enger Tuchfühlung mit der relevanten Historiographie ein differenziertes Panorama vom Wandel des Krieges, von der Herausbildung neuer militärischer Organisationsformen sowie der Professionalisierung von Gewalt. Die "Militärrevolution" südlich der Sahara war Triebkraft und zugleich Folge von Staatsbildungen. Der Oxforder Historiker Richard Reid hat sogar die provokante These aufgestellt, dass zumindest im östlichen Afrika der Krieg die politische Kultur demokratisiert habe, wobei seine Rolle darin bestand, dem Staat Grenzen zu setzen und ein noch höheres Maß an Beteiligung der Bevölkerung zu erreichen. Die Etablierung europäischer Kolonialherrschaft, der zahlreiche von europäischen Truppen und ihren nichteuropäischen Helfern geführte Kriege vorausgingen, setzte vielen Entwicklungen jedoch ein vorläufiges Ende. Obwohl Langewiesches Darlegungen zur Typologie der Kriegsformen im vorkolonialen Afrika überzeugen, bleibt am Ende die Frage offen, ob es zum "enthegten Krieg" keine Alternativen gab.
Jedenfalls waren es nicht die Europäer, die das Gehege aufgesperrt haben. Diese Form des Krieges war bereits da. Die Europäer haben sie am Ort lediglich perfektioniert und radikalisiert. Diese Einsicht hat sich der Kolonialismusforschung bisher selten erschlossen, weil sie vorkoloniale Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent zumindest in Bezug auf das Thema Krieg nicht genauer in den Blick nahm. Ist nun dieser ungehegte Kolonialkrieg aus den europäischen Kolonialreichen im zwanzigsten Jahrhundert zurück nach Europa transferiert worden?
Mit der in diesem Zusammenhang besonders markanten These, der Holocaust an den Juden sei im genozidalen Krieg der deutschen "Schutztruppen" gegen die Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika vorgebildet gewesen, kann Langewiesche wenig anfangen. Er sieht die Verbindung der Kolonialkriege zu den Kriegen im Europa des zwanzigsten Jahrhunderts vielmehr in der Besonderheit des "Volkskrieges", "der auf Enthegung angelegt ist, weil er die gesamte Gesellschaft in das Kampfgeschehen einbeziehen will". Diese Form des Krieges, so sein Befund, dominierte in Afrika, als man dies in Europa zunächst noch mit Erfolg zu verhindern suchte. In der um 1800 entstehenden Idee vom Volks- oder Nationalkrieg waren die Enthegung und die Vorstellung von der Notwendigkeit, die Kriegsfähigkeit der verfeindeten Gesellschaft zu vernichten, jedoch bereits eingeschrieben. Und Erfahrungen der Kolonialkriege mögen, so die zurückhaltende Aussage, sie weiter gestärkt haben. In jedem Fall, resümiert Dieter Langewiesche, ließen Kriege in kolonialen Räumen in die Zukunft des Krieges blicken - global und auch in Europa. ANDREAS ECKERT
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.