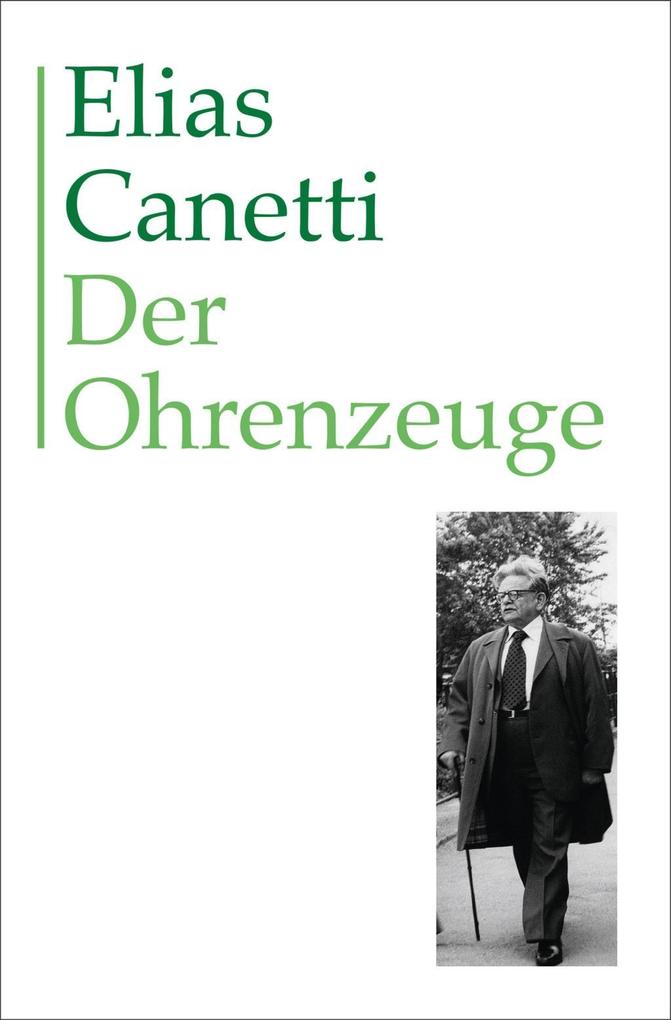Besprechung vom 24.07.2025
Besprechung vom 24.07.2025
Gerichtstagebücher
Sprache als Schicksal: Zum Beginn der kommentierten Gesamtausgabe von Elias Canetti
Auf wie viele Werkausgaben deutschsprachiger Schriftsteller darf man noch hoffen? Wohl nur auf wenige, denn solch aufwendige Projekte stellen ein verlegerisches Risiko dar. Zumal, wenn es sich um kommentierte, also literaturwissenschaftlich bereicherte Reihen handelt. In jüngerer Zeit neu gestartet wurden aber dann doch solche zum Werk von Ingeborg Bachmann (in Zusammenarbeit der Häuser Piper und Suhrkamp, die jeweils über einen Teil der Verlagsrechte an Bachmanns Büchern verfügen), was durch die Erschließung bisher unpublizierter Briefwechsel, vor allem den mit Max Frisch, zusätzlichen Reiz bekam, und zu Rainer Maria Rilke (bei Wallstein), dessen Geburtstag sich heuer zum 150. Mal jährt, sein Todestag im kommenden Jahr zum hundertsten Mal - gleich zwei gute Gründe für frisches Interesse. Aber im Fall von Elias Canetti?
Das Gesamtwerk dieses 1905 in Bulgarien geborenen, in Manchester, Zürich und Frankfurt aufgewachsenen, danach bis 1938 in Wien lebenden und dann ins britische Exil gegangenen jüdischen Schriftstellers, der für die letzten zwanzig Lebensjahre wieder nach Zürich zog, wo er 1994 starb, wird nun vom Hanser Verlag komplett neu ediert, obwohl es schon eine Werkausgabe gab, die noch zu Lebzeiten Canettis begonnen und zehn Jahre nach seinem Tod abgeschlossen worden war. Derart rasch eine weitere Ausgabe? Das gab es jüngst nur in den Fällen von Günter Grass und Martin Walser, also beim Publikum höchst erfolgreichen Schriftstellern. Canetti fand nie vergleichbar viele Leser, obwohl die von 1977 bis 1985 in drei Teilen publizierten Erinnerungen an seine ersten 33 Lebensjahre ihm späte Popularität eingebracht hatten - und der erste Band ihm den Literaturnobelpreis des Jahres 1981 bescherte.
Doch es gibt mehr als gute Gründe für die neue Gesamtausgabe. Einmal die Vielzahl von seit 2005 postum erschienenen Canetti-Büchern: "Aufzeichnungen für Marie-Louise" und "Das Buch gegen den Tod" sowie die Briefwechsel mit seinem Bruder Georges und der Malerin Marie-Louise von Motesiczky, die eine Zeit lang Canettis Geliebte war. Und dann die Tatsache, dass Canetti die wichtigste Quelle zur Werkgeschichte, seine Tagebücher, testamentarisch für dreißig Jahre hatte sperren lassen. Mit dem nun ausgelaufenen Zitier- und Publikationsverbot ist ein völlig neuer Blick nicht nur auf das schillernde Leben und Charakterbild dieses Schriftstellers möglich, sondern auch auf Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte seiner Bücher. Erst jetzt hat eine kommentierte Ausgabe überhaupt Sinn.
Dass sie mit den in dieser Woche erschienenen Bänden vier und fünf einsetzt, hat seinen unerklärten Grund darin, dass Band fünf das erfolgreichste Buch Canettis bietet - "Die gerettete Zunge", den erwähnten ersten Band der Erinnerungstrilogie - und Band vier einem Lieblingskind aus Sicht des Autors und einem Stiefkind der Rezeption gewidmet ist: "Der Ohrenzeuge", ursprünglich erschienen 1974. Veränderungen im jeweiligen Inhalt der beiden Texte gibt es gegenüber den bisherigen Ausgaben nicht, aber durch die Anhänge mit Paralipomena (Zusätzen vor allem in Form verworfener Passagen) und Dokumenten aus dem Nachlass sowie Anmerkungen und Nachwort auf der Grundlage bislang gesperrter Selbstzeugnisse wächst der Umfang der Bücher im Fall der Autobiographie um vierzig Prozent und beim "Ohrenzeugen" sogar auf das Doppelte bisheriger Ausgaben an. Und es ist kein philologisches Schwarzbrot, das hier zusätzlich geboten wird, sondern ein Festmahl an Canetti-Texten, die zudem den Vorzug haben, größtenteils ohne jede Rücksicht auf ein Publikum verfasst worden zu sein - eben Tagebuchnotate, in denen der Schriftsteller Zwiesprache mit sich selbst und dabei Gerichtstag hielt: über andere, aber auch mit sich selbst.
Die moralische Zwiespältigkeit des als Humanist bekannt gewordenen Canetti (durch seinen Widerstand gegen den Totalitarismus, der in der großen anthropologischen Kulturgeschichte "Masse und Macht" von 1960 Ausdruck fand, und seine Skandalisierung des Todes, die vor dem eigenen Dahinscheiden das dazu geplante Buch aber nicht mehr hervorbrachte) ist seit der 2005 publizierten Biographie von Sven Hanuschek allgemein bekannt: Canettis Umgang mit in ihn verliebten Frauen war ebenso dubios wie sein Verhalten gegenüber Freunden. Von einem besonders eklatanten Fall berichtet Jeremy Adler in seinen nebenstehenden Erinnerungen an Canetti: Adlers Vater zählte zu dessen engstem Umkreis, aber den im Gegensatz zum rechtzeitig nach dem "Anschluss" Österreichs aus Wien geflohenen Canetti von den Nationalsozialisten ins KZ verschleppten H. G. Adler nahm der davongekommene Freund später mitleidlos zum Vorbild für seine Figur des "Leidverwesers" im "Ohrenzeugen" (die ursprünglich noch drastischer "Der Jammerprotz" hätte heißen sollen). Auch die in Jeremy Adlers Reminiszenzen an seine Bekanntschaft mit Canetti prominent auftretende Marie-Louise von Motesiczky diente im Kontext der Arbeit am "Ohrenzeugen" als Modell für einen dann allerdings nie ausgeführten Charakter, der den Namen "Die Made" hätte tragen sollen.
Dabei hatte Canetti sich selbst für den "Ohrenzeugen" ermahnt: "Nur nicht dieser Morast des ewigen Selbst!" Doch er wühlte eifrig darin, geschützt durch die Anonymität des von ihm veranstalteten Maskenspiels, die nun dank seines Nachlasses gelüftet wird. Sympathischer wird einem Canetti dabei nicht, aber die Bücher werden noch faszinierender; das gilt gerade für "Der Ohrenzeuge", den Heide Helwig mustergültig ediert hat.
Ein exzellent gewählter Auftakt zur neuen Werkausgabe also. Im Fall von "Die gerettete Zunge" wird weitaus weniger Demaskierendes geboten, aber mindestens ebenso Interessantes. Allein, dass dieser Band im Anhang eine gekürzte Passage aus dem Abschlusskapitel "Das verworfene Paradies" enthält, das Canetti selbst immer nur als "das Grosse Gespräch" bezeichnete - jene lebens- und werkprägende Unterhaltung des Sechzehnjährigen mit seiner Mutter, die dem Sohn vorhielt, über die Liebe zur Literatur die raue Wirklichkeit zu vernachlässigen, und ihn deshalb aus dem behüteten Zürich für die letzten Schuljahre nach Frankfurt in die krisengebeutelte Weimarer Republik schickte -, ist eine Sensation, denn bei diesem Finale der "Geretteten Zunge" handelt es sich ums Scharnierkapitel des gesamten Werks, in dem das für den späten Canetti typische Amalgam aus Selbsterlebtem und Literarisiertem exemplarisch zum Ausdruck kommt: Fünfeinhalb Jahrzehnte danach gab der Autor die stundenlange Aussprache von 1921 im Wortlaut wider. Tatsächlich jedoch hatte er alles wohlkomponiert und eben auch um solche erinnerten Gesprächsteile bereinigt, die seine Dramaturgie störten.
Nun sind Canettis buchgewordene Memoiren schon immer in ihrem Authentizitätsgehalt angezweifelt worden - allemal mit Erscheinen der Biographie von Hanuschek, der dafür damals schon die gesperrten Teile des Nachlasses einsehen, aber nicht daraus zitieren durfte. Jetzt zeichnet er als einer der beiden Herausgeber für die Edition der "Geretteten Zunge" (der andere ist der Canetti-Experte Kristian Wachinger) verantwortlich, und von seinen biographischen Vorarbeiten profitiert die Kommentierung ungemein. Einordnungen des persönlichen Gehalts des Nachlasses und vor allem die Textauswahl daraus sind bestechend in ihrer Plausibilität, und eine Formulierung wie "die Sprache, die zu meinem Schicksal wurde" (gemeint ist die deutsche), aus einem mehr als vierseitigen Bericht über einen Besuch Canettis 1920 bei seinen beiden jüngeren Brüdern, der es auch nicht in die Buchausgabe der "Geretteten Zunge" geschafft hat, ist gerade in ihrer lapidaren Kürze ein Satz, der einen nicht mehr loslässt.
Was man vermisst in der Werkausgabe, ist ein Editionsbericht, der Auskunft über die Auswahlprinzipien des Begleitmaterials gewährt. Gibt es womöglich noch viel mehr als das hier Berücksichtigte? Und über was für ein Gesamtkonvolut an Tagebüchern und sonstigen Nachlassschriften reden wir überhaupt? Die in den Fußnoten angegebenen Archivkennzeichnungen aus den Findebüchern erlauben nur bedingte Rückschlüsse aufs Volumen. Und eine eigene Edition der Tagebücher ist offenbar nicht geplant.
Umso verlockender sind die in der Werkausgabe gewährten Einblicke, die nicht nur eine ambivalente Persönlichkeit auftreten lassen, sondern auch einen grandiosen Stilisten. Canettis Bücher hatten immer schon ihren eigenen "Sound", aber dass dieser trotz Pathos und Begeisterung stets präzise, ja geradezu sezierende Tonfall schon von den frühesten Notaten des Schriftstellers an ausgebildet war, sein 1935 publizierter Roman "Die Blendung" also bereits Resultat einer zehn Jahre währenden Polierarbeit im Steinbruch der deutschen Sprache, das hätte man sich allen Selbststilisierungen Canettis in seinen Memoiren über diese Zeit nicht träumen lassen. So zeigt sich, wie wahr doch vieles ist, was er so unfassbar schön beschrieben hat. ANDREAS PLATTHAUS
Elias Canetti: "Der Ohrenzeuge". Fünfzig Charaktere. Das Gesamtwerk - Zürcher Ausgabe, Band 4.
Hrsg. von Heide Helwig. Hanser Verlag, München 2025. 206 S., 5 Abb., geb., 36,- Euro.
Elias Canetti: "Die gerettete Zunge". Geschichte einer Jugend. Das Gesamtwerk - Zürcher Ausgabe, Band 5.
Hrsg. von Sven Hanuschek und Kristian Wachinger. Hanser Verlag, München 2025.
542 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.