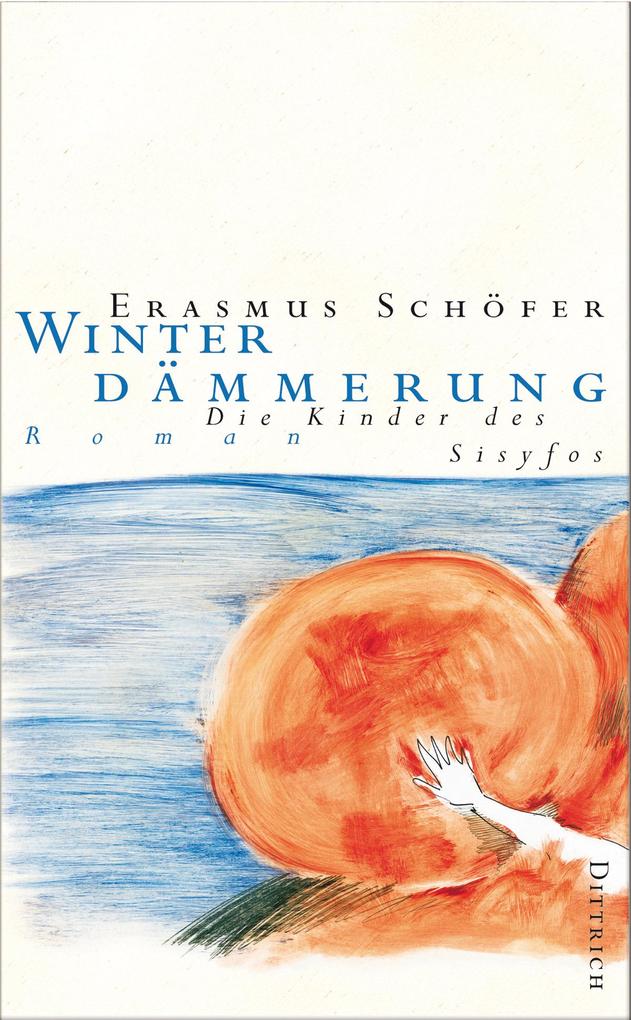
Sofort lieferbar (Download)
"Wenn Schöfer das Niveau dieses Romans vier Bücher lang durchhält, könnte seine Tetralogie als Maßstab in die Literaturgeschichte eingehen", schrieb Michael Sailer 2001 in München.
Der vorliegende Roman "Winterdämmerung", der vierte Band der Tetralogie, zeigt sieben Jahre später, dass die Erwartung des Rezensenten von "Ein Frühling irrer Hoffnung" Wirklichkeit geworden ist: Schöfers die "Die Kinder des Sisyfos" ist ein eigenwilliges und einmaliges Werk der modernen deutschsprachigen Literatur.
Die Geschichte der Achtundsechziger, der Kinder des Sisyfos, setzt sich fort in den achtziger Jahren: Der Betriebsrat Manfred Anklam wechselt auf die Seite der Unternehmensleitung und besetzt dann trotzdem mit seinen Kollegen die Villa Hügel der Krupp-Familie. Der berufslose Viktor Bliss kämpft gegen seine Feuerverletzungen und gegen seine Partei, der Journalist Armin Kolenda erlebt das schreckliche Verbrechen eines Freundes. Seine Liebe zu dessen
Freundin Lisa rettet die beiden völlig verstörten Menschen. Lena Bliss und Malina Stotz machen ernst mit ihrer Befreiung, verlassen ihre Männer und spielen ihr eigenes Leben.
Der Autor erzählt, wie die persönlichen Schicksale seiner Hauptpersonen verfl ochten sind in die sozialen Großereignisse des Jahrzehnts - in den Widerstand gegen die Startbahn-West in Frankfurt, die Raketenstationierung, gegen die Schließung des Stahlwerkes in Rheinhausen.
Die überraschend aus den USA auftauchende Ann zeigt mit ihrem Elan und ihrem frischen Blick auf die gesellschaftlichen Vorgänge in Deutschland ihrem Großvater Bliss, dass die Kämpfe für eine humanere Gesellschaft sich auch in anderer Form fortsetzen können.
In seinem witzig-rührenden Schlusskapitel führt Schöfer seine Hauptpersonen in der Silvesternacht 1989 zu einer privaten Party zusammen, während am Brandenburger Tor die große gesamtdeutsche Party gefeiert wird.
Kritiker haben Schöfers Werk mit Uwe Johnsons "Jahrestage" und Peter Weiss' "Ästhetik des Widerstands" verglichen. Schöfer ist ein fulminanter Abschluss seiner Tetralogie gelungen. "Winterdämmerung" ist ein bewegender Roman, der, ebenso wie die anderen Bände, auch sehr gut als einzelnes Buch gelesen werden kann.
Der vorliegende Roman "Winterdämmerung", der vierte Band der Tetralogie, zeigt sieben Jahre später, dass die Erwartung des Rezensenten von "Ein Frühling irrer Hoffnung" Wirklichkeit geworden ist: Schöfers die "Die Kinder des Sisyfos" ist ein eigenwilliges und einmaliges Werk der modernen deutschsprachigen Literatur.
Die Geschichte der Achtundsechziger, der Kinder des Sisyfos, setzt sich fort in den achtziger Jahren: Der Betriebsrat Manfred Anklam wechselt auf die Seite der Unternehmensleitung und besetzt dann trotzdem mit seinen Kollegen die Villa Hügel der Krupp-Familie. Der berufslose Viktor Bliss kämpft gegen seine Feuerverletzungen und gegen seine Partei, der Journalist Armin Kolenda erlebt das schreckliche Verbrechen eines Freundes. Seine Liebe zu dessen
Freundin Lisa rettet die beiden völlig verstörten Menschen. Lena Bliss und Malina Stotz machen ernst mit ihrer Befreiung, verlassen ihre Männer und spielen ihr eigenes Leben.
Der Autor erzählt, wie die persönlichen Schicksale seiner Hauptpersonen verfl ochten sind in die sozialen Großereignisse des Jahrzehnts - in den Widerstand gegen die Startbahn-West in Frankfurt, die Raketenstationierung, gegen die Schließung des Stahlwerkes in Rheinhausen.
Die überraschend aus den USA auftauchende Ann zeigt mit ihrem Elan und ihrem frischen Blick auf die gesellschaftlichen Vorgänge in Deutschland ihrem Großvater Bliss, dass die Kämpfe für eine humanere Gesellschaft sich auch in anderer Form fortsetzen können.
In seinem witzig-rührenden Schlusskapitel führt Schöfer seine Hauptpersonen in der Silvesternacht 1989 zu einer privaten Party zusammen, während am Brandenburger Tor die große gesamtdeutsche Party gefeiert wird.
Kritiker haben Schöfers Werk mit Uwe Johnsons "Jahrestage" und Peter Weiss' "Ästhetik des Widerstands" verglichen. Schöfer ist ein fulminanter Abschluss seiner Tetralogie gelungen. "Winterdämmerung" ist ein bewegender Roman, der, ebenso wie die anderen Bände, auch sehr gut als einzelnes Buch gelesen werden kann.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. November 2012
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
624
Dateigröße
3,24 MB
Reihe
Die Kinder des Sisyfos. Roman-Tetralogie, BD 4
Autor/Autorin
Erasmus Schöfer
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783943941142
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Die Geschichte der Achtundsechziger setzt sich nach dem glühend konfliktreichen dritten Teil "Sonnenflucht" nun in gedämpfteren Farben fort. Kein Wunder, sein Personal ist älter geworden, hat aber gleichwohl einen gewachsenen Lebenshunger. Obwohl die Handlung über 600 Seiten bedächtig ausgefaltet wird, begegnet Schöfers Prosa ihren Lesern doch mit leichtfüßigem Ton. Die schwierige Übung, sowohl breites Panorama als auch gestaffelte Chronik miteinander in Einklang zu bringen, gelingt über weite Strecken fließend. ...
Zumeist wird jedoch das Zeitgeschehen zur Geschichte seiner Figuren. So erleben wir etwas den Zusammenbruch der Stahlindustrie, wie er in Rheinhausen einsetzte, aus der Perspektive von Manfred Anklam, der die Fronten zwischen Belegschaft und Firmenleitung wechselt. In Details beschreibt Schöfer die Auflösungsprozesse von Gewerkschaft und politischer Linken mit seismographischer Genauigkeit. Eine Situation, die im Schlussbild gerinnt, als man während des Silvestertrubels 1989 nur noch mit freundlicher Sympathie über die vergessenen roten Fahnen vergangener Arbeitskämpfe lacht.
Längst haben die Verhältnisse eine Komplexität angenommen, die die ehemaligen Feindbilder des Klassenkampfes naiv anmuten lassen. Auch wenn die gesellschaftlichen Großereignisse wie der Widerstand gegen die Startbahn West, die Raketenstationierungen, die Etablierung der Frauenbegewegung oder der sich ankündigende Zusammenbruch des Sozialismus Stationen des Romans darstellen, wird es doch immer dort besonders interessant, wo es um die Einzelschicksale geht.
Etwas um das schwierige Schicksal des ehemaligen Lehrers Viktor Bliss, der in Griechenland verletzt wird. Faszinierend auch der Blick auf seine Frau Lena, die mit einem Liebhaber ein neues Leben als Schauspielerin beginnt.
Dass der Roman auffällig viele Liebesszenen enthält, verleiht nicht nur seiner Handlung Kraftstoff, sondern bezeugt auch jene versöhnliche Note, die Schöfer diesmal subtil zwischen den Zeilen aufkommen lässt.
Thomas Lindner, Kölnische Rundschau
Zumeist wird jedoch das Zeitgeschehen zur Geschichte seiner Figuren. So erleben wir etwas den Zusammenbruch der Stahlindustrie, wie er in Rheinhausen einsetzte, aus der Perspektive von Manfred Anklam, der die Fronten zwischen Belegschaft und Firmenleitung wechselt. In Details beschreibt Schöfer die Auflösungsprozesse von Gewerkschaft und politischer Linken mit seismographischer Genauigkeit. Eine Situation, die im Schlussbild gerinnt, als man während des Silvestertrubels 1989 nur noch mit freundlicher Sympathie über die vergessenen roten Fahnen vergangener Arbeitskämpfe lacht.
Längst haben die Verhältnisse eine Komplexität angenommen, die die ehemaligen Feindbilder des Klassenkampfes naiv anmuten lassen. Auch wenn die gesellschaftlichen Großereignisse wie der Widerstand gegen die Startbahn West, die Raketenstationierungen, die Etablierung der Frauenbegewegung oder der sich ankündigende Zusammenbruch des Sozialismus Stationen des Romans darstellen, wird es doch immer dort besonders interessant, wo es um die Einzelschicksale geht.
Etwas um das schwierige Schicksal des ehemaligen Lehrers Viktor Bliss, der in Griechenland verletzt wird. Faszinierend auch der Blick auf seine Frau Lena, die mit einem Liebhaber ein neues Leben als Schauspielerin beginnt.
Dass der Roman auffällig viele Liebesszenen enthält, verleiht nicht nur seiner Handlung Kraftstoff, sondern bezeugt auch jene versöhnliche Note, die Schöfer diesmal subtil zwischen den Zeilen aufkommen lässt.
Thomas Lindner, Kölnische Rundschau












