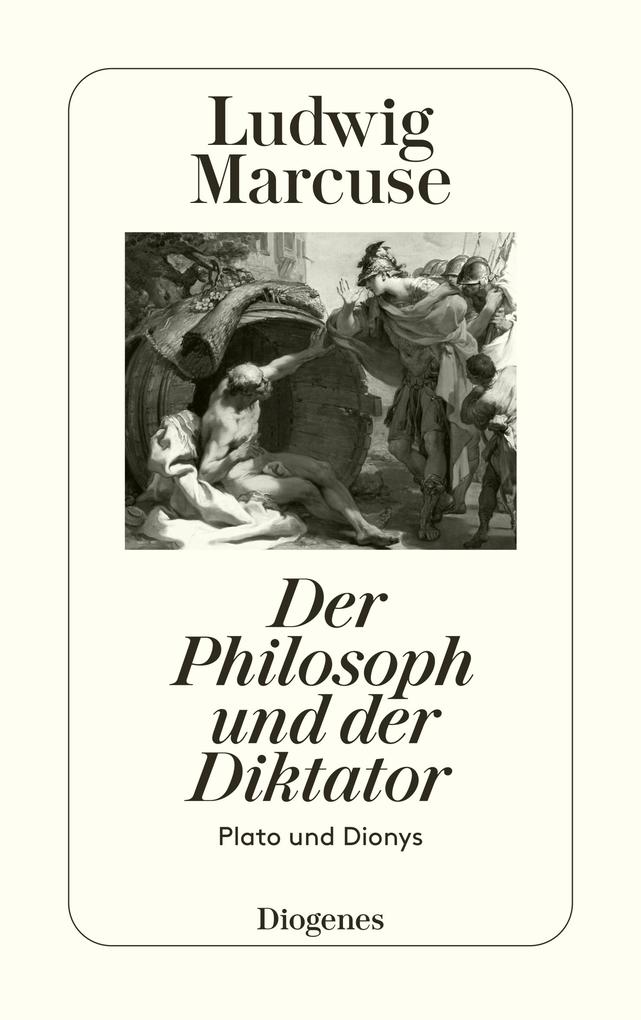
Sofort lieferbar (Download)
Die uralte Antithese von Geist und Macht, in unserem Jahrhundert in der Sorge um die Bewahrung des Menschlichen vor der anonymen Gewalt eines menschenfeindlichen Staatsapparates zu weltweiter Bedeutung gelangt, ist in Ludwig Marcuses Buch
Der Philosoph und der Diktator zu einem lebendig-dramatischen Gleichnis geworden. Die Auseinandersetzung zwischen Plato und Dionys, dem Weisen und dem Tyrannen von Syrakus, schlägt über zweitausend Jahre hinweg die Brücke zur Problematik unserer Tage.
So erzwingt dieses Buch wie alle bleibenden Bücher auf mehreren Ebenen unser Interesse: als packende Erzählung, als lebendigste Nachschöpfung der antiken Welt, endlich als philosophisch-politische Streitschrift von brennendster Aktualität."
Der Philosoph und der Diktator zu einem lebendig-dramatischen Gleichnis geworden. Die Auseinandersetzung zwischen Plato und Dionys, dem Weisen und dem Tyrannen von Syrakus, schlägt über zweitausend Jahre hinweg die Brücke zur Problematik unserer Tage.
So erzwingt dieses Buch wie alle bleibenden Bücher auf mehreren Ebenen unser Interesse: als packende Erzählung, als lebendigste Nachschöpfung der antiken Welt, endlich als philosophisch-politische Streitschrift von brennendster Aktualität."
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. Januar 2023
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
208
Dateigröße
0,82 MB
Autor/Autorin
Ludwig Marcuse
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783257612943
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 21.03.2025
Besprechung vom 21.03.2025
Das antike Syrakus sah aus wie das "Dritte Reich"
Ludwig Marcuses Platon-Studie von 1947 über Demokratie zwischen Diktatur und Utopie
"Skeptiker. Melancholischer Jude" lautet die Selbstcharakteristik, die Ludwig Marcuse 1962, im Alter von 68 Jahren, Erika Mann zukommen ließ. Damals war er aus dem amerikanischen Exil, in dem er in Verbindung gestanden hatte mit Heinrich und Thomas Mann - aber, so Marcuse 1949: "Ich gehöre nicht zu den Propagandisten des Mann-Clans" -, mit Stefan Zweig und Alfred Döblin, bereits nach Bayern gezogen. Nach dem Studium in Berlin und Freiburg sowie der Dissertation über "Die Individualität als Wert und die Philosophie Nietzsches" war er bis 1933 als Theaterkritiker tätig, dann zuerst in Frankreich, schließlich in den USA als Philosophieprofessor und als Germanist aktiv. 1934 schrieb er an und über "Heinrich Mann und die Demokratie": "Die Demokratie ist ein Ziel, aber kein Weg. Die Aufgabe des Demokraten kann es nicht mehr sein, den antidemokratischen Weg zu verlegen, sondern nur noch, Sorge dafür zu tragen, daß auf diesem Weg das demokratische Ziel nicht vergessen wird."
Neben Schopenhauer und Heine, Nietzsche, Marx und Freud hat Marcuse sein Interesse auch auf Platon gerichtet, in dem er den "klassischen Nonkonformisten" sah. 1940 schloss er ein Manuskript ab, in dem er die erste Platon-Biographie sah, "die bisher geschrieben wurde". Einer der ersten Leser des englischen Originals von 1947 war Thomas Mann, er erkannte darin eine plötzlich explodierte "Zeitbombe" - "übrigens nicht zerstörerisch, sondern höchst auferbauend für Geist und Gemüt. (. . .) Was würde Nietzsche dazu gesagt haben?"
Marcuses Buch war "Der Philosoph und der Diktator", es widmet sich Platon und seiner scheiternden Bemühung, in Sizilien die Idee vom vollkommenen Staat umzusetzen. Zwar erhielt eine spätere Neuauflage der deutschen Fassung noch den Untertitel "Geschichte einer Demokratie und einer Diktatur", auch wenn Marcuse Platons Vorstellung vom "weisen Diktator" nicht als Vision von Demokratie durchgehen lässt. "Platon war antidemokratisch."
Im Vorwort werden die Leser ermutigt, es nicht nur für ein Spiel zu halten, "wenn das totalitäre Syrakus des Jahres 399 (vor Christus) so aussieht, als wäre es das 'Dritte Reich' persönlich - in leichter historischer Vermummung". Das Jahrzehnt des Faschismus, in dem "die Demokratien zusammenfielen wie Kartenhäuser und Tyranneien ohne Zahl den europäischen Kontinent übersäten", war für Marcuse gerade eine Chance, Platon "persönlich zu begegnen".
Einerseits handelt es sich hier um eine "Rekonstruktion", wie sich Platons drei Reisen nach Sizilien möglicherweise hätten abspielen können, nicht aber, so Marcuse, um eine romanhafte Biographie. Es geht ihm um das "Philosophieren in Person", und dafür hat der ausgewiesene Philosoph Ludwig Marcuse zahlreiche Dialoge und auch die erhaltenen, nur mitunter als authentisch anerkannten Briefe studiert und geschickt eingebaut. Aber würde das ausreichen, um dieses Buch als Parabel demokratischer Kultur zu empfehlen?
Die Frage ist andererseits mit Ja zu beantworten, denn der historische Konflikt zwischen dem Diktator und dem Philosophen ist nicht nur als eine Doppelbiographie im Sinne Plutarchs angelegt, sondern vor allem als eine durchsichtige Parallelgeschichte zur eigenen Zeit. Marcuse weiß, von wem er spricht, wenn er die "Dionyse unserer Tage" vor Augen hat, sodass es ihn gereizt hat, "die Teufel unserer Tage in einem ihrer größten Ahnen darzustellen". Im Vorwort von 1968 macht er es deutlich: Dionys I. war "durch eine syrakusische Harzburger Front hochgekommen".
So spricht zunächst vieles dafür, die mitunter auch ohne nachweisbare Quellen erzählte Geschichte von der Machtübernahme durch einen Plebejer aus Syrakus, der sich als Volksredner gebärdete und doch ein Volksfeind war, als eine Art Schlüsselroman zu dechiffrieren. Etwa wenn davon die Rede ist, wie Dionys "auf untadelig demokratische Weise" zu einem Diktator gemacht wurde, der dann seine Gegner nach und nach verschwinden lässt. Aber es sind nicht einmal nur die direkten Bezüge, die Marcuses Buch auch heute so lesbar erscheinen lassen, sondern die immer wieder eingestreuten ernüchternden Zwischenbilanzen, die dieses "Märchen von der Freundschaft zwischen Macht und Geist" zu bieten hat, als sarkastische, das heißt einschneidende Spitzen eines politischen Kommentators, der als Zeitzeuge spricht. Im Licht unserer Tage nimmt sich die Bemerkung als denkwürdig aus, wenn es heißt: "Die Tage der Unfreiheit kündigen sich damit an, daß das Volk immerzu um seine Meinung befragt wird." Gerade die Kälte der aphoristischen Beobachtung spricht für ihre Haltbarkeit, etwa in diesem Fall: "Es gibt viele Methoden des Raubs, wenn man der Staat persönlich ist."
Und doch liegt die Begründung, in Marcuses Darstellung vom Scheitern des "skeptischen Idealisten" Platon zu berichten, weniger in der Rekonstruktion einer Ohnmacht der Vernunft als im Versuch der Ermutigung: Es geht darum, sich der Tyrannei um jeden Preis entgegenzustellen, wie dies auch für den Verfasser des "Staates" in Anspruch genommen werden kann, der darin mit seinen Athenern übereinstimmte. Allerdings ist er mit seinem utopischen Ziel der Gerechtigkeit nicht nur gescheitert, sondern hatte selbst eine "Diktatur der Gerechtigkeit" errichten wollen. Marcuse zitiert somit Bertrand Russells Vorwurf, Platon sei ein Advokat des totalitären Staates gewesen. Deshalb entgeht sein Buch der Naivität, Platon zu einer Galionsfigur demokratischen Denkens machen zu wollen. Den "Gorgias" bezeichnet Marcuse als einen "Kernschuß - mitten ins Allerheiligste der Demokratie Athens", wenn darin viele der nationalen Heroen dafür kritisiert werden, dass sie die Untertanen nicht besser gemacht hätten. Platon konnte weder den Vater Dionys (der ihn nach seinem ersten Besuch auf Sizilien auf den Sklavenmarkt nach Ägina verkaufen ließ) noch seinen gleichnamigen Sohn (der ihn beim zweiten Aufenthalt eine Zeit lang inhaftierte) dafür gewinnen, seine Vision umzusetzen. Und auch das dritte Experiment, als Dion die platonische Lehre zu realisieren versuchte, scheiterte. Immer ging es um eine fraglose Abwehr der Tyrannei und insofern um eine Lektion in Demokratie. Der Aristokrat Platon war nicht ihr Freund, aber er hat in einer Zeit gelebt, in der es schon Demokratien gab, "deren Prinzip war: Freiheit für die Feinde der Demokratie". Die "Übermacht der Frage über jede Antwort" macht dann den Dialogkünstler Platon weit über das Historische hinaus zu einem Fixpunkt der Orientierung.
Sosehr sich Platon auch in seinem Freund Dion täuschte, der sich am Ende, bei seiner Rebellion gegen Dionys den Jüngeren, als "tugendhafter Tyrann" erwies, erzählt Marcuse von dem Philosophen nicht, um ihn für seine politischen Illusionen zu geißeln. Sondern Platon wird als zwar undemokratischer und konservativer Utopist gewürdigt, der neben seiner fraglosen Bedeutung als Philosoph auch deshalb - in diesem politischen und historischen Kontext - der Rede wert ist, weil es nicht um das geht, was er erreicht, sondern was er versucht hat. Ohne moralische Didaktik erscheint die Geschichte vom Philosophen und dem Diktator also als Lehrstück von der Fragilität politischer Utopie, von der brutalen, letztlich aber selbstzerstörerischen Potenz der Tyrannei und von der Verletzlichkeit demokratischer Regeln. Der Diktator und der Philosoph folgten ihnen beide nicht, aus politischer Willkür der eine, aus idealistischer Konstruktion heraus der andere. Man kann fast an die zynischen Perspektiven des jungen Friedrich Dürrenmatt denken, wenn Marcuse am Ende über das Scheitern des platonischen Musterschülers Dion urteilt: "Der vollkommene Herrscher hat die Welt nur noch unvollkommener hinterlassen." MATHIAS MAYER
Der Verfasser lehrte bis zur Emeritierung Literaturwissenschaft in Augsburg.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Philosoph und der Diktator" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









