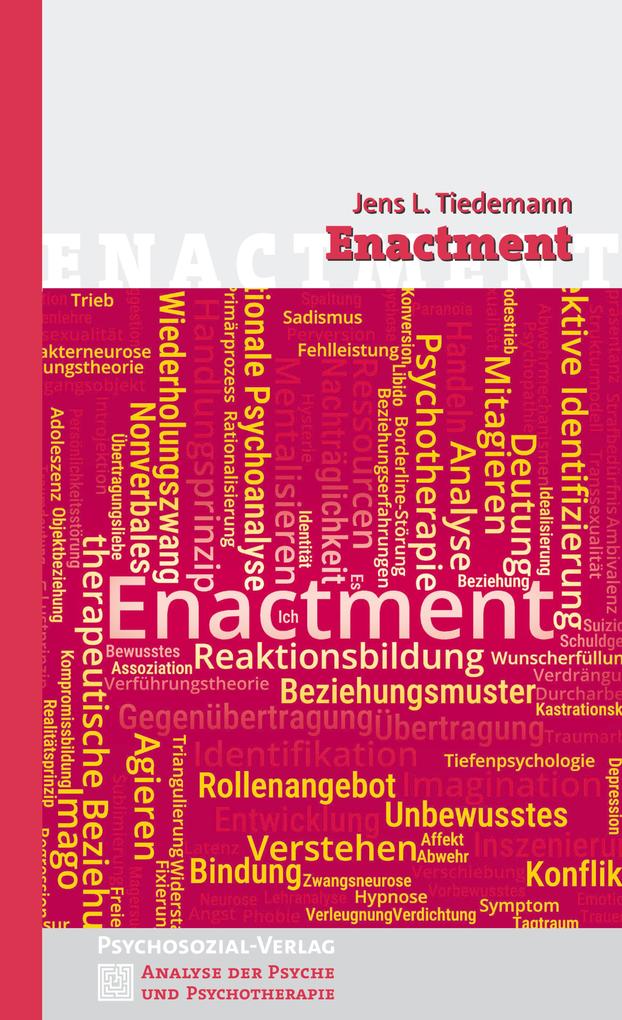Jens L. Tiedemann ist psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker und Körperpsychotherapeut, Supervisor, Lehranalytiker und Dozent (DGPT) an mehreren psychoanalytischen/psychotherapeutischen Ausbildungsinstituten.
Studium der Psychologie an der FU Berlin, Promotion in klinischer Psychologie. Mehrere Jahre in Suchtkliniken gearbeitet. Unterschiedliche körperpsychotherapeutische Ausbildungen; Ausbildung in Tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie, Approbation, zweite Fachkunde in analytischer Psychotherapie. Niedergelassen seit über zwanzig Jahren in Berlin-Kreuzberg.
Seit zwei Jahrzehnten besteht sein Forschungsinteresse vornehmlich an Themen der zeitgenössischen Psychoanalyse: Scham, Affektregulierung, Trauma und Dissoziation, die Rolle des Körpers in der Psychoanalyse, relationale und psychoanalytische Feldtheorien. Hierzu hat er national und international etliche Vorträge, Seminare und Workshops gegeben.
(Stand: Juli 2025)