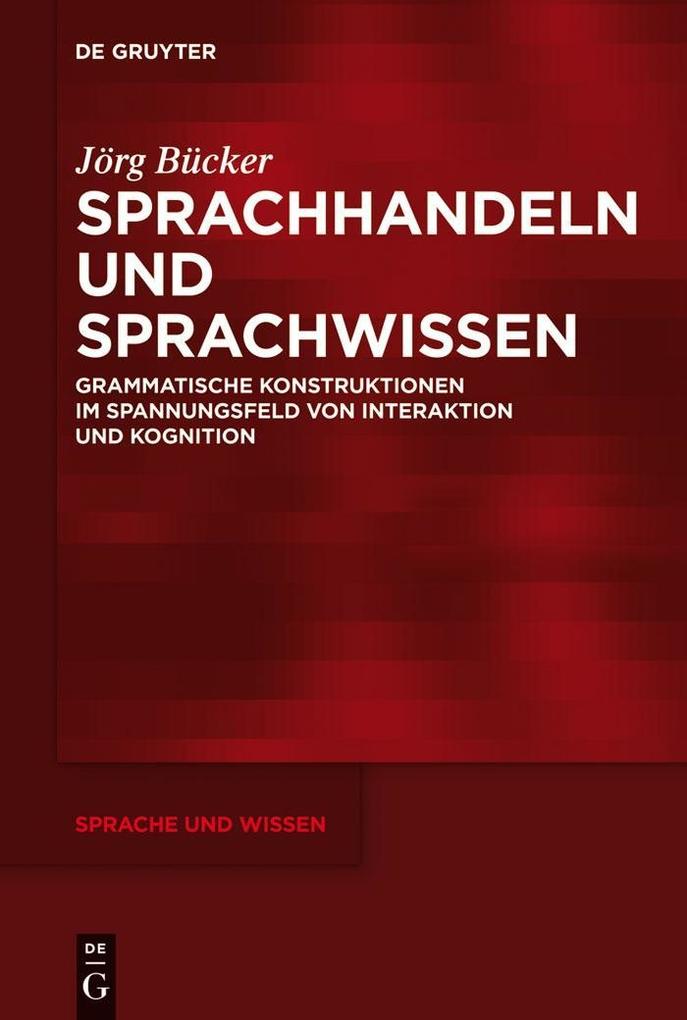
Sofort lieferbar (Download)
Am Beispiel der "Nicht-finiten Prädikationskonstruktion" (z. B. "Ich und aufgeben?") wird der Versuch unternommen, ausgehend von den alltagssprachlichen Formen und Funktionen einer grammatischen Konstruktion zu einem Modell ihrer Repräsentation im Sprachgebrauchswissen zu gelangen. Die Hauptdatengrundlage der Untersuchung bilden alltagssprachliche Beispiele aus dem Usenet und aus Foren. Im Anschluss an die Diskussion des Forschungsstands werden in Auseinandersetzung mit kognitions- und interaktionslinguistischen, aber auch zeichentheoretischen Positionen die theoretischen und methodologischen Konzepte herausgearbeitet, die für die Untersuchung der "Nicht-finiten Prädikationskonstruktion" erforderlich sind. Die empirische Untersuchung der Konstruktion mündet dann wiederum in einen Vorschlag für ein Modell ihrer kognitiven Repräsentation im Sprachgebrauchswissen. Nach einem Ausblick auf einige Charakteristika der "Nicht-finiten Prädikationskonstruktion", die in sprachvergleichender Hinsicht und im Hinblick auf den Problembereich Mündlichkeit und Schriftlichkeit aufschlussreich sind, schließt die Untersuchung mit einem Plädoyer dafür, Konstruktionen als Phänomene alltäglicher kommunikativer Praxis zu begreifen.
Inhaltsverzeichnis
1;Danksagung;6 2;1. Einleitung;14 2.1;1.1 Zum Gegenstand der Untersuchung;14 2.2;1.2 Zum Aufbau der Untersuchung;17 3;2. Forschungsstand;20 3.1;2.1 Zur Konstruktionsbezeichnung;20 3.2;2.2 Ansätze zur Beschreibung und Erklärung der NFPK;23 3.2.1;2.2.1 Ellipsenpostulierende Ansätze;23 3.2.1.1;2.2.1.1 Die NFPK als eigentliches Satzglied (Behaghel);24 3.2.1.2;2.2.1.2 Die NFPK als eigentlicher finiter Satz;25 3.2.1.3;2.2.1.3 Kritische Diskussion;28 3.2.2;2.2.2 Generativgrammatische Ansätze;32 3.2.2.1;2.2.2.1 Die NFPK als Mad Magazine sentence (Akmajian);34 3.2.2.2;2.2.2.2 Die NFPK als infiniter Hauptsatz (Fries);35 3.2.2.3;2.2.2.3 Die NFPK als Infinitival Exclamative (Grohmann, Etxepare);36 3.2.2.4;2.2.2.4 Die NFPK als Adult Root Infinitive (Grohmann, Etxepare);39 3.2.2.5;2.2.2.5 Kritische Diskussion;40 3.2.3;2.2.3 Phraseologische Ansätze;44 3.2.3.1;2.2.3.1 Die NFPK als phraseologische Modellbildung;45 3.2.3.2;2.2.3.2 Kritische Diskussion;46 3.2.4;2.2.4 Konstruktionsgrammatische Ansätze;47 3.2.4.1;2.2.4.1 Die NFPK als Incredulity Response Construction (Fillmore et al.);49 3.2.4.2;2.2.4.2 Die NFPK als Topic Construction (Lambrecht);51 3.2.4.3;2.2.4.3 Die NFPK als Reactive Construction (Linell);53 3.2.4.4;2.2.4.4 Kritische Diskussion;55 3.3;2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse;55 4;3. Theoretische und methodologische Grundlagen der Untersuchung;58 4.1;3.1 Interdependenz von Performanz und Kompetenz;59 4.1.1;3.1.1 Performanz in der Kompetenz Konstruktionen als typisierte Prägungen;63 4.1.2;3.1.2 Kompetenz in der Performanz Konstrukte als intersubjektive Gestaltkonstitutionen;69 4.2;3.2 Primat des material performierten Konstrukts;74 4.2.1;3.2.1 Beobachtung und Rekonstruktion;74 4.2.1.1;3.2.1.1 Einseitige Unterordnung der Beobachtung unter die Rekonstruktion;77 4.2.1.2;3.2.1.2 Einseitige Überordnung der Beobachtung über die Rekonstruktion;78 4.2.1.3;3.2.1.3 Reflexive Äquilibrierung zwischen Beobachtung und Rekonstruktion;79 4.2.2;3.2.2 Ebenen der Beobachtung von Konstrukten in
der Performanz;81 4.2.2.1;3.2.2.1 Unterscheidung der elementaren Untersuchungsebenen;82 4.2.2.2;3.2.2.2 Transmedialität der elementaren Untersuchungsebenen;85 4.2.3;3.2.3 Ebenen der Rekonstruktion von Konstruktionen in der Kompetenz;88 4.2.3.1;3.2.3.1 Rekonstruktion von Konstruktionen als Komponenten eines Konstruktikons;89 4.2.3.2;3.2.3.2 Rekonstruktion von Konstruktionen als symbolgrammatische Einheiten;94 4.2.3.3;3.2.3.3 Rekonstruktion der Konstruktionspole als Netzwerke;97 4.2.3.4;3.2.3.4 Rekonstruktion von Merkmalsebenen in den Konstruktionspolen;98 4.3;3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse;102 5;4. Datengrundlage der Untersuchung;104 5.1;4.1 Zu den Korpora;104 5.2;4.2 Zum Suchmodus;106 5.3;4.3 Zur Präsentation der Daten;107 5.3.1;4.3.1 Darstellung von Usenet-Beispielen;107 5.3.2;4.3.2 Darstellung von Foren-Beispielen;111 6;5. Formen und Funktionen der NFPK in der Performanz;114 6.1;5.1 Zum Formenspektrum der Konstrukte;114 6.1.1;5.1.1 Formale Basiseigenschaften;114 6.1.1.1;5.1.1.1 Zweiteiligkeit;114 6.1.1.2;5.1.1.2 Nicht-Finitheit;117 6.1.2;5.1.2 Formale variierende Eigenschaften;118 6.1.2.1;5.1.2.1 Distribution konstruktinterner graphemischer Grenzmarkierungen;119 6.1.2.2;5.1.2.2 Distribution des Binnen-,und;120 6.1.2.3;5.1.2.3 Distribution von Komplementen und Supplementen;122 6.1.2.4;5.1.2.4 Inventar der formalen Aktualisierungsmuster;123 6.1.2.5;5.1.2.5 Einheitenstatus der formalen Aktualisierungsmuster;124 6.1.2.6;5.1.2.6 Besetzung der Konjunkte der formalen Aktualisierungsmuster;130 6.1.3;5.1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse;137 6.2;5.2 Zum Funktionsspektrum der Konstrukte;137 6.2.1;5.2.1 Retraktive Bezugsrichtung: Gesprächsdeiktisch verankerte Themensetzung;138 6.2.1.1;5.2.1.1 Konversationelle Buchführung;140 6.2.1.2;5.2.1.2 Konversationelle Buchprüfung;143 6.2.1.3;5.2.1.3 Sequenzielles Schema;144 6.2.2;5.2.2 Projektive Bezugsrichtung: Initiierung einer bewertenden Reparatur;145 6.2.2.1;5.2.2.1 Initiierung einer unmittelbar folgenden gegenlaufend bewerten
den Reparatur;155 6.2.2.2;5.2.2.2 Initiierung einer mittelbar folgenden gegenlaufend bewertenden Reparatur;161 6.2.2.3;5.2.2.3 Initiierung einer gleichlaufend bewertenden Reparatur;164 6.2.2.4;5.2.2.4 Initiierung einer deliberativen Reparatur;170 6.2.2.5;5.2.2.5 Sequenzielles Schema;174 6.2.3;5.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse;175 7;6. Repräsentation der NFPK in der Kompetenz;180 7.1;6.1 Netzwerktheoretische Grundlagen der Rekonstruktion der NFPK;180 7.2;6.2 Konstruktionelle Mikronetzwerkstruktur: Aufbau und Prozessierung der Konstruktion;185 7.2.1;6.2.1 Repräsentation der Konstruktionsmatrix im Langzeitgedächtnis;185 7.2.1.1;6.2.1.1 Taxonomie der Merkmalskonstellationen im Formenpol;186 7.2.1.2;6.2.1.2 Taxonomie der Merkmalskonstellationen im Bedeutungspol;190 7.2.1.3;6.2.1.3 Verknüpfung der Taxonomie im Formenpol. Mit der Taxonomie im Bedeutungspol;193 7.2.2;6.2.2 Konstitution des Konstruktionsnexus im sprachlichen Arbeitsgedächtnis;194 7.3;6.3 Konstruktionelle Makronetzwerkstruktur: Netzwerkverbindungen und Amalgamierungen;198 7.3.1;6.3.1 Die Verblose Prädikationskonstruktion (VPK);200 7.3.1.1;6.3.1.1 Vergleich mit der NFPK;200 7.3.1.2;6.3.1.2 Empirische Evidenz für Netzwerkverbindungen zur NFPK;210 7.3.2;6.3.2 Echo-Formate;213 7.3.2.1;6.3.2.1 Vergleich mit der NFPK;213 7.3.2.2;6.3.2.2 Empirische Evidenz für Netzwerkverbindungen zur NFPK;215 7.4;6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse;219 8;7. Die NFPK in der Mündlichkeit und im Sprachvergleich;222 8.1;7.1 Prosodische Charakteristika der NFPK;222 8.1.1;7.1.1 Kontinuität prosodischer Grenzmarkierungen;222 8.1.1.1;7.1.1.1 Prosodisches Kontinuum zwischen den Polen (A1) und (B1);223 8.1.1.2;7.1.1.2 Prosodisches Kontinuum zwischen den Polen (A2) und (B2);227 8.1.1.3;7.1.1.3 Prosodische Parallelen zwischen Pol (A1) und Aktualisierungsmuster (C);231 8.1.2;7.1.2 Zum Inventar der mündlichen Aktualisierungsmuster;232 8.1.3;7.1.3 Einige Parallelen zu anderen prosodischen Formaten;234 8.2;7.2 Charakteristika der NFPK im Sprachv
ergleich;236 8.2.1;7.2.1 Zur bisher bekannten Verbreitung der NFPK;236 8.2.2;7.2.2 Zwei Beispiele für im Sprachvergleich beobachtbare Gemeinsamkeiten;238 8.2.2.1;7.2.2.1 Betontheit der Elemente im R-Konjunkt;238 8.2.2.2;7.2.2.2 Paralleles Flexionsverhalten prädikativer Adjektive und P-Adjektive;243 8.2.3;7.2.3 Zwei Beispiele für im Sprachvergleich beobachtbare Unterschiede;246 8.2.3.1;7.2.3.1 Vorhandensein eines Binnen-,und;247 8.2.3.2;7.2.3.2 Systematik der Distribution von Grenzmarkierungen;249 8.3;7.3 Zusammenfassung der Ergebnisse;255 9;8. Schlussbetrachtungen;256 10;9. Literaturverzeichnis;264 10.1;9.1 Verzeichnis literarischer Quelltexte;264 10.2;9.2 Verzeichnis wissenschaftlicher Literatur;266 11;Personenregister;300 12;Sachregister;304 13;Anhang;308
der Performanz;81 4.2.2.1;3.2.2.1 Unterscheidung der elementaren Untersuchungsebenen;82 4.2.2.2;3.2.2.2 Transmedialität der elementaren Untersuchungsebenen;85 4.2.3;3.2.3 Ebenen der Rekonstruktion von Konstruktionen in der Kompetenz;88 4.2.3.1;3.2.3.1 Rekonstruktion von Konstruktionen als Komponenten eines Konstruktikons;89 4.2.3.2;3.2.3.2 Rekonstruktion von Konstruktionen als symbolgrammatische Einheiten;94 4.2.3.3;3.2.3.3 Rekonstruktion der Konstruktionspole als Netzwerke;97 4.2.3.4;3.2.3.4 Rekonstruktion von Merkmalsebenen in den Konstruktionspolen;98 4.3;3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse;102 5;4. Datengrundlage der Untersuchung;104 5.1;4.1 Zu den Korpora;104 5.2;4.2 Zum Suchmodus;106 5.3;4.3 Zur Präsentation der Daten;107 5.3.1;4.3.1 Darstellung von Usenet-Beispielen;107 5.3.2;4.3.2 Darstellung von Foren-Beispielen;111 6;5. Formen und Funktionen der NFPK in der Performanz;114 6.1;5.1 Zum Formenspektrum der Konstrukte;114 6.1.1;5.1.1 Formale Basiseigenschaften;114 6.1.1.1;5.1.1.1 Zweiteiligkeit;114 6.1.1.2;5.1.1.2 Nicht-Finitheit;117 6.1.2;5.1.2 Formale variierende Eigenschaften;118 6.1.2.1;5.1.2.1 Distribution konstruktinterner graphemischer Grenzmarkierungen;119 6.1.2.2;5.1.2.2 Distribution des Binnen-,und;120 6.1.2.3;5.1.2.3 Distribution von Komplementen und Supplementen;122 6.1.2.4;5.1.2.4 Inventar der formalen Aktualisierungsmuster;123 6.1.2.5;5.1.2.5 Einheitenstatus der formalen Aktualisierungsmuster;124 6.1.2.6;5.1.2.6 Besetzung der Konjunkte der formalen Aktualisierungsmuster;130 6.1.3;5.1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse;137 6.2;5.2 Zum Funktionsspektrum der Konstrukte;137 6.2.1;5.2.1 Retraktive Bezugsrichtung: Gesprächsdeiktisch verankerte Themensetzung;138 6.2.1.1;5.2.1.1 Konversationelle Buchführung;140 6.2.1.2;5.2.1.2 Konversationelle Buchprüfung;143 6.2.1.3;5.2.1.3 Sequenzielles Schema;144 6.2.2;5.2.2 Projektive Bezugsrichtung: Initiierung einer bewertenden Reparatur;145 6.2.2.1;5.2.2.1 Initiierung einer unmittelbar folgenden gegenlaufend bewerten
den Reparatur;155 6.2.2.2;5.2.2.2 Initiierung einer mittelbar folgenden gegenlaufend bewertenden Reparatur;161 6.2.2.3;5.2.2.3 Initiierung einer gleichlaufend bewertenden Reparatur;164 6.2.2.4;5.2.2.4 Initiierung einer deliberativen Reparatur;170 6.2.2.5;5.2.2.5 Sequenzielles Schema;174 6.2.3;5.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse;175 7;6. Repräsentation der NFPK in der Kompetenz;180 7.1;6.1 Netzwerktheoretische Grundlagen der Rekonstruktion der NFPK;180 7.2;6.2 Konstruktionelle Mikronetzwerkstruktur: Aufbau und Prozessierung der Konstruktion;185 7.2.1;6.2.1 Repräsentation der Konstruktionsmatrix im Langzeitgedächtnis;185 7.2.1.1;6.2.1.1 Taxonomie der Merkmalskonstellationen im Formenpol;186 7.2.1.2;6.2.1.2 Taxonomie der Merkmalskonstellationen im Bedeutungspol;190 7.2.1.3;6.2.1.3 Verknüpfung der Taxonomie im Formenpol. Mit der Taxonomie im Bedeutungspol;193 7.2.2;6.2.2 Konstitution des Konstruktionsnexus im sprachlichen Arbeitsgedächtnis;194 7.3;6.3 Konstruktionelle Makronetzwerkstruktur: Netzwerkverbindungen und Amalgamierungen;198 7.3.1;6.3.1 Die Verblose Prädikationskonstruktion (VPK);200 7.3.1.1;6.3.1.1 Vergleich mit der NFPK;200 7.3.1.2;6.3.1.2 Empirische Evidenz für Netzwerkverbindungen zur NFPK;210 7.3.2;6.3.2 Echo-Formate;213 7.3.2.1;6.3.2.1 Vergleich mit der NFPK;213 7.3.2.2;6.3.2.2 Empirische Evidenz für Netzwerkverbindungen zur NFPK;215 7.4;6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse;219 8;7. Die NFPK in der Mündlichkeit und im Sprachvergleich;222 8.1;7.1 Prosodische Charakteristika der NFPK;222 8.1.1;7.1.1 Kontinuität prosodischer Grenzmarkierungen;222 8.1.1.1;7.1.1.1 Prosodisches Kontinuum zwischen den Polen (A1) und (B1);223 8.1.1.2;7.1.1.2 Prosodisches Kontinuum zwischen den Polen (A2) und (B2);227 8.1.1.3;7.1.1.3 Prosodische Parallelen zwischen Pol (A1) und Aktualisierungsmuster (C);231 8.1.2;7.1.2 Zum Inventar der mündlichen Aktualisierungsmuster;232 8.1.3;7.1.3 Einige Parallelen zu anderen prosodischen Formaten;234 8.2;7.2 Charakteristika der NFPK im Sprachv
ergleich;236 8.2.1;7.2.1 Zur bisher bekannten Verbreitung der NFPK;236 8.2.2;7.2.2 Zwei Beispiele für im Sprachvergleich beobachtbare Gemeinsamkeiten;238 8.2.2.1;7.2.2.1 Betontheit der Elemente im R-Konjunkt;238 8.2.2.2;7.2.2.2 Paralleles Flexionsverhalten prädikativer Adjektive und P-Adjektive;243 8.2.3;7.2.3 Zwei Beispiele für im Sprachvergleich beobachtbare Unterschiede;246 8.2.3.1;7.2.3.1 Vorhandensein eines Binnen-,und;247 8.2.3.2;7.2.3.2 Systematik der Distribution von Grenzmarkierungen;249 8.3;7.3 Zusammenfassung der Ergebnisse;255 9;8. Schlussbetrachtungen;256 10;9. Literaturverzeichnis;264 10.1;9.1 Verzeichnis literarischer Quelltexte;264 10.2;9.2 Verzeichnis wissenschaftlicher Literatur;266 11;Personenregister;300 12;Sachregister;304 13;Anhang;308
Produktdetails
Erscheinungsdatum
26. April 2012
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
306
Reihe
Sprache und Wissen (SuW)
Autor/Autorin
Jörg Bücker
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Adobe-DRM-Kopierschutz
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783110282719
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Sprachhandeln und Sprachwissen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









