Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
NEU: Das Hugendubel Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!
Jetzt entdecken
mehr erfahren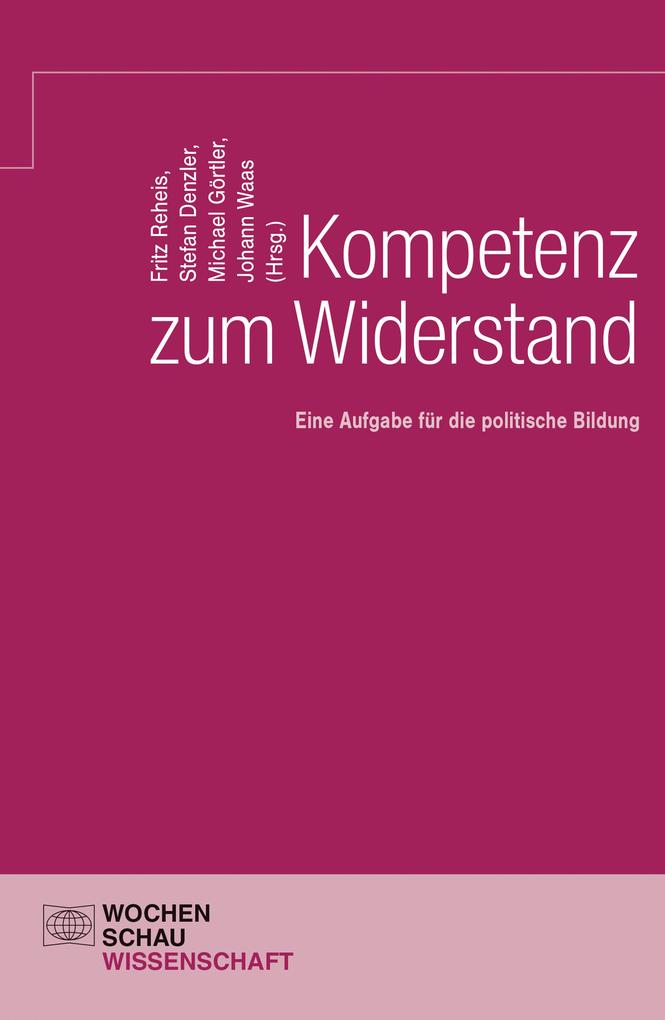
Sofort lieferbar (Download)
Der Ruf nach Widerstand ist populär geworden: gegen die Herrschaft von Banken, das Finanzkapital, Freihandelsabkommen, aber auch gegen "Volksverräter", "Lügenpresse" und "Islamisierung". Solche Widerstandsappelle fordern nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern auch die Bildungspraxis heraus, in der es ja meist nicht um Widerstand, sondern um Anpassung an das Gegebene geht.
Insbesondere die politische Bildung, die aufgrund der Interdependenz von Politik und Ökonomie auch für die ökonomische Bildung wichtig ist, steht hier vor elementaren Fragen: Ist Mündigkeit ohne die Fähigkeit, "nein" zu sagen, sich zu verweigern, ohne die Kompetenz zum Widerstand also, überhaupt möglich? Wann ist Widerstand gerechtfertigt oder sogar geboten? Welche Kompetenzen sind erforderlich, um zu entscheiden, wann Widerstand nötig, wer zuständig, welche Form angemessen ist? Was brauchen Menschen, um diese Entscheidung auch praktisch durchzuhalten? Und schließlich: Wie können all diese Voraussetzungen für praktische Mündigkeit erworben werden?
Erfahrene zivilgesellschaftliche Widerstandspraktiker und namhafte Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen (Philosophie, Politikwissenschaft, Politikdidaktik) erörtern diese brisante Aufgabe der politischen Bildung.
Insbesondere die politische Bildung, die aufgrund der Interdependenz von Politik und Ökonomie auch für die ökonomische Bildung wichtig ist, steht hier vor elementaren Fragen: Ist Mündigkeit ohne die Fähigkeit, "nein" zu sagen, sich zu verweigern, ohne die Kompetenz zum Widerstand also, überhaupt möglich? Wann ist Widerstand gerechtfertigt oder sogar geboten? Welche Kompetenzen sind erforderlich, um zu entscheiden, wann Widerstand nötig, wer zuständig, welche Form angemessen ist? Was brauchen Menschen, um diese Entscheidung auch praktisch durchzuhalten? Und schließlich: Wie können all diese Voraussetzungen für praktische Mündigkeit erworben werden?
Erfahrene zivilgesellschaftliche Widerstandspraktiker und namhafte Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen (Philosophie, Politikwissenschaft, Politikdidaktik) erörtern diese brisante Aufgabe der politischen Bildung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber
Das Thema und die Beiträge
Fritz Reheis
Einführung
1. Was ist ein erfolgreicher Widerstand?
Wann sind Menschen widerständig?
Michael Sladek
Die Stromrebellen aus Schönau ein konkretes Beispiel
Heiner Keupp
Ermutigung zum aufrechten Gang.
Statt Furcht vor der Freiheit das Handwerk der Freiheit
2. Was heißt Kompetenz zum Widerstand?
Phänomenologische Annäherungen
Gerd Meyer
Zivilcourage als widerständiges Verhalten im Alltag
Martin Becher
Der unfreiwilligste Spendenlauf Deutschlands Widerstand gegen Neonazis?
Werner Karg
Der Selbstgewissheit widerstehen
Sonja Leboš
Bürger gegen Investoren Fallstudien aus Kroatien
3. Kann und soll die Kompetenz zum Widerstand gefördert werden?
Grundsätzliche Überlegungen aus unterschiedlichen Perspektiven
3. 1 Widerstandskompetenz und Rechtfertigungsdiskurs
Frauke Höntzsch
Widerstand (k)ein Menschenrecht
Michael Gerten
Das Erziehungsziel des mündigen Bürgers im Kontext von Moral und Recht
Markus Killius
Das repressive Ethos oder weshalb wir eine , Moral des Widerstands` brauchen
3. 2 Widerstandskompetenz, Demokratiediskurs und Kompetenzdiskurs
Malte Ebner von Eschenbach, Ortfried Schäffter
Epistemische Widerständigkeit in der Politischen Bildung
Verantwortungsvoller Umgang mit Differenzen als Demokratiekompetenz
Tonio Oeftering
Kritik und Widerstand aus politiktheoretischer und politikdidaktischer Perspektive
Claire Moulin-Doos, Andreas Eis
Kompetenz zum Widerstand oder zum politischen Ungehorsam?
Armin Scherb
Widerstandskompetenz als Ziel der Politischen Bildung?
Die pragmatistische Sicht der Dinge
4. Wie kann die Kompetenz zum Widerstand gefördert werden?
Praktische Konsequenzen aus soziologischer und erziehungswissenschaftlicher Perspektive
4. 1 Widerstandskompetenz und Schule
Mario Förster, Michaela Weiß
Selbstverständlich Demokratie? !
Eine empirische Untersuchung zum Demokratieverstehen von Schülerinnen und Schülern
Stefanie Kessler
Empirische Einblicke in die Unterrichtspraxis von Lehrerinnen und Lehrern.
Handlungsorientierungen für einen kritischen Politikunterricht
4. 2 Widerstandskompetenz und Arbeitswelt
Josef Held
Solidarität und Widerstand in der Arbeitswelt
Jörg Schröder
Widerstand als Umgestaltung über die Ressourcen von Leib und Bewegung in der flexiblen Arbeitswelt
4. 3 Widerstandskompetenz und öffentlicher Raum
Lorenz Kutzer
Lernräume der Widerständigkeit.
Die Bedeutung öffentlicher Räume für den Aufbau politischer Widerstandskompetenz
Jana Trumann
Alternative Lern-Handlungsräume als widerständige Praxis
Impulse für die (politische) Bildungsarbeit
4. 4 Medien und Methoden
Markus Gloe
Musik als Medium des Widerstands und seine Verwendung im Sozialkundeunterricht
Sabine Zelger
, Der Einkaufswagen hat mich längst durchschaut`.
Mit Marktsatiren zu widerständiger Bildung
Nachwort der Herausgeber
Versuch eines Fazits
Autorinnen, Autoren und Herausgeber
Das Thema und die Beiträge
Fritz Reheis
Einführung
1. Was ist ein erfolgreicher Widerstand?
Wann sind Menschen widerständig?
Michael Sladek
Die Stromrebellen aus Schönau ein konkretes Beispiel
Heiner Keupp
Ermutigung zum aufrechten Gang.
Statt Furcht vor der Freiheit das Handwerk der Freiheit
2. Was heißt Kompetenz zum Widerstand?
Phänomenologische Annäherungen
Gerd Meyer
Zivilcourage als widerständiges Verhalten im Alltag
Martin Becher
Der unfreiwilligste Spendenlauf Deutschlands Widerstand gegen Neonazis?
Werner Karg
Der Selbstgewissheit widerstehen
Sonja Leboš
Bürger gegen Investoren Fallstudien aus Kroatien
3. Kann und soll die Kompetenz zum Widerstand gefördert werden?
Grundsätzliche Überlegungen aus unterschiedlichen Perspektiven
3. 1 Widerstandskompetenz und Rechtfertigungsdiskurs
Frauke Höntzsch
Widerstand (k)ein Menschenrecht
Michael Gerten
Das Erziehungsziel des mündigen Bürgers im Kontext von Moral und Recht
Markus Killius
Das repressive Ethos oder weshalb wir eine , Moral des Widerstands` brauchen
3. 2 Widerstandskompetenz, Demokratiediskurs und Kompetenzdiskurs
Malte Ebner von Eschenbach, Ortfried Schäffter
Epistemische Widerständigkeit in der Politischen Bildung
Verantwortungsvoller Umgang mit Differenzen als Demokratiekompetenz
Tonio Oeftering
Kritik und Widerstand aus politiktheoretischer und politikdidaktischer Perspektive
Claire Moulin-Doos, Andreas Eis
Kompetenz zum Widerstand oder zum politischen Ungehorsam?
Armin Scherb
Widerstandskompetenz als Ziel der Politischen Bildung?
Die pragmatistische Sicht der Dinge
4. Wie kann die Kompetenz zum Widerstand gefördert werden?
Praktische Konsequenzen aus soziologischer und erziehungswissenschaftlicher Perspektive
4. 1 Widerstandskompetenz und Schule
Mario Förster, Michaela Weiß
Selbstverständlich Demokratie? !
Eine empirische Untersuchung zum Demokratieverstehen von Schülerinnen und Schülern
Stefanie Kessler
Empirische Einblicke in die Unterrichtspraxis von Lehrerinnen und Lehrern.
Handlungsorientierungen für einen kritischen Politikunterricht
4. 2 Widerstandskompetenz und Arbeitswelt
Josef Held
Solidarität und Widerstand in der Arbeitswelt
Jörg Schröder
Widerstand als Umgestaltung über die Ressourcen von Leib und Bewegung in der flexiblen Arbeitswelt
4. 3 Widerstandskompetenz und öffentlicher Raum
Lorenz Kutzer
Lernräume der Widerständigkeit.
Die Bedeutung öffentlicher Räume für den Aufbau politischer Widerstandskompetenz
Jana Trumann
Alternative Lern-Handlungsräume als widerständige Praxis
Impulse für die (politische) Bildungsarbeit
4. 4 Medien und Methoden
Markus Gloe
Musik als Medium des Widerstands und seine Verwendung im Sozialkundeunterricht
Sabine Zelger
, Der Einkaufswagen hat mich längst durchschaut`.
Mit Marktsatiren zu widerständiger Bildung
Nachwort der Herausgeber
Versuch eines Fazits
Autorinnen, Autoren und Herausgeber
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. Oktober 2016
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
240
Dateigröße
1,74 MB
Reihe
Wochenschau Wissenschaft
Herausgegeben von
Michael Görtler, Fritz Reheis, Johann Waas, Stefan Denzler
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783734403491
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Kompetenz zum Widerstand" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.

































