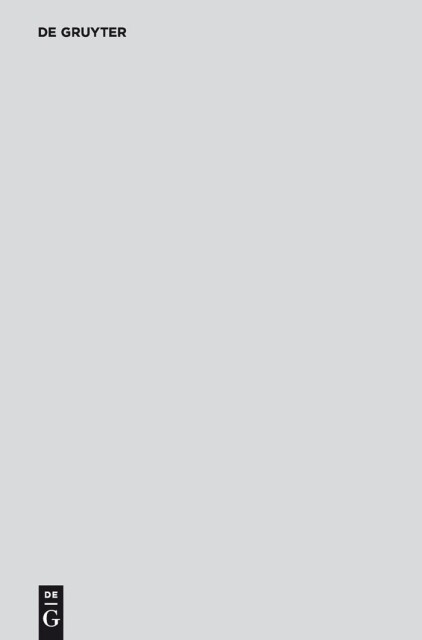Keine ausführliche Beschreibung für "NAMENFORSCHUNG (EICHLER) BD. 2 U. REG. HSK 11. 2 E-BOOK" verfügbar.
Inhaltsverzeichnis
1;Inhalt / Contents / Table des matières;5 2;Verzeichnis der Karten und Abbildungen / Index of Maps and Figures / Index des cartes géographiques et des illustrations;27 3;IX. Namen im Sprachkontakt;31 3.1;152. Namen im Sprachaustausch: Germanisch;31 3.1.1;1. Ortsnamen im Sprachkontakt Mehrsprachige Ortsnamen;31 3.1.2;2. Die Gruppen historisch mehrsprachiger Ortsnamen und ihre Eindeutschung;32 3.1.3;3. Der gegenwärtige mehrsprachige Ortsnamengebrauch;37 3.1.4;4. Literatur (in Auswahl);39 3.2;153. Namen im Sprachaustausch: Romanisch;43 3.2.1;1. Einleitung;43 3.2.2;2. Ostgermanisches Superstrat;44 3.2.3;3. Westgermanisches Superstrat;44 3.2.4;4. Zusammenfassung;47 3.2.5;5. Literatur (in Auswahl);47 3.3;154. Namen im Sprachaustausch: Romanische Relikte im Salzburger Becken;49 3.3.1;1. Die römischen Provinzen Noricum und Raetien;49 3.3.2;2. Der römische Stadtbezirk von Iuvavum und der bairische Salzburggau;50 3.3.3;3. Die alten Ortsnamen des Salzburggaues;50 3.3.4;4. Vordeutsche Ortsnamen;52 3.3.5;5. Altersschichten der Eindeutschung;54 3.3.6;6. Schlußfolgerungen für die Siedlungsgeschichte;57 3.3.7;7. Literatur (in Auswahl);58 3.4;155. Namen im Sprachaustausch: Slavisch;59 3.4.1;1. Beschreibungsmodell für Eigennamen in Sprachkontaktgebieten;59 3.4.2;2. Phasen und Ergebnisse onymischer Entlehnung im Sprachkontakt;59 3.4.3;3. Zusammenfassung und Ausblick;62 3.4.4;4. Literatur (in Auswahl);62 3.5;156. Names in Language Contact: Exonyms;64 3.5.1;1. The Term;64 3.5.2;2. Examples;64 3.5.3;3. Selected Bibliography;64 3.6;157. Namen im Sprachaustausch: Toponymische Nachbenennung;65 3.6.1;1. Definition und Abgrenzung;65 3.6.2;2. Chronologie und Verbreitung;66 3.6.3;3. Wahlmotive;67 3.6.4;4. Literatur (in Auswahl);69 3.7;158. Namen im Sprachaustausch: Namenübersetzung;70 3.7.1;1. Übersetzen und Eigennamen;70 3.7.2;2. Übersetzbarkeit von Namen;70 3.7.3;3. Code und Text bei der Namenübersetzung;72 3.7.4;4. Codierte Veränderung: Ersetzende Namenübersetzung;73 3.7.5;5. Namenübersetzu
ng im Text: Erklärung und Illustration;74 3.7.6;6. Literatur (in Auswahl);77 3.8;159. Names in Language Contact: Foreign Placenames;78 3.8.1;1. Introduction;78 3.8.2;2. Toponyms from Nouns and Names;78 3.8.3;3. Linguistic Nativization;79 3.8.4;4. Historical Implications;80 3.8.5;5. Semantic Aspects;81 3.8.6;6. Selected Bibliography;83 3.9;160. Namen in Sprachinseln: Deutsch;84 3.9.1;1. Untersuchungsgebiet;84 3.9.2;2. Ortsnamen;85 3.9.3;3. Personennamen;88 3.9.4;4. Zusammenfassung;89 3.9.5;5. Literatur (in Auswahl);89 3.10;161. Namen in Sprachinseln: Italienisch-langobardisch;91 3.10.1;1. Das langobardische Superstrat;91 3.10.2;2. Fragen der langobardischen Namenforschung;91 3.10.3;3. Die Typologie der Namen;92 3.10.4;4. Einfluß der romanischen Umgebung;92 3.10.5;5. Literatur (in Auswahl);93 3.11;162. Namen im Alten Rom;93 3.11.1;1. Einleitung;93 3.11.2;2. Cognomina nach sprachlicher Herkunft;94 3.11.3;3. Sprachliche und soziale Verteilung der Cognomina;98 3.11.4;4. Chronologie des Cognomens;99 3.11.5;5. Literatur (in Auswahl);99 3.12;163. Die christliche Namengebung;100 3.12.1;1. Definition;100 3.12.2;2. Christliche Spätantike;101 3.12.3;3. Völkerwanderungszeit und Mittelalter;102 3.12.4;4. Neuzeit;106 3.12.5;5. Literatur (in Auswahl);108 3.13;164. Namen in kolonialen und postkolonialen Verhältnissen: Mesoamerika;110 3.13.1;1. Der Forschungsraum;110 3.13.2;2. Sprachschichten und ihre gegenseitige Durchdringung;110 3.13.3;3. Aztekische Schicht;111 3.13.4;4. Spanische Kolonisation;116 3.13.5;5. Auswirkungen der Unabhängigkeit;116 3.13.6;6. Reliktgebiete;116 3.13.7;7. Literatur (in Auswahl);116 4;X. Namengeographie;117 4.1;165. Namengeographie als historische Hilfsdisziplin;117 4.1.1;1. Abgrenzung des Themas;117 4.1.2;2. Makrotoponyme;117 4.1.3;3. Mikrotoponyme;118 4.1.4;4. Anthroponyme;119 4.1.5;5. Literatur (in Auswahl);120 4.2;166. Die Namen in Deutschland;122 4.2.1;1. Grundsätzliches;122 4.2.2;2. Vor-, früh- und nicht-germanische Toponyme;123 4.2.3;3. Germanische S
iedlungsnamen (seit) der Völkerwanderungszeit;125 4.2.4;4. Namen des früh-, hoch- und spätmittelalterlichen Landesausbaus;129 4.2.5;5. Neuzeitliche Ortsnamen;132 4.2.6;6. Literatur (in Auswahl);132 4.3;167. Die Ortsnamen in Österreich;133 4.3.1;1. Einleitung;133 4.3.2;2. Die Ortsnamen antik-romanischer Herkunft (Karte 167.1);133 4.3.3;3. Die Ortsnamen germanischer Herkunft;135 4.3.4;4. Die Ortsnamen slawischer Herkunft (Karte 167.2);135 4.3.5;5. Ortsnamen deutscher Herkunft;137 4.3.6;6. Die magyarischen Ortsnamen im Burgenland;139 4.3.7;7. Die italienischen Namen in Südtirol;140 4.3.8;8. Literatur (in Auswahl);140 4.4;168. Skandinavische Ortsnamen unter kulturräumlichem Aspekt;142 4.4.1;1. Allgemeines;142 4.4.2;3. Der südskandinavische Kulturraum;145 4.4.3;4. Der ostschwedische Kulturraum;147 4.4.4;5. Der götische Kulturraum;150 4.4.5;6. Literatur (in Auswahl);150 4.5;169. Les noms propres en France;151 4.5.1;1. La France romane et non romane;151 4.5.2;2. Domaine non roman, plus Corse;151 4.5.3;3. Pays dOïl et dOc, Catalogne;153 4.5.4;4. Bibliographie sélective;158 4.6;170. Slawische Namengeographie: Der Slawische Onomastische Atlas;158 4.6.1;1. Zielstellung;158 4.6.2;2. Zur Methode des SlawischenOnomastischen Atlasses;160 4.6.3;3. Zwei supplementäre Ansätze: Typologie und Areal;160 4.6.4;4. Der Slawische Onomastische Atlas im heute nichtslawischen Sprachgebiet;166 4.6.5;5. Der Altsorbische Toponymische Atlas;169 4.6.6;6. Literatur (in Auswahl);171 4.7;171. Les noms propres au Canada;173 4.7.1;1. Toponymie;173 4.7.2;2. Anthroponymie;182 4.7.3;3. Bibliographie sélective;184 4.8;172. Geographic Names Activity in the United States;185 4.8.1;1. Introduction;185 4.8.2;2. Early Period;186 4.8.3;3. Standardization;187 4.8.4;4. Foreign Names;188 4.8.5;5. International Activity;188 4.8.6;6. Domestic Names;188 4.8.7;7. State Names Authorities;189 4.8.8;8. Automation;190 4.8.9;9. The National Gazetteer Program;191 4.8.10;10. Place Names Survey of the United States;191 4.8.11;1
1. Summary;192 4.8.12;12. Selected Bibliography;193 4.9;173. Familiennamengeographie;193 4.9.1;1. Einleitung;193 4.9.2;2. Die Materialbasis familiennamengeographischer Untersuchungen;194 4.9.3;3. Die Kartierung der Namen;195 4.9.4;4. Zu kartierende Probleme und ihre Interpretation;197 4.9.5;5. Literatur (in Auswahl);204 4.10;174. Familiennamengeographie und -morphologie;205 4.10.1;1. Patronymika;205 4.10.2;2. Nichtpatronymische Appositionen;207 4.10.3;3. Herkunftsnamen;212 4.10.4;4. Literatur (in Auswahl);215 4.11;175. Van-Namen als Auswanderungsmesser;216 4.11.1;1. Die Eigenart der Van-Namen;216 4.11.2;2. Die Van-Namen in denTelefonbüchern;216 4.11.3;3. Die Verbreitung der Van-Namen in Belgien;217 4.11.4;4. Die Verbreitung der Van-Namen in Nordfrankreich;219 4.11.5;5. Literatur (in Auswahl);221 4.12;176. Flurnamengeographie;221 4.12.1;1. Gegenstand;221 4.12.2;2. Geschichtlicher Überblick;222 4.12.3;3. Ergebnisse und Ziele;223 4.12.4;4. Literatur (in Auswahl);226 5;XI. Personennamen I: Einzelnamen und Vornamen;227 5.1;177. Typologie und Benennungssysteme;227 5.1.1;1. Abgrenzungen;227 5.1.2;2. Anzahl und Unterteilung der Vornamen;228 5.1.3;3. Kennzeichnung des Geschlechts;228 5.1.4;4. Besondere Vornamentypen;228 5.1.5;5. Benennungssysteme;229 5.1.6;6. Literatur (in Auswahl);229 5.2;178. Das anthroponymische System und sein Funktionieren;230 5.2.1;1. Die propriale Nomination;230 5.2.2;2. Das anthroponymische System auf der Ebene der Sprache und der Rede;231 5.2.3;3. Das anthroponymische System unter soziolinguistischem Aspekt;231 5.2.4;4. Das anthroponymische System unter statistischem und geographischem Aspekt;232 5.2.5;5. Der Mechanismus des Funktionierens des anthroponymischen Systems;232 5.2.6;6. Literatur (in Auswahl);233 5.3;179. Morphologie und Wortbildung der Vornamen: Germanisch;233 5.3.1;1. Grundsätzliches;233 5.3.2;2. Zweigliedrige Personennamen (Männernamen);234 5.3.3;3. Eingliedrige Personennamen;235 5.3.4;4. Namen mit Halbsuffixen;237 5.3.5;5. Frauenname
n;237 5.3.6;6. Literatur (in Auswahl);238 5.4;180. Morphologie et formation des mots des plus anciens noms de personnes: domaine roman;238 5.4.1;1. Introduction;238 5.4.2;2. Morphologie;239 5.4.3;3. Formation des mots;241 5.4.4;4. Bibliographie sélective;243 5.5;181. Morphologie und Wortbildung der ältesten Personennamen: Slavisch;244 5.5.1;1. Einleitung. Terminologische Bemerkungen. Das älteste slawische anthroponymische System;244 5.5.2;2. Morphologie und Wortbildung der ältesten slawischen Anthroponymie;245 5.5.3;3. Entwicklung des altenanthroponymischen Systems in den slawischen Sprachen;247 5.5.4;4. Literatur (in Auswahl);248 5.6;182. Geschichtliche Entwicklung der Vornamen am Beispiel eines Sprach- und Kulturbereichs;249 5.6.1;1. Namenzeugnisse des Kölner Raumes in römischer Zeit;249 5.6.2;2. Die Periode der vorwiegend germanischsprachigen Namen;250 5.6.3;3. Die Verhältnisse im 12. Jahrhundert und das Aufkommen der Heiligennamen;251 5.6.4;4. Die Namen am Ausgang des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit;251 5.6.5;5. Der Umbruch im 20. Jahrhundert;252 5.6.6;6. Literatur (in Auswahl);253 5.7;183. Fremde Rufnamen;254 5.7.1;1. Linguistische Aspekte;254 5.7.2;2. Soziokulturelle Aspekte;255 5.7.3;3. Literatur (in Auswahl);256 5.8;184. Traditionen der Vornamengebung. Motivationen, Vorbilder, Moden: Germanisch;258 5.8.1;1. Einleitung;258 5.8.2;2. Gebundene Vornamengebung;259 5.8.3;3. Freie Vornamengebung;260 5.8.4;4. Moden in der Vornamengebung;263 5.8.5;5. Literatur (in Auswahl);264 5.9;185. Traditionen der Vornamengebung. Motivationen, Vorbilder, Moden: Slavisch;265 5.9.1;1. Motivationen der Vornamengebung;265 5.9.2;2. Außersprachliche Motive;266 5.9.3;3. Literatur (in Auswahl);269 5.10;186. Middle Names;269 5.10.1;1. Middle Names;269 5.10.2;2. Middle Names As a Typical American Phenomenon;271 5.10.3;3. Selected Bibliography;272 5.11;187. The Dynamics of Personal Names and Naming Practices in Africa;273 5.11.1;1. Introduction;273 5.11.2;2. European Influences on Na
ming Practices;274 5.11.3;3. Changes in African Naming Patterns;276 5.11.4;4. Conclusion;278 5.11.5;5. Selected Bibliography;278 5.12;188. Bynames;279 5.12.1;1. Introduction. Definition. Origin;279 5.12.2;2. Byname Patterns;279 5.12.3;3. Diachronic Classification of Bynames;280 5.12.4;4. Socio-onomastic Aspects of Bynames;282 5.12.5;5. Selected Bibliography;282 5.13;189. Personennamen in mehrsprachigen Ländern und Regionen: Schweiz;283 5.13.1;1. Name und Einzelsprache;283 5.13.2;2. Nomeme und Allonome;284 5.13.3;3. Sprachliche Unterschiede zwischen Allonomen;284 5.13.4;4. Tendenzen der Namengebung in der Schweiz;286 5.13.5;5. Literatur (in Auswahl);291 5.14;190. Personennamen in mehrsprachigen Ländern und Regionen: Italien;292 5.14.1;1. Einleitung;292 5.14.2;2. Forschungsstand;293 5.14.3;3. Ausländische Vornamen;293 5.14.4;4. Bildung des italienischen Namenbestandes;293 5.14.5;5. Die Sprachminderheiten in Italien;296 5.14.6;6. Literatur (in Auswahl);297 6;XII. Personennamen II: Familiennamen;298 6.1;191. Typologie und Benennungssysteme bei Familiennamen: prinzipiell und kulturvergleichend;298 6.1.1;1. Vorbemerkungen;298 6.1.2;2. Aus Beinamen hervorgegangene Familiennamen;300 6.1.3;3. Bewußte Familiennamenschöpfungen;306 6.1.4;4. Benennungssysteme;307 6.1.5;5. Literatur (in Auswahl);307 6.2;192. Morphologie und Wortbildung der Familiennamen: Germanisch;310 6.2.1;1. Vorbemerkung;310 6.2.2;2. Wortbildung;310 6.2.3;3. Syntagmen als Familiennamen;312 6.2.4;4. Strukturtypologischer Aspekt;313 6.2.5;5. Literatur (in Auswahl);313 6.3;193. Morphologie und Wortbildung der Familiennamen: Romanisch;314 6.3.1;1. Vorbemerkungen;314 6.3.2;2. Namenfrequenzen;314 6.3.3;3. Namenbildung;317 6.3.4;4. Literatur (in Auswahl);325 6.4;194. Morphologie und Wortbildung der Familiennamen: Slavisch;326 6.4.1;1. Familiennamen aus nomina propria;326 6.4.2;2. Familiennamen aus Appellativen;330 6.4.3;3. Literatur (in Auswahl);330 6.5;195. Entstehung und geschichtliche Entwicklung der Familiennamen
in Deutschland;331 6.5.1;1. Der Übergang vom ein namigen zum zweinamigen Personennamensystem;331 6.5.2;2. Das Aufkommen der Doppelnamigkeit am Beispiel Regensburgs;332 6.5.3;3. Die Familiennamenentwicklung bis zur Gegenwart;333 6.5.4;4. Literatur (in Auswahl);334 6.6;196. Scottish Personal Names;335 6.6.1;1. Introduction. The Scottish Diaspora;335 6.6.2;2. Forenames and Surnames;335 6.6.3;3. The Linguistic Situation;336 6.6.4;4. The Principal Types of Surname;336 6.6.5;5. Locality Names;337 6.6.6;6. Occupational Names;337 6.6.7;7. Nicknames;338 6.6.8;8. Mac Names;338 6.6.9;9. The Lost Mac Names;339 6.6.10;10. Immigrant Names;339 6.6.11;11. Summary and Conclusion;340 6.6.12;12. Selected Bibliography;340 6.7;197. Les patronymes dans les domaines linguistiques limitrophes Les traductions humanistes des patronymes;340 6.7.1;1. Le modèle linguistique;340 6.7.2;2. Lorigine des noms de famille;341 6.7.3;3. Le phénomène humaniste;341 6.7.4;4. Bibliographie sélective;344 7;XIII. Personennamen III: Sonstige;345 7.1;198. Slavische Adelsnamen;345 7.1.1;1. Vornamen des slawischen Adels;345 7.1.2;2. Familiennamen des slawischen Adels;345 7.1.3;3. Beinamen des polnischen Adels;346 7.1.4;4. Tschechische Adelsnamen;346 7.1.5;5. Ost- und südslawische Adelsnamen;346 7.1.6;6. Literatur (in Auswahl);347 7.2;199. Namen von Freien und Unfreien;347 7.2.1;1. Mythisch-ontologische Begründung von Herrschaft und Knechtschaft;347 7.2.2;2. Sklaven- und Herrennamen-Typologie;348 7.2.3;3. Sklaven- und Herrennamen in der griechischen und lateinischen Welt;348 7.2.4;4. Hörigen- und Herrennamen im frühen Mittelalter;349 7.2.5;5. Hohes Mittelalter / Frühe Neuzeit;349 7.2.6;6. Neuzeit;350 7.2.7;7. Spuren der alten Verhältnisse in der Gegenwart;350 7.2.8;8. Literatur (in Auswahl);351 7.3;200. Die Namen der Juden und der Antisemitismus;351 7.3.1;1. Voraussetzungen;351 7.3.2;2. Die Geschichte der jüdischen Namen und ihrer Verfemung;356 7.3.3;3. Erklärung der Effektivität der Namenpolemik;359 7.3.4;4. Die
ausgebauten Register antisemitischer Aggressionstechniken;359 7.3.5;5. Literatur (in Auswahl);360 7.4;201. On the Study of Jewish Family Names;361 7.4.1;1. Introduction;361 7.4.2;2. On Becoming an Anthroponymist;361 7.4.3;3. Stimuli for the Study of Jewish Family Names;363 7.4.4;4. Results;365 7.4.5;5. Some Goals of Jewish Anthroponymy;369 7.4.6;6. Selected Bibliography;371 7.5;202. Personennamen im indianischen Nordamerika;372 7.5.1;1. Einleitung;372 7.5.2;2. Das Beispiel der Cheyenne: Anlässe der Namengebung, Nicknames und kosmologischer Bezug;373 7.5.3;3. Die Annahme eines neuen Namens;377 7.5.4;4. Der genealogische Aspekt bei der Namengebung;378 7.5.5;5. Die Herkunft des Namens aus dem Traum;378 7.5.6;6. Literatur (in Auswahl);379 8;XIV. Völker-, Länder- und Einwohnernamen;381 8.1;203. Völkernamen Europas;381 8.1.1;1. Allgemeine und theoretische Fragen;381 8.1.2;2. Wortbildung und Bedeutung;383 8.1.3;3. Geschichte und Übergänge;389 8.1.4;4. Literatur (in Auswahl);392 8.2;204. Some Problems of Ethnonyms for Non-Western Peoples;394 8.2.1;1. Introduction;394 8.2.2;2. Conceptual Issues;394 8.2.3;3. Technical Issues;397 8.2.4;4. Conclusion;398 8.2.5;5. Selected Bibliography;398 8.3;205. Typologie der Ländernamen: Staaten-, Länder-, Landschaftsnamen;399 8.3.1;1. Gegenstandsbereich und Methode;399 8.3.2;2. Interlinguale Allonymie;400 8.3.3;3. Motiviertheit im Sinn von Wortform-Durchsichtigkeit;400 8.3.4;4. Klassifikation nach Inhaltselementen und den Beziehungen zwischen diesen;401 8.3.5;5. Stilistische Variation;403 8.3.6;6. Staaten-, Provinz- und Distriktnamen;404 8.3.7;7. Literatur (in Auswahl);406 8.4;206. Morphologie und Wortbildung der Ländernamen;407 8.4.1;1. Zur Formenlehre der Ländernamen;407 8.4.2;2. Wortbildung der Ländernamen;408 8.4.3;3. Literatur (in Auswahl);411 8.5;207. Les gentilés;412 8.5.1;1. La désignation des habitants;412 8.5.2;2. Les suffixes servant à désigner les habitants des villes;412 8.5.3;3. Bibliographie sélective;417 8.6;208. Le blason
populaire en Wallonie;418 8.6.1;1. Le champ dobservation: la Wallonie;418 8.6.2;2. Gentilés et blasons populaires;418 8.6.3;3. Le blason populaire;418 8.6.4;4. Les autres formes de blasons populaires;419 8.6.5;5. Les procédés linguistiques de formation;419 8.6.6;6. Les blasons elliptiques et les allusions;420 8.6.7;7. Bibliographie sélective;420 9;XV. Ortsnamen I: Siedlungsnamen;421 9.1;209. Morphologie und Wortbildung der Ortsnamen;421 9.1.1;1. Wort- und Namenbildung im allgemeinen;421 9.1.2;2. Ortsnamenbildung im allgemeinen;421 9.1.3;3. Syntaktische Verbindungen;425 9.1.4;4. Dekompositionen;425 9.1.5;5. Zusammenbildungen;426 9.1.6;6. Rückbildungen;426 9.1.7;7. Tautologien;426 9.1.8;8. Elliptische Namen;426 9.1.9;9. Literatur (in Auswahl);426 9.2;210. Morphologie des noms de lieux: domaine roman;427 9.2.1;1. Le problème de larticle;427 9.2.2;2. Agglutination et déglutination des prépositions;427 9.2.3;3. Les traces de la déclinaison latine;428 9.2.4;4. Le genre;431 9.2.5;5. Les suffixes;431 9.2.6;6. La composition;433 9.2.7;7. Bibliographie sélective;433 9.3;211. Morphologie der Ortsnamen: Slavisch;434 9.3.1;1. Allgemeine Vorbemerkung;434 9.3.2;2. Zur Morphemanalyse der slavischen Ortsnamen;434 9.3.3;3. Strukturtypen der slavischen Ortsnamen;436 9.3.4;4. Literatur (in Auswahl);437 9.4;212. Traditionen der Ortsnamengebung;437 9.4.1;1. Einleitung;437 9.4.2;2. Natürliche Bedingungen;438 9.4.3;3. Besiedlung und Nutzung der Natur;438 9.4.4;4. Profane und sakrale Verhältnisse;439 9.4.5;5. Analogie und Musternamengebung;439 9.4.6;6. Namenübertragung;440 9.4.7;7. Institutionelle Namengebung;440 9.4.8;8. Ideologische Namengebung;442 9.4.9;9. Literatur (in Auswahl);442 9.5;213. Geschichtliche Entwicklung der Ortsnamen an exemplarischen Beispielen;443 9.5.1;1. Die vorherrschenden Fragestellungen;443 9.5.2;2. Historische Veränderungen in systematischer Sicht;443 9.5.3;3. Literatur (in Auswahl);447 9.6;214. Ortsnamen Mexikos;448 9.6.1;1. Epochen der mexikanischen Kulturlandsch
aftsgeschichte;448 9.6.2;2. Die Namenschicht vor der Conquista;449 9.6.3;3. Ortsnamen in der Kolonialzeit;451 9.6.4;4. Ortsnamenänderungen und Neubildungen im 19. Jahrhundert;452 9.6.5;5. Revolution und Agrarreform im Spiegel der Ortsnamen;452 9.6.6;6. Ortsnamengebung heute;453 9.6.7;7. Literatur (in Auswahl);453 9.7;215. Amerindian Toponyms in the United States;454 9.7.1;1. Introduction;454 9.7.2;2. Names of Nations;455 9.7.3;3. Placenames;455 9.7.4;4. Names of States;458 9.7.5;5. Conclusion;459 9.7.6;6. Selected Bibliography;459 9.8;216. Scottish Place Names;460 9.8.1;1. Introduction;460 9.8.2;2. Toponymic Strata;460 9.8.3;3. Summary;462 9.8.4;4. Selected Bibliography;462 9.9;217. Ortsnamen in mehrsprachigen Ländern und Regionen: Romania/Romania submersa;464 9.9.1;1. Einleitung;464 9.9.2;2. Ortsnamenwechsel;464 9.9.3;3. Relikte einer früheren Sprachstufe;465 9.9.4;4. Doppelnamen;465 9.9.5;5. Exonyme;469 9.9.6;6. Literatur (in Auswahl);469 9.10;218. Ortsnamen in mehrsprachigen Ländern und Regionen: deutsch/slavisch;471 9.10.1;1. Kontakte der Germanen und Slaven in Europa;471 9.10.2;2. Behandlung fremdsprachiger Ortsnamen bei den sprachlichen Kontakten;472 9.10.3;3. Die phonologische Ebene der Ortsnamen;473 9.10.4;4. Morphologische und wortbildende Ebene der Ortsnamen;474 9.10.5;5. Lexikalisch-semantische Ebene der Ortsnamen;475 9.10.6;6. Exonyme;475 9.10.7;7. Literatur (in Auswahl);476 9.11;219. Place Name Study: Getting Started;477 9.11.1;1. Introduction;477 9.11.2;2. Place-Name Study;477 9.11.3;3. Selected Bibliography;480 10;XVI. Ortsnamen II: Flurnamen;481 10.1;220. Morphologie und Wortbildung der Flurnamen: Germanisch;481 10.1.1;1. Einleitung;481 10.1.2;2. Simplexformen;481 10.1.3;3. Flektierte Formen;481 10.1.4;4. Ableitungsformen;481 10.1.5;5. Wortkomposition;483 10.1.6;6. Literatur (in Auswahl);484 10.2;221. Typologie der Flurnamen (Mikrotoponomastik): Germanisch;485 10.2.1;1. Terminologie und Benennungsmotivation;485 10.2.2;2. Flurnamentypen;485 10.2.3;3.
Literatur (in Auswahl);492 10.3;222. Morphologie et formation des microtoponymes: domaine roman;493 10.3.1;1. Introduction;493 10.3.2;2. Dérivation;493 10.3.3;3. Autres phénomènes morphologiques;496 10.3.4;4. Phénomènes morphosyntaxiques complexes;497 10.3.5;5. Bibliographie sélective;497 10.4;223. Morphologie und Wortbildung der Flurnamen: Slavisch;498 10.4.1;1. Morphologisch-wortbildende Analyse;498 10.4.2;2. Bezugsmodell- und Strukturanalyse;499 10.4.3;3. Beispiele;501 10.4.4;4. Literatur (in Auswahl);502 10.5;224. Geschichtliche Entwicklung der Flurnamen an exemplarischen Beispielen: deutsch;502 10.5.1;1. Das Verhältnis von Name und Appellativum bei Flurnamen;502 10.5.2;2. Flurnamen und Wortgeschichte;503 10.5.3;3. Geschichte des Wortes Bofel;503 10.5.4;4. Flurnamen als Zeugnisse früherer Topographie;505 10.5.5;5. Literatur (in Auswahl);506 10.6;225. Geschichtliche Entwicklung der Flurnamen: skandinavisch;507 10.6.1;1. Einleitung;507 10.6.2;2. Überlieferung der skandinavischen Flurnamen;508 10.6.3;3. Alter der skandinavischen Flurnamen;508 10.6.4;4. Flurnamen-Systeme und ihre Verbreitung;510 10.6.5;5. Kontinuität;511 10.6.6;6. Literatur (in Auswahl);512 10.7;226. Geschichtliche Entwicklung der Flurnamen an exemplarischen Beispielen: slavisch;513 10.7.1;1. Allgemeines;513 10.7.2;2. Drei Beispiele;514 10.7.3;3. Schlußfolgerungen;518 10.7.4;4. Literatur (in Auswahl);518 10.8;227. Straßennamen: deutsch;519 10.8.1;1. Stellung der Straßennamen im Kategorialsystem der Onomastik;519 10.8.2;2. Wesen und Funktion der Straßennamen;519 10.8.3;3. Entwicklung und Motive der Straßennamen-Gebung;520 10.8.4;4. Straßennamen-Gebung in der Gegenwart;525 10.8.5;5. Literatur (in Auswahl);526 10.9;228. Straßennamen: slavisch;527 10.9.1;1. Einleitung: Gegenstand der Urbanonymie;527 10.9.2;2. Zur Herkunft der Urbanonyme;527 10.9.3;3. Charakter und Funktion der Urbanonyme;528 10.9.4;4. Zur Klassifikation des städtischen Namengutes;531 10.9.5;5. Literatur (in Auswahl);532 10.10;229. Stree
t Names as Signposts of World Cultures;532 10.10.1;1. Introduction;532 10.10.2;2. Research in Hodonymy;533 10.10.3;3. American Patterns;533 10.10.4;4. Outgrowing Street Name Motifs;540 10.10.5;5. Street Names Outside the UnitedStates;542 10.10.6;6. Street Name Survival;545 10.10.7;7. Land Developers as Street Namers;545 10.10.8;8. Rejected and Altered Street Names;546 10.10.9;9. Changing Fashions in Street Names;547 10.10.10;10. Resources for Street Names Research;547 10.10.11;11. Onomastic Layers of Culture;548 10.10.12;12. Conclusions;549 10.10.13;13. Selected Bibliography;549 10.11;230. Institutionelle innerörtliche Orientierungssysteme Fallstudien;550 10.11.1;1. Innerörtliche Orientierungssysteme;550 10.11.2;2. Lebenspraktisch-alltagssprachliche innerörtliche Systeme;550 10.11.3;3. Rationalisierender Festungs- und Städtebau seit dem Hochmittelalter und der Beginn institutioneller Namensysteme;551 10.11.4;4. Die Planstadt seit der Renaissance. Ihre institutionelle Benennung und ihre innerörtlichen Orientierungssysteme;552 10.11.5;5. Institutionelle innerörtliche Orientierungssysteme I: Das ideologische Modell im 16.18. Jahrhundert;552 10.11.6;6. Institutionelle innerörtliche Orientierungssysteme II: Die ideologischen Systeme im 19. und 20. Jahrhundert;557 10.11.7;7. Institutionelle innerörtliche Orientierungssysteme III: Rationalistische Systeme;559 10.11.8;8. Institutionelle innerörtliche Orientierungssysteme IV: Straße und Block;560 10.11.9;9. Literatur (in Auswahl);570 10.12;231. Berg- und Gebirgsnamen;572 10.12.1;1. Definition;572 10.12.2;2. Appellativische Bezeichnung für Erhebung;572 10.12.3;3. Benennung nach Größe und Form;573 10.12.4;4. Benennung nach der geologischen Beschaffenheit;573 10.12.5;5. Benennung nach der Bewachsung;573 10.12.6;6. Benennung nach der Tierwelt;573 10.12.7;7. Benennung nach der Lage;573 10.12.8;8. Benennung nach dem Wetter;574 10.12.9;9. Benennung nach der Nutzung;574 10.12.10;10. Benennung nach Personen;574 10.12.11;11. Mythologi
sche Benennung;575 10.12.12;12. Literatur (in Auswahl);575 10.13;232. Berg- und Gebirgsnamen: slavisch;575 10.13.1;1. Allgemeines;576 10.13.2;2. Slawische Bergnamengebung;577 10.13.3;3. Die wichtigsten den slawischen Bergnamen zugrundeliegenden Appellativa;579 10.13.4;4. Ein Beispiel: Die Namen der Karawanken (Slowenien);580 10.13.5;5. Slawisches Substrat: Beispiele aus Österreich und Griechenland;581 10.13.6;6. Literatur (in Auswahl);581 10.14;233. La toponymie souterraine en Wallonie;582 10.14.1;1. La toponymie souterraine;582 10.14.2;2. Les stratonymes;582 10.14.3;3. Ancienneté des noms de veines;583 10.14.4;4. Typologie des noms de veines de charbon;583 10.14.5;5. Typologie des noms de bancs de pierre;584 10.14.6;6. La toponymie des grottes;584 10.14.7;7. La toponymie des tranchées;584 10.14.8;8. Bibliographie sélective;584 11;XVII. Gewässernamen;585 11.1;234. Gewässernamen: Morphologie, Benennungsmotive, Schichten;585 11.1.1;1. Allgemeines;585 11.1.2;2. Gewässernamen-Typologie (am Beispiel der Hydronymie Deutschlands);585 11.1.3;3. Die alteuropäische Hydronymie;588 11.1.4;4. Hydronymien einzelner Länder und Sprachgebiete;588 11.1.5;5. Literatur (in Auswahl);589 11.2;235. Slavische Gewässernamengebung;590 11.2.1;1. Einführung;590 11.2.2;2. Geschichte der Forschung;591 11.2.3;3. Morphologische Typen;592 11.2.4;4. Historische Schichten; Substrat Alteuropäische Hydronymie595 11.2.5;5. Literatur (in Auswahl);597 11.3;236. Namen von Flußsystemen am Beispiel des Mains;599 11.3.1;1. Vorüberlegung;599 11.3.2;2. Hydrographie des Mains;599 11.3.3;3. Besiedelung der Mainlande;599 11.3.4;4. Forschungslage;601 11.3.5;5. Hydronymische Schichten;601 11.3.6;6. Ergebnisse;603 11.3.7;7. Literatur (in Auswahl);603 11.4;237. Fischerflurnamen;604 11.4.1;1. Gegenstandsbereich, Terminologie;604 11.4.2;2. Quellen;605 11.4.3;3. Materialsammlung und -auswertung;606 11.4.4;4. Exemplarische Darstellung: Wadenzug-Namen;607 11.4.5;5. Klassifizierung;610 11.4.6;6. Forschungslage;610 11.4.7;7.
Literatur (in Auswahl);610 12;XVIII. Namen von Sachen, Tieren und Einrichtungen;613 12.1;238. Namen von Sachen (Chrematonymie) I;613 12.1.1;1. Das spezifisch Chrematonymische;613 12.1.2;2. Chrematonymische Objekte;613 12.1.3;3. Die sprachliche Seite der Chrematonyme;615 12.1.4;4. Die Funktion der Chrematonyme;617 12.1.5;5. Literatur (in Auswahl);617 12.2;239. Namen von Sachen (Chrematonymie) II;618 12.2.1;1. Chrematonyme und ihre Gruppen;618 12.2.2;2. Eigennamen gesellschaftlicher Institutionen (Ergonyme, Institutionyme);618 12.2.3;3. Der Informationsgehalt der Chrematonyme;619 12.2.4;4. Die Funktionen der Chrematonyme;621 12.2.5;5. Zusammenfassung;622 12.2.6;6. Literatur (in Auswahl);622 12.3;240. Names of Apparatus;623 12.3.1;1. Introduction;623 12.3.2;2. Names of Objects;623 12.3.3;3. Peripheral Cases;625 12.3.4;4. Selected Bibliography;625 12.4;241. Namen von Fahrzeugen;625 12.4.1;1. Namen von Schiffen;625 12.4.2;2. Namen von Flugzeugen;628 12.4.3;3. Bezeichnungen von Kraftfahrzeugen;630 12.4.4;4. Namen von Schienenfahrzeugen;631 12.4.5;5. Literatur (in Auswahl);632 12.5;242. Humorous Names of US Pleasure Craft;633 12.5.1;1. Introduction;633 12.5.2;2. Naming Pleasure Craft;633 12.5.3;3. Selected Bibliography;634 12.6;243. Namen von Haustieren und Zuchttieren;634 12.6.1;1. Abgrenzung;634 12.6.2;2. Haustiernamen;635 12.6.3;3. Namen von Zuchttieren;638 12.6.4;4. Onomastische Relevanz;639 12.6.5;5. Literatur (in Auswahl);639 12.7;244. Names of Racehorses in the United Kingdom and the United States;640 12.7.1;1. Introduction;640 12.7.2;2. Naming Racehorses;640 12.7.3;3. Selected Bibliography;641 12.8;245. Apothekennamen;641 12.8.1;1. Bestimmung des Gegenstandsbereichs;641 12.8.2;2. Entstehung der Apothekennamen;642 12.8.3;3. Struktur der Apothekennamen;642 12.8.4;4. Literatur (in Auswahl);643 12.9;246. Klosternamen;644 12.9.1;1. Definition;644 12.9.2;2. Patrozinialer Name;644 12.9.3;3. Übernahme des bestehenden Ortsnamens;644 12.9.4;4. Appellativische Klosterbezeich
nung;645 12.9.5;5. Benennung nach dem Gründer;646 12.9.6;6. Benennung nach den Insassen;646 12.9.7;7. Namenübertragung;646 12.9.8;8. Religiöser Name;646 12.9.9;9. Literatur (in Auswahl);647 12.10;247. Burgnamen;647 12.10.1;1. Merkmale der Burgnamengebung;647 12.10.2;2. Überlieferung der Burgnamen;648 12.10.3;3. Entstehung der Burgnamen;648 12.10.4;4. Typologie der Burgnamen;649 12.10.5;5. Fortleben der Burgnamen;651 12.10.6;6. Literatur (in Auswahl);651 12.11;248. Gasthausnamen;652 12.11.1;1. Vorbemerkung;652 12.11.2;2. Geschichte der Gasthausnamen;652 12.11.3;3. Typologie und Geographie der Gasthausnamen;654 12.11.4;4. Zusammenfassung und Ausblick;656 12.11.5;5. Literatur (in Auswahl);656 12.12;249. Namen von Bildungseinrichtungen;657 12.12.1;1. Formale Aspekte;657 12.12.2;2. Onomastische Bestandteile;658 12.12.3;3. Prestige und Konnotationen;660 12.12.4;4. Historische und geographische Differenzierungen;661 12.12.5;5. Literatur (in Auswahl);662 12.13;250. Namen der Genossenschaften in der ehemaligen DDR;662 12.13.1;1. Namen der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG);662 12.13.2;2. Namen der Produktionsgenossenschaften des Handwerks (PGH);663 12.13.3;3. Literatur (in Auswahl);664 12.14;251. Gruben- und Zechennamen;664 12.14.1;1. Bestimmung des Gegenstandsbereichs;664 12.14.2;2. Entstehung und juristische Funktion;665 12.14.3;3. Benennungsmotive;665 12.14.4;4. Literatur (in Auswahl);666 13;XIX. Übergangsformen zwischen Eigennamen und Gattungsnamen;667 13.1;252. Übergangsformen zwischen Eigennamen und Gattungsnamen;667 13.1.1;1. Definitorische Probleme;667 13.1.2;2. Name und Appellativ;668 13.1.3;3. Farbbezeichnungen;668 13.1.4;4. Wochentags- und Monatsnamen;669 13.1.5;5. Pflanzennamen;669 13.1.6;6. Krankheitsnamen;670 13.1.7;7. Tiernamen;670 13.1.8;8. Gestirnnamen;671 13.1.9;9. Eigenname und pragmatischer Kontext;671 13.1.10;10. Literatur (in Auswahl);671 13.2;253. Nomenklaturen: Pflanzennamen;673 13.2.1;1. Sprachgebrauch und Funktion;673 13.2.2;2. D
ie binäre Nomenklatur;673 13.2.3;3. Die Namen der Gebrauchssprache;674 13.2.4;4. Literatur und Quellen (in Auswahl);676 13.3;254. Namen und Namengebung in der Astronomie;678 13.3.1;1. Planeten;678 13.3.2;2. Monde der Planeten;679 13.3.3;3. Auffällige Objekte auf den Monden des Sonnensystems (Krater und andere Unebenheiten);680 13.3.4;4. Kleinplaneten;683 13.3.5;5. Sternbilder;684 13.3.6;6. Sterne;686 13.3.7;7. Sternsysteme;688 13.3.8;8. Literatur (in Auswahl);688 13.4;255. Künstliche Nomenklaturen in der Wissenschaft und Technik: Chemie, Medizin, Pharmazie;688 13.4.1;1. Einführung und Begriffsbestimmung;688 13.4.2;2. Chemie;689 13.4.3;3. Medizin;691 13.4.4;4. Pharmazie;691 13.4.5;5. Bilanz;692 13.4.6;6. Literatur (in Auswahl);692 13.5;256. Warennamen;693 13.5.1;1. Warenname Produktname Ergonyme Chrematonyme;693 13.5.2;2. Beispiele und Typen;693 13.5.3;3. Gesellschaftliche Implikationen;695 13.5.4;4. Markenname: Garantie- und Gewährfunktion;697 13.5.5;5. Naming worldwide die Zukunftsperspektive;697 13.5.6;6. Literatur (in Auswahl);698 13.6;257. Namen und Namengebung in der Meteorologie;699 13.6.1;1. Vorbemerkung;699 13.6.2;2. Namen von tropischen Wirbelstürmen im pazifischen Bereich;700 13.6.3;3. Namen von Wirbelstürmen im atlantischen Bereich;700 13.6.4;4. Namen von Wirbelstürmen in anderen Bereichen;702 13.6.5;5. Namen von Tiefdruckwirbeln und Hochdruckgebieten (vergeben vom Berliner Wetterdienst);702 13.6.6;6. Literatur (in Auswahl);704 13.7;258. Windnamen;704 13.7.1;1. Vorbemerkung/Abkürzungen;704 13.7.2;2. Winde des Altertums;705 13.7.3;3. Großräumige und allgemeine Winde, Stürme;705 13.7.4;4. Windnamen in Europa;706 13.7.5;5. Windnamen in Nord- und Südamerika;707 13.7.6;6. Windnamen in Afrika und im Vorderen Orient;708 13.7.7;7. Windnamen in Asien;708 13.7.8;8. Windnamen in Australien und Neuseeland;709 13.7.9;9. Windnamen der Inselwelt;709 13.7.10;10. Literatur (in Auswahl);709 13.8;259. Namen von Wochentagen, Jahreszeiten, Festen und Jahrmärkten;710 13.8.1;1.
Namen der Wochentage;710 13.8.2;2. Namen von Jahreszeiten;712 13.8.3;3. Namen von Festen und Jahrmärkten;714 13.8.4;4. Literatur (in Auswahl);715 14;XX. Namen und Geschichte;716 14.1;260. Namen als historische Quelle;716 14.1.1;1. Forschungs- und Darstellungsbereiche der Geschichtswissenschaft, in denen Namen größere Bedeutung als Geschichtsquelle zukommt;716 14.1.2;2. Methodische Gesichtspunkte bei der Verwendung von Namen als Geschichtsquelle im Verbund mit anderen nichtsprachlichen Quellen (Interdisziplinäre Methodik der geschichtlichen Landeskunde);719 14.1.3;3. Namen als Datierungs- und Identifizierungshilfen;722 14.1.4;4. Literatur (in Auswahl);726 14.2;261. Die historischen Quellen für die Namenforschung: Namen in Königs- und Kaiserurkunden;735 14.2.1;1. Textsortentypik;735 14.2.2;2. Quellenspezifische Verfahren der Namenauswertung;736 14.2.3;3. Proprialer Schreibgebrauch der frühmittelalterlichen Reichskanzleien;737 14.2.4;4. Literatur (in Auswahl);741 14.3;262. Namen als (sprach-)archäologische Funde: Orts-, Berg-, Fluß- und andere Namen als Zeugen der frühesten Geschichte;743 14.3.1;1. Vorbemerkung;743 14.3.2;2. Mittelmeerraum;743 14.3.3;3. Kelten;744 14.3.4;4. Slawen;745 14.3.5;5. Literatur (in Auswahl);747 14.4;263. Ortsnamen und Siedlungsgeschichte: Skandinavien;747 14.4.1;1. Einführung;747 14.4.2;2. Das skandinavischeAltsiedlungsgebiet;748 14.4.3;3. Warägerfahrten und Kolonisationim Osten;752 14.4.4;4. Wikingerfahrten und Kolonisationim Westen;753 14.4.5;5. Schluß;755 14.4.6;6. Literatur (in Auswahl);755 14.5;264. Ortsnamen und Siedlungsgeschichte: Kontinentalgermania;757 14.5.1;1. Einführung;757 14.5.2;2. Lehnnamen, Lehntoponyme im Westen und Süden der Kontinentalgermania. Romania submersa;758 14.5.3;3. Slavia submersa, Slavia teutonica;761 14.5.4;4. Germanisch-deutsche Siedlungsnamentypologie und Siedlungschronologie;762 14.5.5;5. Zusammenfassung;762 14.5.6;6. Literatur (in Auswahl);763 14.6;265. Namen und Wüstungsforschung;764 14.6.1;1. Terminologi
e, Geschichte und Methoden der Wüstungsforschung;764 14.6.2;2. Onomastik und Wüstungsforschung;765 14.6.3;3. Literatur (in Auswahl);768 14.7;266. Personennamen und Personen- und Sozialgeschichte des Mittelalters;770 14.7.1;1. Methodische Probleme und Ziele der Personen- und Sozialgeschichte des Mittelalters;770 14.7.2;2. Sammlung vonPersonennamenzeugnissen für eineProsopographie des Mittelalters;771 14.7.3;3. Probleme der Identifizierung von Personen aufgrund der überlieferten Personennamen;771 14.7.4;4. Möglichkeiten der ethnischen Zuweisung von Personen aufgrund ihrer Namen(formen);771 14.7.5;5. Soziale Differenzierung der frühmittelalterlichen Personennamen;772 14.7.6;6. Gründe für das Aufkommen der Familiennamen;772 14.7.7;7. Literatur;772 14.8;267. Personennamen und die frühmittelalterliche Familie/Sippe/Dynastie;774 14.8.1;1. Vorbemerkungen;774 14.8.2;2. Personennamen als Familien-/Sippenkennzeichnung;774 14.8.3;3. Zur Gesetzmäßigkeit der Kennzeichnung von Familie/Sippe/Dynastie durch den frühmittelalterlichen Personennamen;775 14.8.4;4. Probleme der Forschung;775 14.8.5;5. Literatur (in Auswahl);775 15;XXI. Namen und Gesellschaft;777 15.1;268. Namen und soziale Identität. Namentraditionen in Familien und Sippen;777 15.1.1;1. Allgemeines;777 15.1.2;2. Patronymisierung;777 15.1.3;3. Adlige Namentradition;778 15.1.4;4. Bäuerliche und bürgerliche Namentradition;778 15.1.5;5. Namenlandschaft;780 15.1.6;6. Literatur (in Auswahl);781 15.2;269. Personennamen und soziale Schichtung;782 15.2.1;1. Gegenstandsbereich;782 15.2.2;2. Probleme sozialer Schichtung Schichtenmodelle;783 15.2.3;3. Anthroponyme;784 15.2.4;4. Literatur (in Auswahl);787 15.3;270. Namenprestige, Nameneinschätzung;789 15.3.1;1. Die Konzepte Prestige und Einstellung;789 15.3.2;2. Namen als soziale Tatsachen, Gegenstand von Einstellung und Prestige;790 15.3.3;3. Funktionen von Namen;791 15.3.4;4. Forschungsgeschichtlicher Abriß;791 15.3.5;5. Ergebnisse und Ausschau;793 15.3.6;6. Literatur (in Auswahl);
793 15.4;271. Personal Name Stereotypes;795 15.4.1;1. Introduction;795 15.4.2;2. Early Work on Name Images;795 15.4.3;3. General Research on Stereotypes;796 15.4.4;4. Key Areas of Stereotype Research;796 15.4.5;5. Conclusions;797 15.4.6;6. Selected Bibliography;797 15.5;272. Internal Names;798 15.5.1;1. Introduction;798 15.5.2;2. Magic and Sorcery;798 15.5.3;3. Nicknames and Naming Fashions;799 15.5.4;4. Public Nicknames;800 15.5.5;5. Other Cases;800 15.5.6;6. Selected Bibliography;801 15.6;273. Nicknames and Sobriquets;801 15.6.1;1. Introduction;801 15.6.2;2. Functions of Nicknames;802 15.6.3;3. Nicknames in the US;803 15.6.4;4. Nicknames in Other Countries;805 15.6.5;5. Publications;806 15.6.6;6. Selected Bibliography;807 15.7;274. Kosenamen;808 15.7.1;1. Einleitung;808 15.7.2;2. Familiäres Beispiel;808 15.7.3;3. Kinder und Jugendliche;808 15.7.4;4. Ursprung und Entwicklung;809 15.7.5;5. Bildungsweisen;809 15.7.6;6. Zusammenfassendes;811 15.7.7;7. Literatur (in Auswahl);811 16;XXII. Namenrecht, Namenpolitik;813 16.1;275. Namensrecht, Namenspolitik;813 16.1.1;1. Einleitung;813 16.1.2;2. Begriff und Wesen von Name und Namensrecht;815 16.1.3;3. Rechtsquellen des Namensrechts;820 16.1.4;4. Die Jurisprudenz der Referenz;821 16.1.5;5. Recht und Pflicht zur Namensführung;823 16.1.6;6. Namensänderungen;825 16.1.7;7. Rechtsschutz für Namen;826 16.1.8;8. Namenspolitik mit juristischen Mitteln;828 16.1.9;9. Literatur (in Auswahl);830 16.2;276. Rechtliche Regelung der Familiennamen/Pseudonyme, Künstler- und Aliasnamen;831 16.2.1;1. Einleitung;831 16.2.2;2. Ehename;831 16.2.3;3. Kindesname;834 16.2.4;4. Namensänderungen;836 16.2.5;5. Adels-, Künstler- und Ordensname;838 16.2.6;6. Literatur (in Auswahl);840 16.3;277. Amtliche Geltung und Schreibung von Orts- und Flurnamen;841 16.3.1;1. Amtliche Ortsnamengebung und -änderung;841 16.3.2;2. Amtlicher Flurnamengebrauch;843 16.3.3;3. Literatur (in Auswahl);844 16.4;278. Warennamen-, Firmennamenrecht;846 16.4.1;1. Firmen- und Warenna
men: Begriffe, Status;846 16.4.2;2. Firmennamen: Grundsätze und Bildung;848 16.4.3;3. Firmenname Firmenphilosophie Unternehmenskultur;850 16.4.4;4. Warenzeichenrecht;850 16.4.5;5. Literatur (in Auswahl);852 16.5;279. Namenpolitik in mehrsprachigen Ländern und Staaten;853 16.5.1;1. Sprachminderheit einst und jetzt;853 16.5.2;2. Namenpolitik aufmenschenrechtlicher Basis;854 16.5.3;3. Das Schweizer Modell;855 16.5.4;4. Nationalstaatliche Namenpolitik;861 16.5.5;5. Vereinigte Staaten und Kanada;864 16.5.6;6. Literatur (in Auswahl);865 16.6;280. Nationale und internationale Namenstandardisierung;865 16.6.1;1. Aufgaben und gegenseitige Abgrenzung von nationaler und internationaler Namenstandardisierung;865 16.6.2;2. Nationale Standardisierung geographischer Namen;866 16.6.3;3. Internationale Standardisierung geographischer Namen;871 16.6.4;4. Umschriftung geographischer Namen;872 16.6.5;5. Literatur (in Auswahl);873 17;XXIII. Namen und Religion;875 17.1;281. Namenforschung und Religionsgeschichte;875 17.1.1;1. Grundsätzliches;875 17.1.2;2. Hochreligionen und Namenforschung;875 17.1.3;3. Namen in der Volksetymologie und sprachliche Überschichtung;875 17.1.4;4. Namen im Geisterglauben und bei Religionsmischungen;876 17.1.5;5. Religion: Begriff und Ausdruck;877 17.1.6;6. Namen und wirkmächtige Sachen;877 17.1.7;7. Literatur (in Auswahl);877 17.2;282. Namen von Göttern im klassischen Altertum;878 17.2.1;1. Quellen, Termini;878 17.2.2;2. Forschungsgeschichte;879 17.2.3;3. Funktionen;880 17.2.4;4. Götternamen und Appellativa;886 17.2.5;5. Götternamen und Personennamen;887 17.2.6;6. Götternamen und Epiklesen;889 17.2.7;7. Das Nachleben der paganen Götternamen;890 17.2.8;8. Literatur (in Auswahl);890 17.3;283. Götternamen der Germanen;893 17.3.1;1. Die Römerzeit;893 17.3.2;2. Der germanische Süden von der Völkerwanderung bis zur Christianisierung;895 17.3.3;3. Skandinavien von der Wikingerzeit bis zur Christianisierung;896 17.3.4;4. Literatur (in Auswahl);899 17.4;284. Namen Gott
es und der Engel;901 17.4.1;1. Gottesbezeichnungen;901 17.4.2;2. Namen der Engel;902 17.4.3;3. Literatur (in Auswahl);907 17.5;285. Biblische Namen;907 17.5.1;1. Bestand;907 17.5.2;2. Ortsnamen;908 17.5.3;3. Personennamen;908 17.5.4;4. Literatur (in Auswahl);910 17.6;286. Namen christlicher Heiliger;911 17.6.1;1. Vorbemerkung;911 17.6.2;2. Namen christlicher Heiliger;911 17.6.3;3. Literatur (in Auswahl);914 17.7;287. Name Giving in Papua New Guinea. A Case Study;915 17.7.1;1. Proper Names as Ethnographic Data;915 17.7.2;2. The Present: The Song to the alasava Tree;916 17.7.3;3. The Past: The Mythological Background;917 17.7.4;4. Names Make Persons;920 17.7.5;5. Selected Bibliography;921 17.8;288. Namenmagie und Aberglaube, Namenmystik, Namenspott und Volksglaube;921 17.8.1;1. Magietheorie;921 17.8.2;2. Namenspott und Volksglaube;926 17.8.3;3. Literatur (in Auswahl);928 17.9;289. Names and Their Study;931 17.9.1;1. The Presence of Names;931 17.9.2;2. Linguistic and Cultural Variation;931 17.9.3;3. Invariant Factors and Various Cultural Idiosyncrasies;932 17.9.4;4. Examples of Various Situations;933 17.9.5;5. The Main Dimensions of Linguistic Variation and Their Terminology;939 17.9.6;6. The Purposes of Onomatology;945 17.9.7;7. Selected Bibliography;945