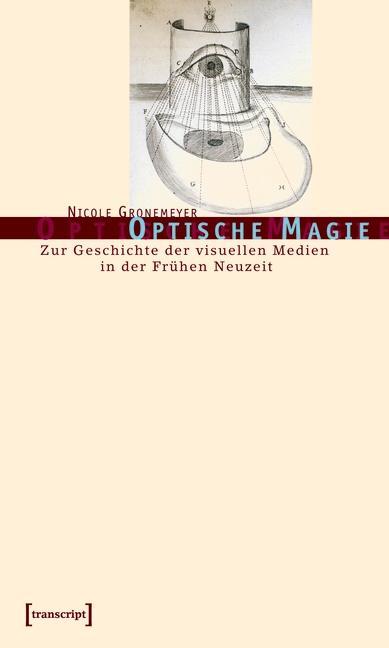
Sofort lieferbar (Download)
'Optische Magie' ist der Titel einer Reihe von Publikationen, die im 17. Jahrhundert von jesuitischen Gelehrten verfasst wurden, um das Gebiet der Optik mittels kunstfertiger Inszenierungen darzustellen. Durch neuartige Medien wie der Laterna magica oder der Anamorphose wurden Illusionen erzeugt, mit denen ein Publikum unterhalten und gebildet werden sollte. Dieser besondere Umgang mit visuellen Techniken durch Autoren wie Schott und Kircher wird in der vorliegenden Studie in medien- und kulturgeschichtlicher Hinsicht untersucht und als Teil einer barocken Kultur des Scheins bestimmt, die sich zwischen Repräsentation, Manipulation und Schaulust bewegt hat.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Januar 2004
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
242
Dateigröße
87,32 MB
Reihe
Kultur- und Medientheorie
Autor/Autorin
Nicole Gronemeyer
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783839402405
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»In het uiterst boeiende en nieuwe Duitstalige boek 'Optische Magie' wordt onder andere een leerzame terugblik gegeven op het onstaan van meerdere visuele beeld- en projectietechnieken [. . .]. De inhoud van het boek en de wijze waarop de auteur de vele onderwerpen bespreekt maken dit studieboek prima geschikt voor gebruik in opleidingen kunstgeschiedenis en multimedia aan hogescholen en universiteiten. Ook de liefhebbers van de ontwikkelingen in de beeldtechnieken vinden in dit boek een bron van inspiratie en kennis. « Optische Fenomenen The Dutch newsletter for Perception, Art & Holography, Nieuwsbrief, 212/2 (2005)
Besprochen in:www. kino-zeit. de, 10. 12. 2004, Stefan OttoOptische Fenomenen, 212/2 (2005)IASLonline, 3 (2005), Stephan Kampe
»Eine begrüßenswerte methodische Standortbestimmung, die eine auf bloße Kontinuität bedachte mediengeschichtliche Forschung kritisch erweitert. « Erna Fiorentini, sehepunkte, 5/3 (2005)
»[Die] Lektüre [ist] mit großem (Lese-)Vergnügen und viel Erkenntnisgewinn verbunden. « Joachim Paech, MEDIENwissenschaft, 1 (2005)
»Die Arbeit [bietet] aber ein diskutables medienhistorisches Modell, das eine von unzähligen möglichen Schneisen durch ein facettenreiches Gebiet schlägt. Wenn Werner Faulstich den virulenten Dilettantismusvorwurf beklagt, dem sich der Versuch einer Medienkulturwissenschaft häufig zu stellen habe, dann vermeidet Gronemeyer solche Anfechtungen auf zweierlei Weise: Erstens durch die Basisarbeit an Quellen, die sie zum Teil in umfassenden Zitaten dankenswerterweise erst zugänglich macht, und zweitens durch den Rückgriff auf kanonisch gewordene Werke und Thesen der Forschung, eine Strategie, die dann zu Lasten einer innovativeren Auseinandersetzung mit den Forschungsthesen geht. So erhält man letztlich einen modellhaft zugeschnittenen, dadurch aber griffigen, luziden und diskutablen Zugang zur optischen Magie, der deren kulturgeschichtlich bedeutsame Problemstruktur und ihre Relevanz für die Wissensformation der Frühen Neuzeit vermitteln kann. « Stephan Kampe, IASLonline, 3 (2005)
»Die Autorin benennt die Verfasser, Themen und Quellen der künstlichen und der optischen Magie und beschreibt sie als populäre und anwendungsbezogene Formen der Naturforschung. Kenntnisreich legt sie die wissensgeschichtlichen Hintergründe dar, vor denen sich die optische Illusionierung herausbilden konnte. Sie erläutert anschaulich den medien- und kulturgeschichtlichen Kontext des 17. Jahrhunderts und das Nachleben der künstlichen Magie in der Romantik, die das barocke Erbe antrat, aber auch auf künftige Bilderwelten verwies. Die Texte zur optischen Magie von Giambattista della Porta, Mario Bettini, Athanasius Kircher, Gaspar Schott und anderen überwiegend jesuitischen Autoren entzogen sich bislang noch den literatur- oder naturwissenschaftlichen Disziplinen und waren kaum bekannt. Ein großes Verdienst des Buches von Nicole Gronemeyer ist es, sie der Forschung zu erschließen und sie in die Geschichte der visuellen Medien einzuordnen. « Stefan Otto, www. kino-zeit. de, 10. 12. 2004
Besprochen in:www. kino-zeit. de, 10. 12. 2004, Stefan OttoOptische Fenomenen, 212/2 (2005)IASLonline, 3 (2005), Stephan Kampe
»Eine begrüßenswerte methodische Standortbestimmung, die eine auf bloße Kontinuität bedachte mediengeschichtliche Forschung kritisch erweitert. « Erna Fiorentini, sehepunkte, 5/3 (2005)
»[Die] Lektüre [ist] mit großem (Lese-)Vergnügen und viel Erkenntnisgewinn verbunden. « Joachim Paech, MEDIENwissenschaft, 1 (2005)
»Die Arbeit [bietet] aber ein diskutables medienhistorisches Modell, das eine von unzähligen möglichen Schneisen durch ein facettenreiches Gebiet schlägt. Wenn Werner Faulstich den virulenten Dilettantismusvorwurf beklagt, dem sich der Versuch einer Medienkulturwissenschaft häufig zu stellen habe, dann vermeidet Gronemeyer solche Anfechtungen auf zweierlei Weise: Erstens durch die Basisarbeit an Quellen, die sie zum Teil in umfassenden Zitaten dankenswerterweise erst zugänglich macht, und zweitens durch den Rückgriff auf kanonisch gewordene Werke und Thesen der Forschung, eine Strategie, die dann zu Lasten einer innovativeren Auseinandersetzung mit den Forschungsthesen geht. So erhält man letztlich einen modellhaft zugeschnittenen, dadurch aber griffigen, luziden und diskutablen Zugang zur optischen Magie, der deren kulturgeschichtlich bedeutsame Problemstruktur und ihre Relevanz für die Wissensformation der Frühen Neuzeit vermitteln kann. « Stephan Kampe, IASLonline, 3 (2005)
»Die Autorin benennt die Verfasser, Themen und Quellen der künstlichen und der optischen Magie und beschreibt sie als populäre und anwendungsbezogene Formen der Naturforschung. Kenntnisreich legt sie die wissensgeschichtlichen Hintergründe dar, vor denen sich die optische Illusionierung herausbilden konnte. Sie erläutert anschaulich den medien- und kulturgeschichtlichen Kontext des 17. Jahrhunderts und das Nachleben der künstlichen Magie in der Romantik, die das barocke Erbe antrat, aber auch auf künftige Bilderwelten verwies. Die Texte zur optischen Magie von Giambattista della Porta, Mario Bettini, Athanasius Kircher, Gaspar Schott und anderen überwiegend jesuitischen Autoren entzogen sich bislang noch den literatur- oder naturwissenschaftlichen Disziplinen und waren kaum bekannt. Ein großes Verdienst des Buches von Nicole Gronemeyer ist es, sie der Forschung zu erschließen und sie in die Geschichte der visuellen Medien einzuordnen. « Stefan Otto, www. kino-zeit. de, 10. 12. 2004
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Optische Magie" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.

































