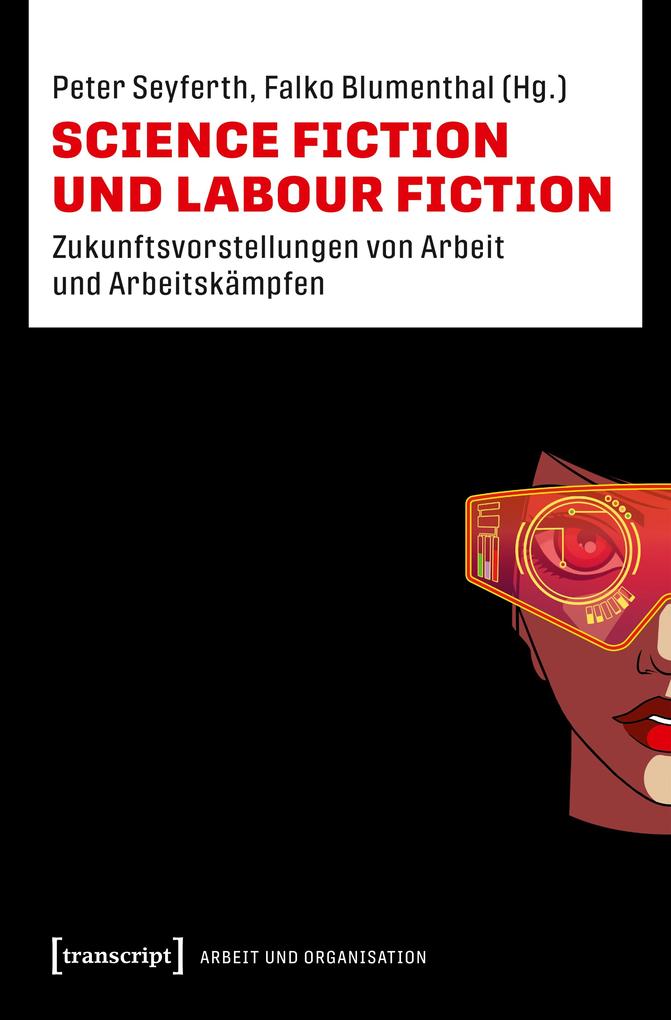Besprechung vom 10.05.2025
Besprechung vom 10.05.2025
Weltgeschichte als Vorarbeit
Je besser die historischen Bücher zu einem Gegenstand werden, für desto erledigter wird dieser Gegenstand gehalten. Derzeit erwischt das die Menschheitsgeißel "Arbeit". Der Informatiker und Wirtschaftswissenschaftler Paul Cockshott etwa schaut sich die gewesene Mühsal in "Was die Welt am Laufen hält - Die Geschichte menschlicher Arbeit vom Beginn bis heute" (Mangroven Verlag, Berlin 2024, 430 S., br., 36,- Euro) an, um gewisse Vorschläge für die künftige Arbeitsorganisation zu plausibilisieren. Das Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit (IGZA) wiederum untersucht dieselbe Sache in sieben Bänden als "Matrix der Arbeit" (J. H. W. Dietz Nachf., Bonn 2023, 2388 S., br., 245,- Euro), unterscheidet die im vierten dieser Bände diskutierte "Zukunft der Arbeit" aber methodisch von etwas, das der fünfte und sechste Band "große Trends" nennt. Diese Unterscheidung wäre für Cockshott nicht ergiebig, denn ihm geht es ganz wesentlich um eine möglichst enge erzählende Anbindung des Richtigen, Erwartbaren und über solidarische Aktion Herstellbaren ans falsche Vergangene und Vorhandene.
Diese Präferenz war bei diesem Mann, der zusammen mit Allin Cottrell die in computerinteressiert sozialistischen Kreisen maßstabsetzende Abhandlung "Alternativen aus dem Rechner. Für sozialistische Planung und direkte Demokratie" geschrieben hat (die jüngste deutsche Ausgabe gibt es beim PapyRossa Verlag, Köln 2022, 267 S., br., 22,- Euro) wohl zu erwarten. Aber anders als in jener inzwischen recht bekannten älteren Abhandlung hat er in "Was die Welt am Laufen hält" anregenderweise keine Scheu davor, Geschichtliches und Wertungen über dezidiert Rhetorisches kurzzuschließen. Das Kapitel über die Prostitution argumentiert vom Befund des Ursprungs der Bordellwirtschaft im Sklavenhandel her, erinnert dabei explizit an eine alte bürgerliche ökonomische Theorie von gewissen "unproduktiven Dienstleistungen, die im Moment ihrer Ausführung verschwinden", und greift beherzt zu einer Zwischenüberschrift, die keinerlei wissenschaftliche Neutralität vortäuscht: "Laster". Cockshotts animierte Schreibart wird ihn viel Arbeit gekostet haben; die Übersetzung von Helmut Dunkhase bleibt dem treu, und im Kontrast dazu wirken die sieben massiven Blöcke des IGZA, als wäre die da sicher ebenso intensive Arbeit, allerdings eher eine der Datenorganisation, auf so viele Schultern verteilt worden, wie man braucht, um einen sehr guten Sozialismus zu errichten. Was aber ist überhaupt mit dem Gegenstand, "die menschliche Arbeit", passiert, dass er sich neuerdings so historisch anfühlt wie die referierenden Teile der genannten Bücher?
Zwei weitere Bücher wissen es, ein eher gegenwärtiges und ein mehr zukünftiges. Heike Geißlers Essay "Arbeiten" (Hanser Berlin, Berlin 2025, 128 S., geb., 20,- Euro) hat dabei mit dem Sammelband "Science Fiction und Labour Fiction - Zukunftsvorstellungen von Arbeit und Arbeitskämpfen" (Transcript Verlag, Bielefeld 2025, 250 S., br., 49,-Euro), herausgegeben von Peter Seyferth und Falko Blumenthal, die Erkenntnis gemeinsam, dass es "Arbeit" als gesellschaftliches Phänomen nicht ohne Kämpfe um sie gibt. Die Zeitkritik der Schriftstellerin Geißler zeigt, wie sich eine Situation von innen anfühlt, in der die verbliebenen einschlägigen Kämpfe zu sehr zähen Stellungskriegen geworden sind, bei klarer Dominanz derjenigen Kräfte, die anderer Leute Arbeit aneignen. Die von dem Ideengeschichtler sowie politischen Theoretiker Seyferth und dem Gewerkschaftspraktiker Blumenthal versammelten Stimmen wiederum befassen sich damit, wie man da wieder rauskommen könnte.
In Seyferths und Blumenthals Sammlung steht das prognostische Vermögen spekulativer Phantastik anders als in viel zu vielen oberflächlichen Untersuchungen nicht unvermittelt als eine Art Rohstoff da, den man mit etwas akademischem Geschick zu politikfähigen futurologischen Szenarien veredeln kann und soll, sondern wird als etwas auf aktive (und aktivistische) Weise Produktives verstanden. So gerät Filmanalyse ins Gespräch mit Klassenkampf-Standortbestimmungen; Eigentumsformen und Lohnarbeit zeigen sich im Kunstlicht populärer Medien als etwas, das man gründlich durchleuchten (und dabei faszinierende Pathologien ausmachen) kann - vor allem aber wagt der Band die direkte Konfrontation des eigenen analytischen Anspruchs mit der Produktivkraft von Science-Fiction-Schreibverfahren; zu den Essays gesellt sich hier nämlich eine Erzählung namens "Hand, Herz und Hose" der Autorin Theresa Hannig. Hier erproben Sätze wie "Ihre Hände waren auch die einzigen Körperteile, die sie versichert hatte", den Wirkungsgrad der Genremaschine unmittelbar an einem hochorganisierten Werkstück. Zu lernen ist daran: Der modische Schein des Historischen trügt. In Wirklichkeit ist "die Arbeit" nach wie vor etwas, das uns erst bevorsteht. DIETMAR DATH
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.