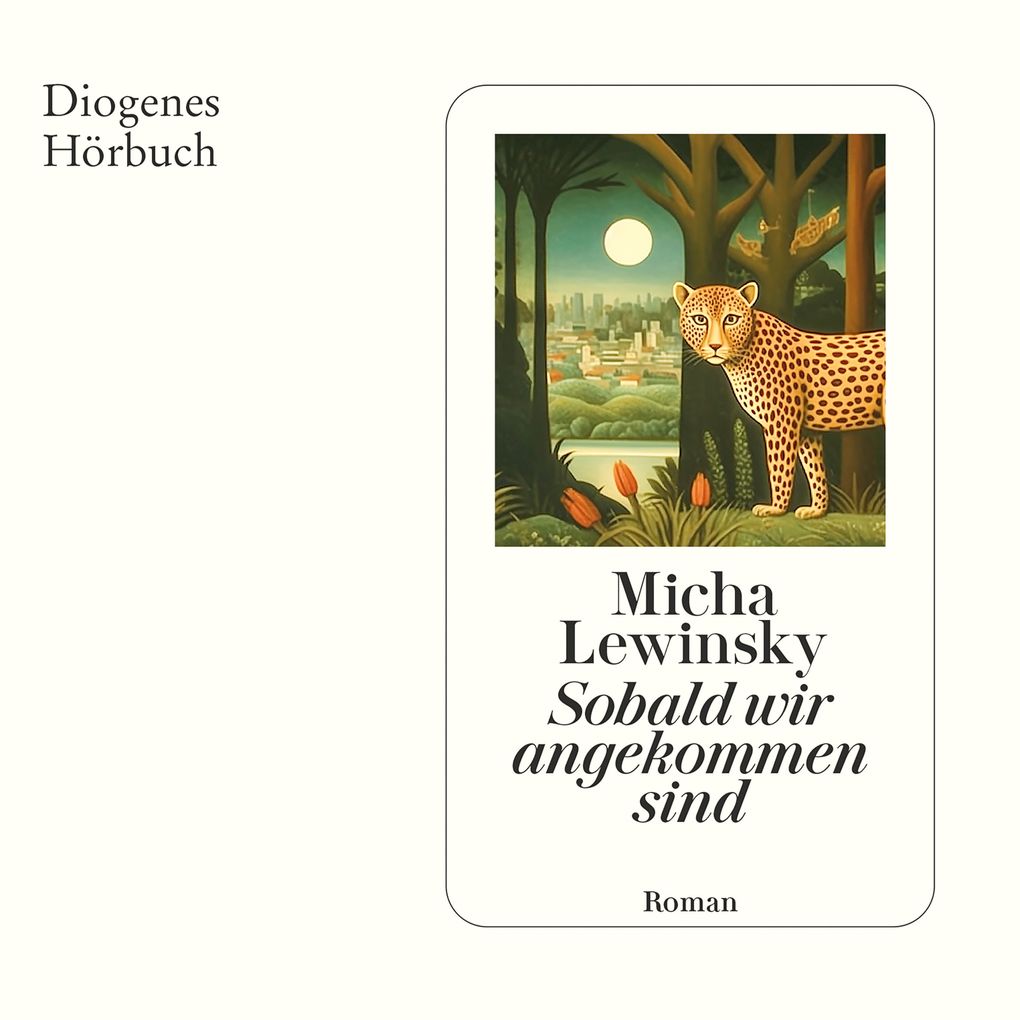
Sofort lieferbar (Download)
Ben Oppenheim balanciert zwischen Ex-Frau, zwei Kindern und seiner Liebe zu Julia. Er hat Rückenschmerzen und Geldsorgen, aber was ihn wirklich ängstigt, ist der Krieg in Osteuropa. Getrieben vom jüdischen Fluchtinstinkt steigt er eines Morgens kurzerhand in ein Flugzeug nach Brasilien. Mitsamt Ex-Frau und Kindern, aber ohne Julia. Im Krisenmodus läuft Ben zur Hochform auf. Nur der Atomkrieg lässt auf sich warten. Ben dämmert, dass er sich ändern muss, wenn sich etwas ändern soll.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
24. Juli 2024
Sprache
deutsch
Ausgabe
Ungekürzt
Dateigröße
301,11 MB
Laufzeit
401 Minuten
Autor/Autorin
Micha Lewinsky
Sprecher/Sprecherin
Michael Maertens
Verlag/Hersteller
Produktart
MP3 format
Dateiformat
MP3
Audioinhalt
Hörbuch
GTIN
9783257695847
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 07.01.2025
Besprechung vom 07.01.2025
Auf der Flucht mit der Ex-Frau
Für ihn führt jeder Weg zur Atombombe: Micha Lewinskys Romandebüt "Sobald wir angekommen sind" lässt es krachen.
Nicht jeder Roman hat ein motiviertes Innenleben. Manche mäandern handlungsarm vor sich hin oder entwickeln die Handlung erst im Laufe des Mäanderns. Andere stellen gleich zu Beginn eine Frage, und diese wird dann im Verlauf weniger oder vieler Kapitel erörtert. Manchmal wird in einem Roman auch ein Rätsel gelöst, eine Antwort gefunden oder eine Identität geklärt. In dem krachenden Debüt des Schweizers Micha Lewinsky sind es zwei Sätze, die anzeigen: Hier wird nicht gewandelt, sondern gehandelt!
"Benjamin Oppenheim dachte, er sei bereit für die Flucht." Zwei Seiten weiter wird präzisiert: "Wohin gehen wir eigentlich mit den Kindern, falls es passiert?" Und schon der Titel "Sobald wir angekommen sind" verheißt spannende Ortswechsel in seelischen Extremlagen. Der jüdische Romanheld jedenfalls ist schon vor seiner Flucht ein Getriebener. Auf ihm lastet ein Generationentrauma. Jean Améry fand dafür den passenden Ausdruck vom "jüdischen Katastrophengeschick". Privat läuft es für Ben Oppenheim auch nicht besonders. Er und Marina wollen sich scheiden lassen, die Auftragslage lässt zu wünschen übrig, und Ben leidet unter Vertreibungsangst. Jetzt, wo wieder Krieg in Europa tobt, wird ihm die Sache im Reduit zu heiß. "Wenn man wie er in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts zur Welt gekommen und mit einem ängstlichen Grundtemperament ausgestattet war, führten alle Wege zur Atombombe."
Gemeint ist vermutlich der Krieg in der Ukraine, der sich im Roman in einen "Krieg in Osteuropa" weiterentwickelt hat und den Helden dieser Fluchtgeschichte, zusammen mit seiner Ex-Familie, ins brasilianische Exil treibt. Ausgerechnet von der sicheren Alpenscholle will der erfolglose Autor einer Stefan-Zweig-Fernsehserie die Zeichen der Zeit früh erkennen und einmal im Leben entschlossen handeln. Denn was wäre die Alternative? "Strahlenkranke Schweizer, die sich in wertlos gewordenen Prada-Mänteln an notdürftigen Feuerchen wärmten. Absperrbänder der Polizei, die vergessen im Wind flatterten. Und darüber das ständige Knistern und Knacken der Geigerzähler."
Stefan Zweig hatte Europa schon nach den ersten Schikanen 1934 verlassen und war dann 1940 über London nach Südamerika gereist, wo er sich schließlich zwei Jahre später mit seiner zweiten Frau Lotte das Leben nahm. Die Latte für eine politische Flucht im Windschatten des literarischen Idols liegt also hoch: "Während Zweig mit seiner Sekretärin hatte durchbrennen können, als die Welt in Flammen stand, schien Bens Angst vor dem Weltkrieg nur eine Marotte des jüdischen Neurotikers zu sein."
Eine Marotte allerdings, wir kennen das von Woody Allen, mit Unterhaltungswert. Gemeinsam beschließen die Scheidungsparteien nämlich, ihr Trennungsprojekt auf Eis zu legen und die Mischpoke in Sicherheit zu bringen. So eine Flucht ist nichts für Individualisten. Und wer weiß, vielleicht fällt ja noch ein bisschen Romantik dabei ab. Im Züricher Alltag war sie unter die Räder gekommen. Dass Ben schon längst eine neue Freundin hat - eine Künstlerin aus einer seit Generationen in der Schweiz ansässigen, nichtjüdischen, sich also keiner Gefahr bewussten Familie -, ist kein Grund, die Flucht mit der Ex anzuzweifeln.
Am Ende geht alles erstaunlich schnell. Flüge werden gebucht, Taschen gepackt, die Kinder aus der Schule geholt und zack: Schon ist man in Brasilien. Stefan Zweig hatte sich seinerzeit "fasziniert und gleichzeitig erschüttert" gezeigt bei seiner Ankunft in Rio. Er hatte von den Farben, Formen und Bewegungen geschwärmt. "Das erregte Auge wurde nicht müde zu schauen, und wohin es blickte, war es beglückt", schrieb er. "Ben schaute auch", heißt es im Roman, "sah aber wenig." Oder eben das Falsche: Autobahnen, die Wellblechdächer und in Tümpeln treibenden Müll.
Auch die Menschen entsprechen nicht den Erwartungen des frischgebackenen Exilanten: "Ben hatte sich die Südamerikaner immer dunkler vorgestellt. Gut gelaunt. Und im Grunde tanzend." Noch eine andere Sache trennt das Zweig-Groupie von seinem Vorbild: Stefan Zweig war ein literarischer Weltstar, und Brasilien empfing ihn mit offenen Armen. Seine Bücher waren da in Deutschland schon vor Jahren verbrannt worden. "Bens Bücher", lesen wir bei Micha Lewinsky, "wurden nur eingestampft."
Alle Episoden dieses aberwitzigen Roadtrips von Zürich nach Recife - von einem Ayahuasca-Experiment zusammen mit Hippies auf der Suche nach dem "Egotod" bis hin zu einer Stellvertreterschlägerei mit einem deutschen Hünen, der Ben den Hotelsessel streitig macht - sind eingetaucht in jüdische Argumentationskunst und jüdische Selbstvergackeierung. Dabei werden sämtliche antisemitischen Klischees über Juden, vor allem über männliche Juden, burlesk übertrieben, aber auch noch einmal identitätsstiftend ernst genommen. Vom geilen Juden über den wehleidigen Juden bis hin zum feigen Juden. Als Ben der Prügelei mit dem verdutzten Deutschen nur mit knapper Not entgeht ("Mein Großvater war in Theresienstadt"), ruft sein Sohn: "Er hat dich beinahe getötet." Und der Dialog setzt sich folgerichtig fort: "'Aber er hat es nicht getan', sagte Ben. 'Und wisst ihr, warum?' 'Mitleid', schlug Rosa vor. 'Vielleicht hat er sich geschämt, einem Schwächeren wehzutun', erwog Moritz. 'Nein', sagte Ben. Das war eine Lektion fürs Leben: 'Er hat aufgehört, weil ich mich gewehrt habe.'"
Am Ende läuft es für den zwischen Selbst- und Fremdbildern festsitzenden Drehbuchautor ohne Drehbuch fürs eigene Leben auf Selbstermächtigung hinaus. Behauptet er zumindest. Denn dieses Buch wirkt vor den aktuellen politischen Realitäten zwischen Gaza und Pokrowsk zwar nicht mehr ganz so aus der Luft gegriffen wie eine Großstadtneurotikerkomödie aus Amerika, ist aber dann doch vor allem ein Buch über einen Kunst schaffenden Mann in der Krise. Und das ist bekanntlich ein Thema von ebenso universeller wie unerschöpflicher Komik. KATHARINA TEUTSCH
Micha Lewinsky: "Sobald wir angekommen sind". Roman.
Diogenes Verlag, Zürich 2024. 277 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Sobald wir angekommen sind" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









