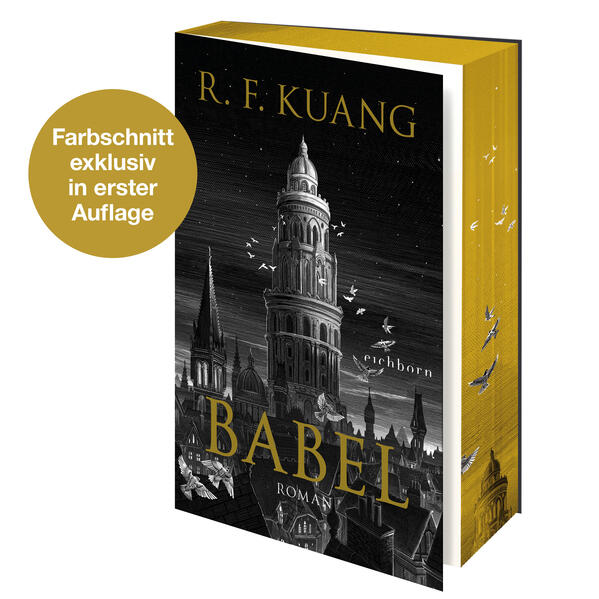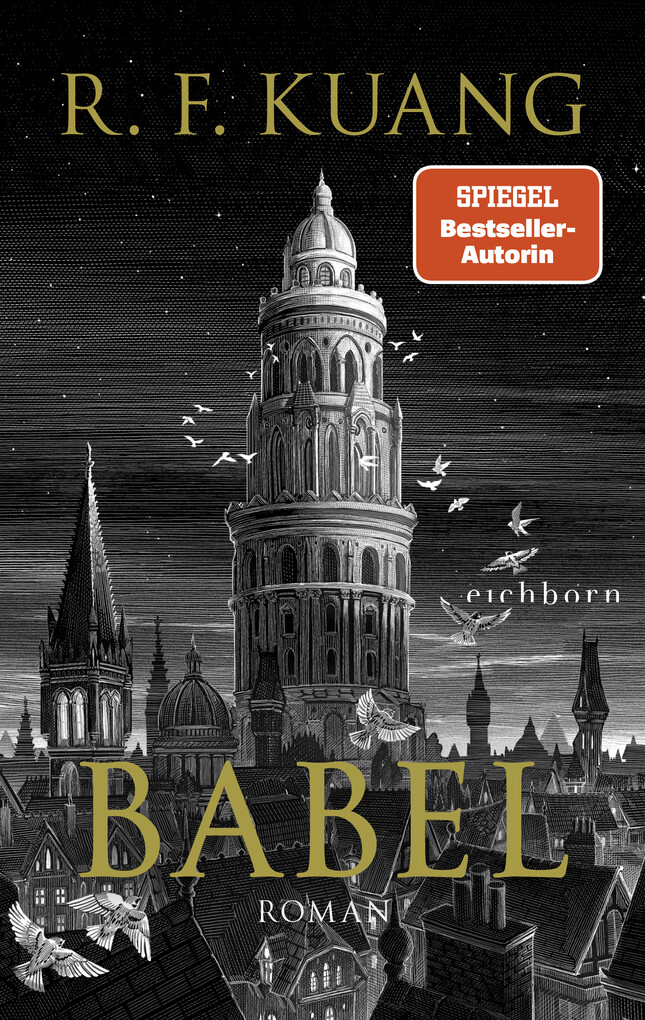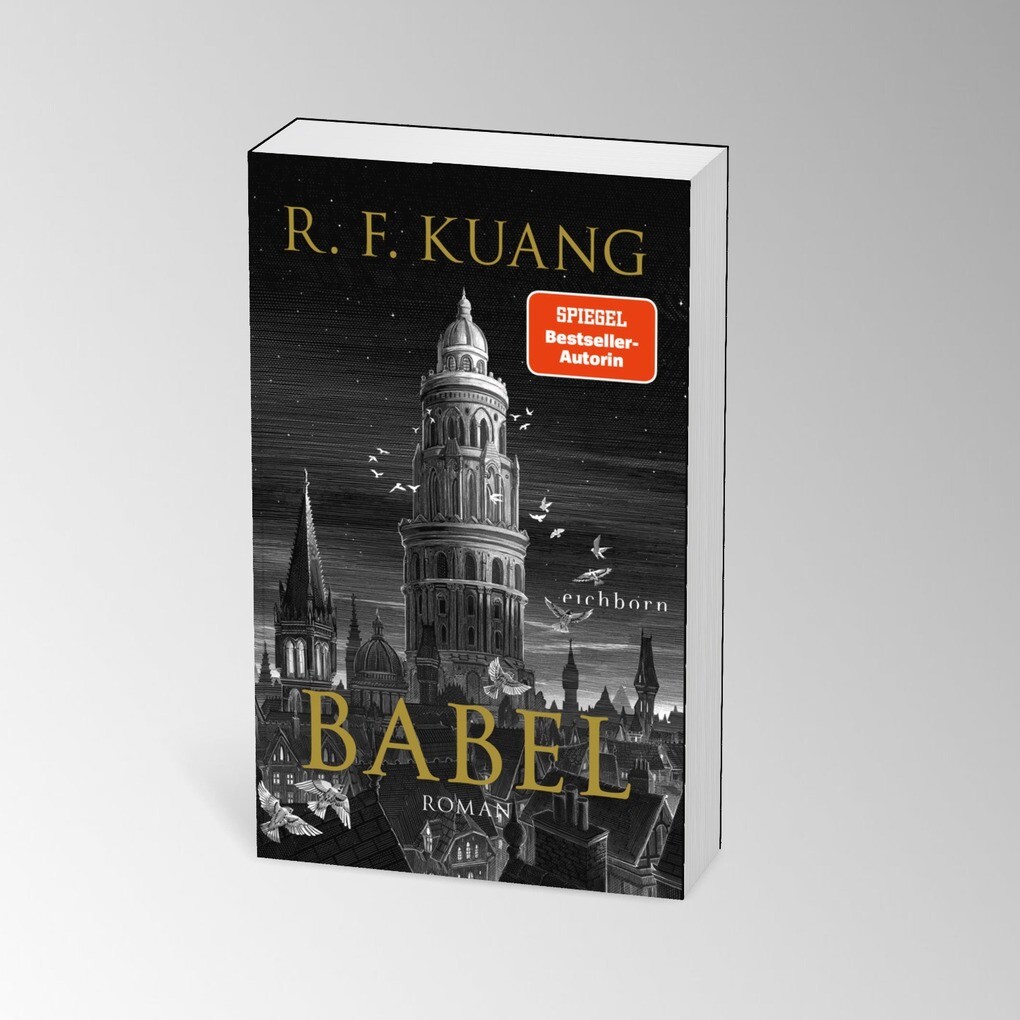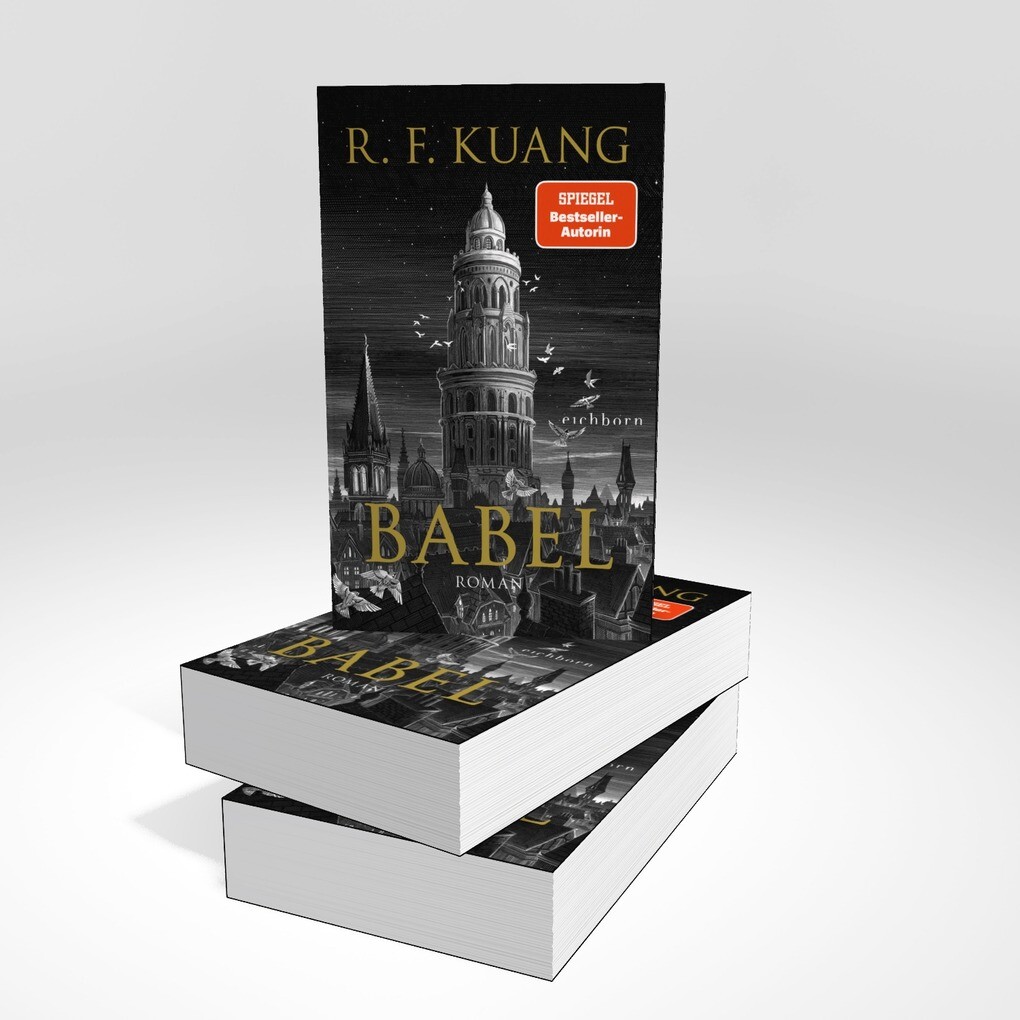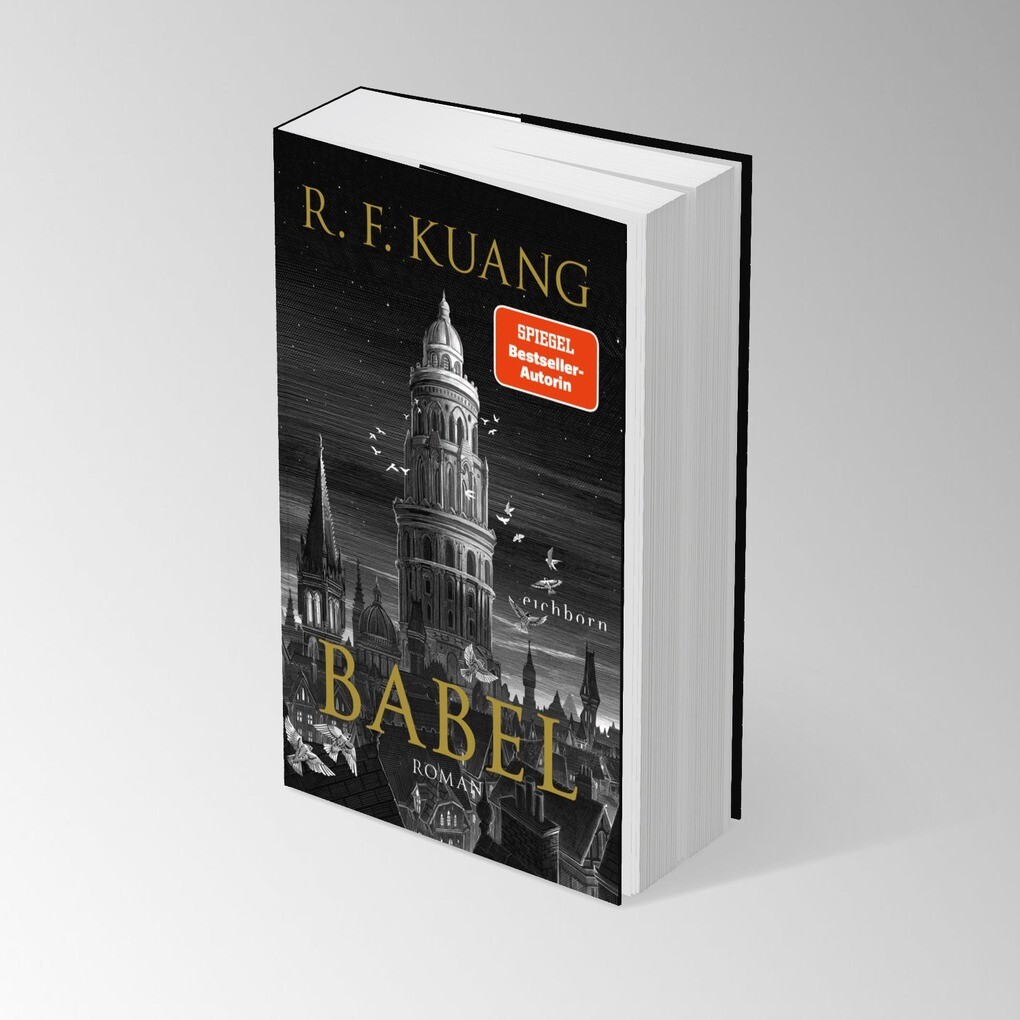»BABEL hat zu Recht enormes Lob erhalten. Einfallsreich, fesselnd, eindringlich. « THE NEW YORK TIMES»Auf faszinierende Weise geht es in dem Roman auch darum, wie Übersetzungen eine Brücke zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen schlagen, indem sie sie zwangsläufig verfremden . Eine reiche, packende Geschichte, die es in sich hat. « THE GUARDIAN»Ein mitreißender Roman, der historische Fantasy und Dark Academia miteinander verbindet . . . Wenn, wie BABEL andeutet, Worte einen Zauber enthalten, dann hat Kuang etwas wahrhaft Magisches geschrieben. « OPRAH DAILY»Ein brillantes, messerscharfes Buch, das nicht nur fantastisch erzählt ist, sondern auch die Kolonialgeschichte und die industrielle Revolution aufgreift, auf den Kopf stellt und kräftig durchschüttelt. «Shannon Chakraborty, Bestsellerautorin von DIE STADT AUS MESSING»Ambitioniert und beeindruckend; und gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Sprache und die Literatur. Dark Academia wie sie sein sollte. «KIRKUS REVIEWS