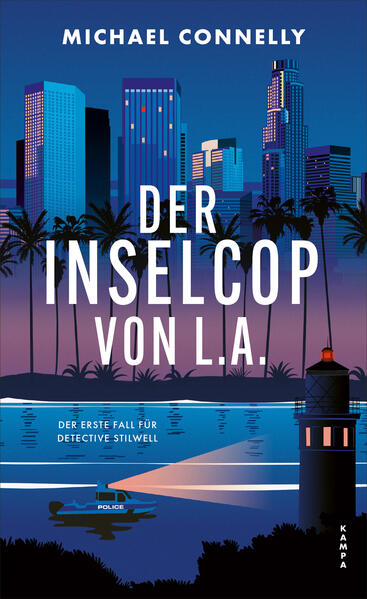Besprechung vom 06.10.2025
Besprechung vom 06.10.2025
Als gäbe es Vergebung
Krimis in Kürze: Travacio, Charyn und Connelly
Der deutsche Titel trifft es nicht schlecht, aber im Original klingt die Stimmung des Romans noch stärker nach: "Ein Mann namens Loprete" (Pendragon, 120 S., geb., 22,- Euro) heißt in der spanischen Ausgabe "Como si existiese el perdón", was sich übersetzen lässt mit "Als gäbe es Vergebung". Die Argentinierin Mariana Travacio erzählt die Geschichte einer Rache. Zeit und Ort bleiben unbestimmt, die Namen sind spanisch, es gibt weder Telefon noch Autos, nur einen Hinweis auf Traktoren, es ist eine archaische, fast mythische Landschaft. So wie das Geschehen eher einer Parabel gleicht als einer realistischen Erzählung.
Dieser Loprete kommt in ein Dorf, in die Kneipe, am nächsten Tag ist er tot, er hat eine mächtige Familie, sie wird das nicht hinnehmen, die Dorfbewohner werden sich wehren. Die Lopretes haben die Eltern des jungen Manoel, des Ich-Erzählers, umgebracht. Eine Ordnungsmacht gibt es nicht in dieser Welt. Mariana Travacio schreibt eine wunderbar schlanke, lakonische Prosa. Die Gewalt, die sich in der Geschichte entlädt, wird benannt, aber nicht zelebriert. Wer Italo-Western kennt, hat das Setting vor Augen. So kann vieles ungesagt bleiben und damit viel intensiver wirken in den Köpfen der Leser. Und als Motto dieses literarisch geglückten Kriminalromans, der seine Ambition nicht kunstvoll verschnörkeln muss, steht ein Zitat von Derrida: "Ein Phantom stirbt niemals, sein Kommen und Wiederkommen ist das, was immer (noch) aussteht."
Was für ein grandioser Erzähler Jerome Charyn ist, dürfte sich herumgesprochen haben. Der Mann aus der Bronx hat den Cop Isaac Sidel erfunden, der es im Verlauf von zehn Bänden (alle bei Diaphanes erschienen) zum Bürgermeister und Präsidenten brachte. Jetzt, in "Ravage & Son" (Suhrkamp, 335 S., br., 18,- Euro), führt Charyn uns in Manhattans Lower Eastside des frühen 20. Jahrhunderts, ins jüdische Ghetto, unter Gangster und Geschäftsleute, arme Leute, Rabbis und verkrachte Existenzen. Es herrschen leicht anarchische Zustände, es ist ein wilder, farbiger, oft auch grausamer Mikrokosmos, ein Zwischenreich, in dem die Realität für das Phantastische durchlässig und die Trennschärfe zwischen den Guten und den Bösen, den Verrückten und den Normalen abhandengekommen ist.
Im Zentrum stehen Cahan, der Redakteur des "Jewish Daily Forward", das Waisenkind Benjamin, das in Harvard war und Detektiv wurde, und ein seltsamer, getriebener Mann, der Prostituierte angreift. Charyn nimmt wie gewohnt ein paar tragende Teile des Genres und baut drum herum seine fabelhaften Luftschlösser. In seiner Prosa fliegen die Sätze traumhaft leicht dahin, bildhaft, skurril, voller Überraschungen, sodass man einfach immer weiterlesen und zitieren möchte: "Das ganze Café konnte jedes Kratzen seines Bleistiftstummels auf dem Tischtuch hören, wie die Krallen eines erbarmungslos müden Tigers." Zugleich entsteht so das Bild einer verschollenen Welt, in der sich auch Henry James herumtreibt, eine Frau Hamlet auf Jiddisch spielt und auf dem Hut eines gefürchteten Schlägers Kanarienvögel sitzen und singen.
Michael Connelly, der seit mehr als dreißig Jahren Harry Bosch beschäftigt, der ihm den Anwalt und Halbbruder Michael Haller und die junge Ermittlerin Renée Ballard zur Seite gestellt hat, überrascht mit einer ganz neuen Figur: "Der Inselcop von L.A." (Kampa, 304 S., geb., 17,99 Euro). Er heißt Stilwell, wurde strafversetzt auf die schläfrige Insel Catalina vor der Küste von Los Angeles, scheinbar kein Ort für Mord, eher für entlaufene Haustiere und Parkdelikte. Aber die Wasserleiche einer jungen Frau lässt nicht lange auf sich warten. Der Mann ohne Vornamen bleibt jedoch insgesamt ein wenig blass. Die Gründe für seine Entfernung aus der Mordkommission werden nur angerissen. Sein hervorstechendstes Merkmal teilt er mit allen halbwegs interessanten Ermittlerfiguren: Er arbeitet lieber allein als im Team und setzt sich über Dienstvorschriften hinweg, wenn er sie als zu restriktiv empfindet.
Deswegen ist "Der Inselcop" kein schlechter Kriminalroman, das wird man bei Michael Connelly nie erleben. Er hat die nötige Komplexität, das richtige Gespür für Details und lokales Kolorit. Aber man fremdelt schon ein wenig mit diesem neuen Cop und wünscht sich Harry Bosch zurück. PETER KÖRTE
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.