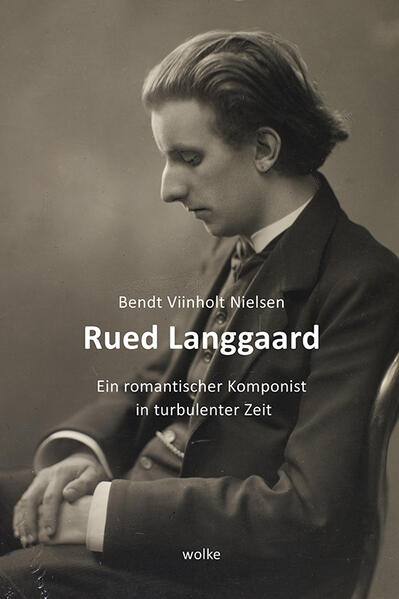
Zustellung: Di, 05.08. - Do, 07.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Rued Langgaard (1893-1952) ist ein Außenseiter und eine tragische Gestalt in der dänischen Musikgeschichte. Er geriet in Konflikt mit dem Zeitgeist, die Szene zeigte ihm die kalte Schulter und er wurde vergessen. Nach der Wiederentdeckung in den 1990er Jahren nimmt er heute einen Platz im internationalen Musikleben ein. So verbuchte die Deutsche Oper Berlin einen einmaligen Erfolg mit seiner Untergangsoper Antikrist.
Das vorliegende Buch ist eine Einführung in das ungewöhnliche Leben und Werk des Komponisten und Musikers. Der führende Langgaard-Experte Bendt Viinholt Nielsen geht vom Wunderkind Rud aus, das schon im jüngsten Alter die Positionierung der Musik im kosmischen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen intensiv erfasste. Diese Vision war Langgaards künstlerische Triebkraft, brachte ihn aber in einen scharfen Konflikt mit dem antiromantischen dänischen Musikleben seiner Zeit, in der die Tagesordnung vom damals wichtigsten Komponisten Dänemarks, Carl Nielsen, bestimmt wurde. Heute verstehen wir Langgaard als originellen und eigensinnigen Komponisten, als gleichzeitig zurückblickenden Romantiker und sonderbar modernen Künstler, dessen unkonventionelle musikalische Ideen oft weit über seine Zeit hinausweisen.
Mit dem neuen Wissen von Langgaards physischen und psychischen Herausforderungen und seiner unglücklichen Jugendliebe zu der mystischen Dora, die sein musikalisches Schaffen den größten Teil seines Lebens prägen sollte, kommt man in Bendt Viinholt Nielsens Schicksalserzählung dem Menschen hinter der exzeptionellen Musik näher denn je.
Er ist bekannt als Dänemarks merkwürdigster Komponist. Ein faszinierendes Buch enthüllt neue Facetten des Menschen Rued Langgaard. (Seismograf. org)
Mit gelungenem Schwung und Überblick, ein wirklich gutes und mitreißendes Leseerlebnis. (Publimus. dk)
Die dänische Originalausgabe erschien 2023. Die vorliegende deutsche Fassung ist eine durchgesehene und leicht erweiterte Ausgabe.
Das vorliegende Buch ist eine Einführung in das ungewöhnliche Leben und Werk des Komponisten und Musikers. Der führende Langgaard-Experte Bendt Viinholt Nielsen geht vom Wunderkind Rud aus, das schon im jüngsten Alter die Positionierung der Musik im kosmischen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen intensiv erfasste. Diese Vision war Langgaards künstlerische Triebkraft, brachte ihn aber in einen scharfen Konflikt mit dem antiromantischen dänischen Musikleben seiner Zeit, in der die Tagesordnung vom damals wichtigsten Komponisten Dänemarks, Carl Nielsen, bestimmt wurde. Heute verstehen wir Langgaard als originellen und eigensinnigen Komponisten, als gleichzeitig zurückblickenden Romantiker und sonderbar modernen Künstler, dessen unkonventionelle musikalische Ideen oft weit über seine Zeit hinausweisen.
Mit dem neuen Wissen von Langgaards physischen und psychischen Herausforderungen und seiner unglücklichen Jugendliebe zu der mystischen Dora, die sein musikalisches Schaffen den größten Teil seines Lebens prägen sollte, kommt man in Bendt Viinholt Nielsens Schicksalserzählung dem Menschen hinter der exzeptionellen Musik näher denn je.
Er ist bekannt als Dänemarks merkwürdigster Komponist. Ein faszinierendes Buch enthüllt neue Facetten des Menschen Rued Langgaard. (Seismograf. org)
Mit gelungenem Schwung und Überblick, ein wirklich gutes und mitreißendes Leseerlebnis. (Publimus. dk)
Die dänische Originalausgabe erschien 2023. Die vorliegende deutsche Fassung ist eine durchgesehene und leicht erweiterte Ausgabe.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
24. April 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Ein romantischer Komponist in turbulenter Zeit.
Seitenanzahl
168
Autor/Autorin
Bendt Viinholt Nielsen
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
270 g
Größe (L/B/H)
214/140/14 mm
ISBN
9783955932695
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 09.07.2025
Besprechung vom 09.07.2025
Reaktionär und Avantgardist
Lange geschmäht, jetzt wiederentdeckt: Eine Biographie stellt den Komponisten Rued Langgaard vor
Auf der Rangliste der kürzesten Symphonien, die jemals geschrieben wurden, dürfte die elfte von Rued Langgaard (1893 bis 1952) einen Spitzenplatz einnehmen. Gute fünf Minuten dauert das einsätzige Stück, es besteht aus einer elefantösen Walzermelodie, die in immer neuen Tonarten wiederholt wird. Das volle Orchester ist im Einsatz, das Tosen ist infernalisch, am Ende treten vier weitere Tuben zum Blechbläsersatz dazu und blasen mit gehaltenen Tönen zur Apokalypse. Ein Walzer, der sich in den Untergang dreht: Vom Konzept her erinnert das an Maurice Ravels "La Valse". Wo bei Ravel aber die äußerst kultivierte Form des Tonpoems dem Hörer einen Halt bietet, herrscht beim dänischen Komponisten die pure Ausweglosigkeit. "Ixion" betitelte er das Werk, nach der Figur aus der griechischen Mythologie, die von Zeus zur Strafe auf ein ewig sich drehendes Feuerrad gebunden wurde.
Wie man in der Biographie von Bendt Viinholt Nielsen nachlesen kann, muss sich Langgaard in seinem Leben oft selbst wie Ixion gefühlt haben: von den Kollegen belächelt, von der Kritik geschmäht, von der Überzeugung aber durchdrungen, musikalisch Außerordentliches zu sagen zu haben. In seiner Enttäuschung über die eher schwache Resonanz in seinem Heimatland nahm er es sogar mit dem führenden Kopf des dänischen Musiklebens auf: mit Carl Nielsen, bei dem er kurzzeitig Unterricht hatte (was aber irgendwie nicht funktionierte), der ihm später, ohne Aufhebens zu machen, Stipendien verschaffte, der für Langaard aber eine Zielscheibe war mit seiner Musik, die sich von einer gefühlsbetonten Romantik entfernt hatte.
Langaard selbst blieb Romantiker bis an sein Lebensende: Sämtliche seiner Symphonien setzen im voll instrumentierten Klangrausch ein (daraus spricht auch der Organist, als der Langgaard zeit seines Lebens tätig war). Der Tonalität blieb er trotz gewagter harmonischer Manöver treu, immer dominiert das Moment des Gesanglichen, schier endlose, herzhaft ausgesungene Melodien vermochte Langgaard zu komponieren - darin ein Schüler Richard Wagners, dessen Werk, vor allem den "Parsifal", er von früh an bewunderte. Auch wegen der Weltanschauung, die sich darin äußert: Musik war für den Dänen, der in einer christlich-sektiererischen Familie aufwuchs, immer auch Ausdruck von Religiosität, ein großes musikalisches Werk stets Zeugnis einer Weltanschauung.
Eine "Kirchenoper" nannte Langaard dann auch seine einzige Oper "Antikrist", die vor drei Jahren unter starker Resonanz an der Deutschen Oper Berlin gezeigt wurde. Ebenfalls 2022 setzten die Berliner Philharmoniker unter Sakari Oramo die erste Symphonie des Dänen aufs Programm, womit das Orchester an ein Kapitel der eigenen Geschichte erinnerte: Ermutigt von Arthur Nikisch und finanziell abgesichert von Mäzenen mietete der zwanzigjährige Komponist 1913 das Ensemble, um seinen riesenhaften Erstling uraufführen zu lassen. Ein großer Publikumserfolg mit positivem Echo bei der Kritik. Verbindungen in die Stadt blieben bestehen, ebenso nach Karlsruhe, wo sich der Dirigent Hans Seeber van der Floe für Langgaards Musik einsetzte - auch dort unter starkem Zuspruch des Publikums.
Die dänischen Zeitgenossen waren mit Langgaards Stil indes oft überfordert. Was Bent Viinholt Nielsen aus damaligen Kritiken zitiert, ist in der Art der Argumentation und auch in der puren Herablassung erschreckend. Gerne griff man physiognomische Besonderheiten des Komponisten auf, machte sich über seine lange Statur lustig oder über seine hohe Stimme. Dass Langgaard wohl an einer hormonellen Störung litt, die sich auf die geschlechtliche Entwicklung auswirkte, dass der Komponist autistische Züge trug, erwähnt Nielsen früh im Buch - gleichsam als Hintergrund, um Langgaards oft unkonventionelles Verhalten verstehbar zu machen. Für solches Verständnis war zu Lebzeiten des Komponisten nicht viel Platz, aus der Rolle des Sonderlings wurde Langgaard kaum mehr entlassen. Gab es seine Werke in Konzerten bald kaum mehr zu hören, so kümmerte sich doch der dänische Rundfunk um die Aufnahme und Ausstrahlung vieler seiner Stücke.
Der Romantiker ist die eine Seite dieses Komponisten, der Pionier die andere. Dazu zählt schon die Komposition der provokant kurzen 11. Symphonie. Aber auch mit seinen gewagten Klangexperimenten machte Langgaard von sich reden. Als der kürzlich verstorbene Komponist Per Nørgård einmal György Ligeti Partiturseiten von Langgaards "Sphärenmusik" vorlegte, ohne den Namen des Schöpfers zu nennen, da staunte Ligeti, dass Jahrzehnte vor ihm schon ein anderer Komponist Klangschichtungen aus liegenden Clustertönen ersonnen hatte, wie sie heute vor allem mit dem Ungarn in Verbindung gebracht werden. Avantgardist, Konservativer, Reaktionär: All das war Rued Langgaard mehr oder weniger gleichzeitig. Was die Zeitgenossen verstörte, macht ihn heute umso interessanter. Die neue Biographie lässt sich nicht zuletzt als Warnung lesen vor einem Schubladendenken, wie es in den stilistischen Kontroversen der Musik bis heute gerne angewendet wird. CLEMENS HAUSTEIN
Bendt Viinholt Nielsen: "Rued Langgaard". Ein romantischer Komponist in turbulenter Zeit.
Aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle.
Wolke Verlag, Berlin und Hofheim 2025. 168 S., Abb., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Rued Langgaard" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









